Fort Wayne – Band 1 – Kapitel 2
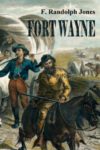 F. Randolph Jones
F. Randolph Jones
Fort Wayne
Eine Erzählung aus Tennessee
Erster Band
Verlag von Christian Ernst Kollmann. Leipzig. 1854
Zweites Kapitel
Es war dunkel geworden und das Licht des Mondes begann allmählich die schwindende Tageshelle zu ersetzen, während das Schweigen der Wildnis noch tiefer und melancholischer zu werden schien. Die Klippen und Bergkuppen warfen ihre langen schwarzen Schatten über das Flusstal, welchem ein feiner silbergrauer Nebel entstieg, der den kühnen Formen der ganzen Umgebung einen seltsam fantastischen Anstrich verlieh.
Es schien, als ob die Lagergesellschaft sich dem Eindruck der nächtlichen Stille nicht entziehen könne. Die frugale Abendmahlzeit war beendet, aber seit einer Stunde hatte gleichwohl kaum ein Wort das Schweigen der Ermüdeten unterbrochen. In einer Entfernung von etwa fünfzig Schritt schirmten der junge Neger und ein Mann von athletischem Körperbau, beide die Büchse im Arm und sorgsam umherspähend, als Vorposten das Lager. Auf einem von Moos und dürren Blättern flüchtig bereiteten Sitz hatten die zwei Frauen dem Feuer zunächst Platz genommen, verschieden an Jahren und körperlicher Schönheit, aber beide den Ausdruck milden Trübsinnes unverkennbar in ihren Zügen tragend. Neben ihnen starrte in seine Wolldecke gewickelt ein Mann mit tiefgefurchten Zügen und ergrauendem Haar unverwandt in die Flamme, während ein altes in Leder gebundenes Psalmenbuch auf seinen Knien das verdüsterte Gemüt des zerstreuten Beters vergebens dem Trost des göttlichen Wortes zu eröffnen versuchte.
Die Gruppe wurde durch vier Jünglinge vervollständigt, deren Alter nur wenige Jahre verschieden war, in deren kräftigem Gliederbau aber sich bereits die volle aufblühende Kraft einer arbeits- und tatenreichen Zukunft offenbarte.
»Es nützt nichts, darüber nachzudenken!«, begann mit einer tiefen und eintönigen Stimme der alte Mann, den ein schwerer Seufzer seiner Gefährtin aus seinem Hinbrüten geweckt hatte. »Die Wellen des Tugaloo geben nimmer ihren Raub heraus! Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, sein Name sei gelobt.« Der Ausdruck seiner Gesichtszüge schien dieses Trostspruches zu spotten, denn ein herber Schmerz, dem sich der gewaltsam verschlossene Groll eines aufs Tiefste verbitterten Herzens beimischte, zuckte unverkennbar über sein Antlitz, als er mit einem dumpfen Stöhnen sich wieder zu dem Gebetbuch niederbeugte. »Ich wünschte, Sara, wir hätten nimmer unsere Hütte verlassen, denn der Fluch des Allmächtigen verfolgt uns seit jener Stunde, wo wir zu Genossen fremder Missetat wurden.«
Die Angeredete warf einen ängstlich besorgten Blick auf ihre jugendliche Nachbarin, die bei den Worten des Alten zusammenschauerte und wie hilfesuchend um sich blickte. »Es ist nicht wohlgetan, David«, sagte sie, »mit dem Herrn unseres Schicksals zu hadern. War er nicht auch unser Sohn und verlassen von den Menschen, als er Zuflucht suchte bei denen, die nimmer ein Kind ihres Herzens verleugnen können? Weine nicht, Edista!«, wendete sie sich zu ihrer Gefährtin, »du hast an mir eine Mutter gefunden und der Tod unseres kleinen Joe soll mich nimmer von dir trennen.«
»Hoffst du, Weib, dass unsere Prüfungen zu Ende sind?«, fragte David und schleuderte einen Blick des Hasses auf Edista, »ich sehe im Traum wie im Wachen den Untergang des Hauses Morris, weil es gefrevelt hat wider den Herrn. Es wäre denn«, setzte er nach einer Pause halb leise hinzu, »dass wir uns lossagten von denen, welchen die Verdammnis auf der Stirn geschrieben steht.«
Bei diesen Worten richtete sich die Jüngere der Frauen hastig empor. Sie war schön, wie sie dastand, angeglüht von der Flamme des Feuers, leicht und zart gebaut, das blasse Gesicht von dunklen Locken umwallt, zitternd vor Schmerz und Aufregung, gebeugt unter der Last eines tiefen Kummers, und doch in den großen dunklen Augen das Feuer eines entschlossenen Mutes und edlen Stolzes. »Ich will Euch verlassen!«, sagte sie hastig, – »jetzt, in diesem Augenblick! Richard wird für sein Weib eine Zuflucht finden und besser, im Schoß der Wildnis wohnen, als bei dir, alter Mann, dessen Herz von Stein und ohne Erbarmen ist.«
Damit hatte sie sich vom Feuer entfernt und war im Begriff, sich der dunklen Gestalt des am Flussufer Wache haltenden Mannes zu nähern, als sie sich von Sara zurückgehalten fühlte.
»Bleibe bei uns, Edista! Was soll aus mir werden, wenn ich auch dich verliere, du Tochter des Leidens? Höre nicht auf ihn; er ist betrübt, denn seine Seele hing an dem Kleinen.«
Auch David richtete sich nun langsam auf, fuhr mit der Hand über sein Gesicht, als wolle er die finsteren Regungen, die sich in demselben aussprachen, verscheuchen. »Will meine Tochter Zwietracht säen zwischen mir und meinem Erstgeborenen?«, fragte er. »Die Sprache des Schmerzes darf nicht gedeutet werden wie andere Rede. Komm, es ist Nacht und wir haben morgen und noch viele Tage eine weite Reise.«
Edista ließ sich von Sara schweigend auf ihren Sitz niederziehen, und nachdem David sich ausgestreckt und dichter in seine Decke gehüllt hatte, unterbrach nur leises Flüstern und Weinen der beiden Frauen die tiefe Stille, welche das eintönige Rauschen des Flusses nicht störte, sondern nur wirksamer hervorhob.
Inzwischen schritten der Neger und sein Herr am Rande der Wiesenfläche auf und nieder und spähten wachsam nach allen Seiten. Wenn sie sich auf ihrer Wanderung begegneten, wurden einzelne Worte ausgetauscht, zu denen jedes Mal die Gesprächigkeit des jungen Schwarzen die Veranlassung gab.
»Alter Massa schlafen, Reuben schlafen, Benny schlafen, alle schlafen. Pompey und Massa Richard gute Wache halten für Missus!«, flüsterte der Schwarze und blickte selbstgefällig umher.
»Ich denke, wir haben das Schlimmste überstanden«, sagte Richard, »und liegen nur erst die Cumberland-Berge hinter uns, so dürfen wir uns für geborgen erachten.«
Der Neger machte Miene, das Gespräch fortzusetzen, als ein leiser, kaum vernehmbarer Laut gleich dem Knacken eines dürren Astes beide aufhorchen ließ.
Pompey brachte rasch seine Büchse in schussfertige Lage, und seine glänzenden Augäpfel schienen das niedrige Dickicht, welches am Fuße der steilen Berglehne den Lagerplatz begrenzte, durchdringen zu wollen. Richard machte einige Schritte zu der Gegend hin, von welcher der Schall zu kommen schien und blieb dann horchend stehen.
»Es ist nichts!«, sagte er nach einer Pause mit gedämpfter Stimme, »der Nachtwind streicht über die Berge. Geh auf deinen Posten zurück, Pompey, und halte dich munter. Um Mitternacht lösen die Brüder uns ab.«
Pompey leistete dem Befehl Gehorsam und trollte langsam am Flussufer hin, während Richard, auf sein langes Gewehr gestützt, mit einem Ausdruck von Zärtlichkeit und Sorge zum Lager hinblickte, welches nur noch ein glimmender Kohlenhaufen und der unförmige Umriss des Wagens bezeichnete. Die Zugtiere lagen wiederkäuend am Ufer. Als Pompeys Schatten in der Dunkelheit verschwunden war, fühlte Richard schwer und doch mit einem gewissen Stolz die Verantwortlichkeit, welche in dieser düsteren Stunde auf ihm lag. Wieder mochte eine Stunde verflossen sein, als das heisere Krächzen einer Eule ihn aus seinen Gedanken emporriss. Unwillkürlich richtete sich sein Blick zum erwähnten Unterholz und ein jäher Schrecken bebte durch seine Gestalt, als er die Zweige in langsam wellenförmige Bewegung geraten sah, als striche der Wind über sie hin. Und doch regte sich noch kein Lüftchen, obwohl der Himmel mit einem trüben Dunstschleier bedeckt war, aus welchem der Mond blass und von einem rötlichen Rand umgeben niederschaute. Ein Augenblick genügte, um Richard seine ganze Fassung wiederzugeben. Mit fester Hand schüttete er frisches Pulver auf die Pfanne, rückte die Scheide seines Jagdmessers zurecht und schritt dann festen Fußes der verdächtigen Gegend zu. Als er das Buschwerk erreicht hatte, glaubte er, eine jener Täuschungen habe ihn geneckt, welche die Nacht, und zumal in der Einsamkeit des Waldes, so oft hervorruft. Alles war still wie zuvor. Schon war er im Begriff, auf seinen Standort zurückzukehren, als dasselbe heisere Eulengeschrei von der Gegend her ertönte, auf welcher der Neger seinen Posten hatte. Eine Sekunde später schlug ein furchtbarer, markerschütternder Schrei, dem der scharfe Knall einer Büchse folgte, an seine Ohren.
»Herrgott, die Indianer!«, murmelte er vor sich hin. Unwiderstehlich trieb es ihn zu dem Lagerplatz, wo er sein höchstes Gut der entsetzlichen Gefahr preisgegeben wusste. Mit gewaltigen Sprüngen flog er an dem Waldrand hin – da fühlte er sich mit eiserner Faust an den Füßen gepackt. Er stürzte. Während sich im Fallen sein Gewehr entlud, erfüllte das gellende Kriegsgeschrei der Hiwassee das weite Tal. Mit der Kraft der Verzweiflung versuchte er sich aufzurichten. Niemand vermag die Qualen seines Herzens zu beschreiben, als er in die blitzenden Augen eines riesenhaften Wilden blickte, der, auf seiner keuchenden Brust knieend, mit mächtigem Schwung den blitzenden Tomahawk über seinem Haupt erhob.
Es entstand ein kurzes, verzweifeltes Ringen; krampfhaft griff er nach der Kehle des Indianers, der in seiner Siegesgewissheit sich an dem Krümmen seines Opfers zu weiden schien. Einen Augenblick schien es, als könne Richard seinem Schicksal entgehen. Er zog den Feind zu sich herab, dass sein glühender Atem ihn berührte. Mit der Linken versuchte er sein Jagdmesser frei zu machen, es gelang, und schon erhob er es zum Stoß, als der scharfe Blick des Wilden die ihm drohende Gefahr bemerkte und das Messer seiner Hand entriss. Das Beil senkte sich hernieder. Richard schloss die Augen und seufzte leise: »Edista!«
Schon hatte er alle Schrecken des Todes durchgefühlt, als ein neuer gellender Ruf seine schwindenden Lebenskräfte zurückrief. In demselben Moment stürzte der Indianer mit einem röchelnden Laut auf ihn nieder und ein heißer Blutstrom überströmte Richards Gesicht. Noch einmal zuckte der gewaltige Körper des Feindes zusammen, aber der Tomahawk entsank der kraftlosen Hand. Emporspringend sah sich Richard von seinem Feind, dem ein Pfeil den Hals durchbohrt hatte, erlöst. Sein erster Blick fiel auf den Lagerplatz. Der Wagen war umgestürzt und um das erlöschende Feuer tummelten sich in wilder Verwirrung dunkle Körper, fliehend und verfolgend, aber nur einen Moment dauerte das wüste Schauspiel. Drei oder vier kupferfarbene Gestalten flohen blitzschnell über die Wiese und verschwanden im Schatten des Waldes, dann war alles still und die schweigende Nacht lag wiederum auf der ganzen Szene.
Als Richard den Lagerplatz erreicht hatte, sah er den Vater und die Brüder am Boden liegen, und so plötzlich hatte der Anfall die Schlummernden überrascht, dass sie, noch mit den Wirkungen des Schlafes kämpfend, erstaunt um sich blickten und das Ganze für ein wüstes Traumgebilde zu halten schienen. Edista beugte sich über Sara hin, welche regungslos am Boden lag und noch fest zu schlafen schien. An den umgestürzten Wagen gelehnt, standen zwei Indianer, die Tomahawks fest in die Hand gepresst und ernsten Schweigens die verstörte Gruppe betrachtend. Den Gefühlen seines Herzens Raum gebend, schloss Richard Edista in seine Arme, die bleich und zitternd auf Sara deutete.
»Gelobt sei Gott!«, rief er, »du bist unverletzt! gerettet!«
Edista antwortete nicht, sondern deutete mit der Miene des Entsetzens auf Sara. Eine furchtbare Ahnung durchzuckte Richard. Auf die Mutter zustürzend, richtete er sie empor. Ein Schrei des Entsetzens rief die ganze Familie zu einem trostlosen Schauspiel. Gleich einem gereizten Tiger stürzte David auf seine Frau. Als er mit zitternden Händen das Tuch wegriss, welches ihren Kopf umhüllte, schoss ihm aus dem klaffenden Schädel ein Blutstrom entgegen.
Eine Minute lang schloss der jähe Schreck jeden Mund, und als sich dann die Söhne jammernd und weinend um den Leichnam drängten, als Edista fast bewusstlos an Richards Brust hing und selbst in den starren Zügen der beiden Indianer ein Strahl des Mitgefühls zu lesen war, da bot die unglückselige Gruppe ein so erschütterndes Schauspiel dar, wie sie nur Amerikas Urwälder in jenen blutigen Zeiten jemals gesehen haben mochten.
David sprach kein Wort, aber das krampfhafte Zucken seiner geschlossenen Lippen, das Zittern, welches seine Glieder durchbebte, verriet deutlicher als Tränen die unermessliche Seelenqual des alten Mannes, dessen mit einer harten Rinde umschlossenes Herz zum ersten Male zu brechen schien.
Der Jüngere der Indianer hatte frisches Holz auf das Feuer geworfen, welches hoch emporlodernd die Gegend mit grellem, schwankendem Licht übergoss. Langsam und sanft, als trage er ein schlummerndes Kind in seinen Armen, legte David den Leichnam seiner Frau auf den Rasen nieder; dann gebot er mit einer stummen Handbewegung, ihn mit der Toten allein zu lassen. Während alle, an blinden Gehorsam dem Familienoberhaupt gegenüber gewöhnt, sich zu der anderen Seite des Feuers zurückzogen, kniete er nieder, öffnete sein Psalmenbuch und begann zu beten.
Es dauerte lange, ehe jemand die Indianer, welche gleichfalls schweigend zurückgetreten waren, auch nur bemerkt hatte. Richard hatte die bittere Aufgabe, Edista zu trösten, während sein eigenes Herz sich in unnennbarem Schmerz zusammenzog. Reuben, Nathan, Benjamin und Frank, seine Brüder, waren beschäftigt, ein Grab zu graben. Der dumpfe Klang der Spaten, welche das Erdreich durchbrachen, mischte sich in das murmelnde Gebet des Vaters, der allem Irdischen entrückt schien.
»Sieh, Richard! Der Fluch meines Vaters verfolgt uns!«, sagte Edista zusammenschaudernd. »Ich habe Unglück und Jammer unter die deinen gebracht und darf nicht klagen, dass sie mich hassen.«
»Dich hassen?«, murmelte Richard, »dich reinen Engel Gottes hassen? Wehe ihnen, wenn sie es tun. Sie hat dich geliebt wie eine Tochter, und ihr Geist wird dich schützen, wenn mein Arm es nicht mehr vermag.«
David, der sein Gebet beendet hatte, trat so plötzlich und mit einem so abstoßenden Ausdruck von Hass, Gram und Fanatismus in seinen Mienen zu beiden, dass Edista sich dichter an Richards Brust drängte. Das Gebet hatte dem Alten keinen Frieden gebracht und die abergläubische Überzeugung, dass Edista die Quelle des Unglückes für die Familie sei, drängte alle sanfteren Gefühle seines Herzens zurück.
»Der Geist meines Weibes schreit um Rache vor dem Thron des Höchsten!«, sagte er, »ihr Blut komme über dich, unglückseliges Geschöpf! Weiche von hinnen, auf dass der Fluch von uns genommen werde!«
»Haltet ein!«, rief Richard. Sein Auge blitzte drohend dem Vater entgegen. »Ich werde es nimmer dulden, auch von Euch nicht, dass meine Frau mit schnöder Rede gekränkt werde! Aber Ihr habt recht, wir müssen uns trennen, unsere Pfade können nicht länger zusammen gehen. Die Morgensonne wird uns weit von Euch und dem Grab der Mutter finden. Komm, Edista!«, wendete er sich zu der zitternden Gefährtin, »besser ist es, in der Wildnis umherirren, als dem verblendeten Hass eines Mannes ausgesetzt zu sein, von dem wir Liebe zu fordern ein Recht hätten.«
»Willst du die Frau in ihres Vaters Haus zurückführen?«, fragte David hastig und ein Schimmer von Hoffnung flog über seine düsteren Züge.
»Nimmermehr!«, rief Richard, »des Weibes Platz ist an der Seite ihres Mannes. Edistas Vater hat seine Pflicht verkannt, wie Ihr die Eure. Habt Ihr vergessen, dass sie mir verlobt wurde mit seinem Willen durch Eid und Männerwort, ehe es ihm einfiel, seine Zusage zu brechen und das teuer errungene Kleinod einem Fremdling hinzuwerfen wie eine Ware?«
»Wenn Oberst Beaufort Unrecht tat, musstest du es vergelten durch ein schlimmeres Verbrechen, durch Raub und Entführung? Wahrlich, ich sage dir …«
»Genug!«, brauste Richard auf, »zwingt mich nicht zu vergessen, dass ich meines Vaters Sohn sei.«
»Du hast es bereits vergessen, seit Langem!«, murmelte David in hartnäckiger Erbitterung. »Ziehe immerhin von dannen! Es ist wohlgetan, mich und deine Brüder in der Wüste zu verlassen. Nimm deinen Wagen und deine Zugtiere, deinen Neger, dein Geld und deine Waren. Du bist der reiche Mann, was kümmert dich Hiob, den der Herr geschlagen?«
»Vater!«
»Noch eine Nacht wie diese, und die Tomahawks der Indianer werden ihr Werk vollendet haben. Du aber wirst den Namen Morris glücklich nach Fort Wayne tragen. Es ist gut, du magst gehen.«
Damit wendete sich David mit bitterem Lächeln ab und sein Blick fiel auf die beiden Indianer. Ein Ausdruck des Erstaunens, dem der furchtbarer Wut folgte, flog über seine Züge, als er mit bebender Stimme seinen Söhnen zurief: »Reuben, Frank, Benjamin! Die Mörder eurer Mutter sind mitten unter euch und ihr erwürgt sie nicht, wie Gideon die Männer von Aschdod? Hat der Herr mein Auge geblendet und meine Sinne verwirrt? «
»Es sind unsere Retter!«, sagte Reuben, sich auf den Spaten stützend, mit dem er seine traurige Arbeit verrichtete, »freilich nur Rothäute und blinde Heiden, aber tüchtige Burschen. Sie fuhren unter die Räuber mit Geschoss und Beil wie das Feuer des Himmels.«
»Den langen Kerl da hat der Jüngling gefällt wie eine Tanne!«, setzte Frank hinzu und deutete auf den Leichnam eines Indianers, der mit emporstarrenden, gebrochenen Augen unter den Rädern des Wagens lag. »Ihr seid von einem anderen Stamm als diese Räuber«, setzte er, zu Takannah gewendet, hinzu. »Ist es nicht so?«
»Die Hiwassee sind Hunde und fliehen vom Kriegspfad der Cherokee!«, sagte Takannah mit einem geringschätzigen Blick auf den Toten.
»Ihr habt uns das Leben gerettet!«, fuhr Frank fort, »und wenn Ihr uns sicher nach Fort Wayne bringen wolltet, werden unsere Hände nicht geschlossen sein. Meint Ihr nicht auch, Vater?«
Den Alten schien es zu verdrießen, dass er sein Rachegelüste unterdrücken und sich den Indianern, die er insgesamt hasste wie die Hölle, verpflichtet sehen musste. Gleichwohl nickte er seine Beistimmung und versprach Takannah eine Flinte, wenn er ihn mit den seinen unversehrt zum Fort führen wolle.
Takannahs Augen glänzten vor Freude bei dieser Verheißung, die seinen höchsten, lange gehegten Wunsch zu befriedigen versprach; denn damals waren Feuergewehre unter den westlichen Stämmen ebenso selten wie geschätzt, da die Politik der weißen Ansiedler deren Verbreitung unter dem Indianern mit eifersüchtiger Konsequenz zu verhindern beflissen war.
»Es ist gut!«, sagte der Häuptling, »die bleichen Gesichter werden die Wasser des Achal-Fa1 sehen. Takannah und Watungo werden vor ihnen hergehen.«
Eine seltsame Erscheinung unterbrach die einsilbige Unterhaltung. Grinsend vor Stolz und sein perlenweißes Gebiss zeigend, trat Pompey aus der Dunkelheit in den Lichtkreis des Feuers, den Leichnam eines Indianers nach sich schleppend, wie damals Falstaff den edlen Percy. Seine sieghafte Miene verwandelte sich zwar in heftigen Schrecken, als er die beiden Cherokee erblickte. Instinktmäßig ließ er seine Trophäe fallen; als aber die friedliche Haltung der Gruppe seine Besorgnisse zerstreut hatte, trat er mit erhabenem Selbstbewusstsein an Richard Morris, seinem Gebieter, heran.
»Pompey tapfer gewesen, Massa, sehr gekämpft mit Rothaut und ihn tot geschossen, puff!«, sagte er und begleitete seine Worte mit einer mimischen Darstellung, der es mehr an Grazie als an Lebendigkeit gebrach. »Pompey alles tot machen, wenn ihm Schildwache stehen, he?«
Richard, der den mutigen Afrikaner schon verloren gegeben hatte, brachte durch warme Lobsprüche das Entzücken desselben auf den Gipfelpunkt, während die beiden Cherokee bald den Leichnam des Hiwassee, bald den glücklichen Schützen mit unmutigen Blicken maßen. Sie erkannten in dem Toten einen gefürchteten Häuptling der Hiwassee. So glücklich sie sich geschätzt haben würden, wäre er unter ihrem Tomahawk gefallen, so erfüllte es sie doch mit Unwillen, dass die Hand eines Sklaven den stolzen Krieger in das Schattenreich gesendet hatte. Sie wendeten sich deshalb missmutig ab, als Pompey nicht müde wurde, seine Geschicklichkeit zu preisen, und verschwanden in dem Dunkel, welches nach dem Untergang des Mondes auf der Gegend ruhte.
David und seine Söhne aber legten Saras Leichnam in das frische Grab. Mit zitternder Stimme las Ersterer einen Psalm und als die treue Gefährtin seiner Tage, in einen grünen Teppich von Blättern und Zweigen gehüllt, dem Schoß der Erde übergeben wurde, sank er mit verhülltem Haupt nieder und vermischte sein krampfhaftes Schluchzen mit dem stillen Weinen seiner Kinder und Edistas.
Schreibe einen Kommentar


Schreibe einen Kommentar