Jimmy Spider – Folge 9
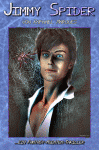 Jimmy Spider und die Boje im Nebel (Teil 3 von 3)
Jimmy Spider und die Boje im Nebel (Teil 3 von 3)
Tja, nun wurde es langsam brenzlig. Feige Hubschrauber, schockierende Neuigkeiten und fliegende Cyborg-Kampfroboter hatte ich (im Gegensatz zur Besatzung des Schiffes) relativ glimpflich überstanden, doch nun ging es mir an den Kragen.
Ich hechtete zur Reling. Sie war für mich ein letzter Rettungsanker. Auch mein Vorfahre Geoffrey McShady hielt sich gut zwanzig Meter von mir entfernt an ihr fest. Zumindest glaubte ich das. Vielleicht hing er auch nur noch da herum, in den letzten Sekunden seines Lebens.
Plötzlich fiel mir ein, dass ich auch noch einen Rucksack dabei hatte. Darin sollte angeblich ein Fallschirm enthalten sein.
Sofort setzte ich den Gedanken in die Tat um und zog den Rucksack von meinem Rücken. Als ich ihn öffnete, quoll mir sofort ein ekelhafter Geruch entgegen. Es roch nach … Käse. Stinkender Käse.
Wenige Sekunden später hielt ich meine Essensration, bestehend aus einem belegten Brot und einer kleinen Flasche Wasser in den Händen. Momentan konnte ich damit aber absolut nichts anfangen und warf es einfach weg.
Als Nächstes kramte ich ein Handy heraus. Leider hatte es keinen Empfang.
»Wäre auch zu schön gewesen …«
Auch das Handy ging den Weg alles Unbrauchbaren.
Immer hastiger kramte ich in der Tasche herum, während das Schiff weiter nach vorne kippte.
Zum Vorschein kamen eine Uhr, ein Notizblock, eine SIG Sauer, eine Packung Taschentücher, ein Pullover, Socken, eine Landkarte von Paraguay (sehr hilfreich, wenn man sich vor der Küste Brasiliens befindet), ein paar Stifte, ein Wörterbuch und … eine Packung Kondome! Welcher Trottel hatte das nur zusammengestellt? Hatten meine Kollegen gedacht, das fliegende Schiff wäre eine geheime Nudistenbasis?
Ein Knarren vor mir riss mich aus meinen Gedanken. Doch es war nicht nur ein einfaches Knarren – Geoffrey McShady stand vor mir.
Wie er es geschafft hatte, trotz seiner schweren Verletzungen bis zu mir hoch zu klettern, wusste ich nicht. Jedenfalls war er da und lächelte mir entgegen.
Seine Stimme war sehr leise geworden, aber verstehen konnte ich ihn dennoch.
»Manchmal fehlt dir etwas der Blick fürs Wesentliche.«
Langsam nahm er seine rechte Hand von der Reling und streckte sie meinem Rucksack entgegen. Wie er es so überhaupt schaffte, trotz der Schräglage des Schiffes seinen Stand zu behalten, war nicht erklärbar.
Erst jetzt fiel mir auf, mit welch schrecklichen Verletzungen er sich zu mir hoch geschleppt hatte. Geoffreys rechter Arm fehlte komplett. Auch seine Schulter zerfiel langsam zu Staub, der als kleine Fahne dem Meer entgegen wehte.
Seine Hand hielt plötzlich einen gelben Strick, der aus meinem Rucksack führte. Damit also konnte man den Fallschirm öffnen.
Ich sah noch einmal in sein Gesicht. Es war grau geworden, alt und zerfurcht, fast schon greisenhaft.
Wie ein sanfter Luftzug schwebten mir seine letzten Worte entgegen. »Leb wohl, mein Freund …«
Dann zog er an der Leine. Augenblicklich öffnete sich der Fallschirm, und ein Windstoß riss mich in die Höhe. Aus den Augenwinkeln erkannte ich noch, wie Geoffrey McShady endgültig zu Staub zerfiel. Nach seinem Ende stürzte auch das fliegende Schiff den Fluten entgegen.
Ich konnte nicht weiter hinsehen, denn um mich herum brandete ein Sturm auf, als hätte jemand einen riesigen Ventilator auf volle Kraft gestellt.
Der Wind peitschte mir so stark entgegen, dass ich die Augen schließen musste, während ich mich mit Mühe an den Schlaufen meines Rucksackes und damit an dem aufgespannten Fallschirm festhielt.
In das Tosen des Windes mischte sich ein infernalisches Krachen. In diesem Moment musste die Cursed Virgin Bekanntschaft mit der Meeresoberfläche gemacht haben.
Minuten vergingen, in denen ich zum Spielball des Windes wurde, der so stark an meinen Armen zerrte, dass ich glaubte, sie würden mit dem Fallschirm davonfliegen.
Irgendwann schrie ich nur noch vor Schmerzen, und als diese unerträglich wurden, ließ ich den Fallschirm los.
Ich glaubte schon, in meinen Tod zu stürzen, doch nur eine Sekunde später landete ich im Wasser.
Einige Sekunden schlug ich wild um mich, bis ich mich wieder gefangen hatte. Vorsichtig öffnete ich die Augen.
Von dem Schiff war nichts mehr zu sehen. Ehrlich gesagt, es war überhaupt nichts zu sehen. Eine dichte Nebeldecke hatte sich über das Wasser gelegt, sodass ich kaum einen Meter weit sehen konnte.
Ich vermutete, dass der Nebel von der Wolkenfront, die das fliegende Schiff geschützt hatte, stammte, die nun in sich zusammengefallen war.
Eine Orientierung war so gut wie unmöglich. Wohin hätte ich mich auch orientieren sollen? Schließlich befand ich mich einige Hundert Kilometer vor der brasilianischen Küste, einem Ort, an dem sich Barrakudas und Haie Gute Nacht sagen.
Trotzdem sah ich ein blinkendes Licht. Verlor ich schon langsam den Verstand?
Nein, das Licht gab es wirklich. Irgendwo vor mir durchschnitt es phasenweise die Nebelwand. Ich zögerte keine weitere Sekunde und schwamm ihm entgegen.
Das gelbe Licht wurde immer deutlicher, und trotzdem sah ich nicht, von wem es stammte. Hatte es noch jemanden außer mir hierher verschlagen? War Rodrigo zurückgekehrt, um mich zu retten? Oder wartete bereits ein skelettierter Fährmann, um mich in die Unterwelt zu geleiten?
Ich wollte es nicht hoffen und schwamm stoisch weiter.
Irgendwann lichtete sich vor mir leicht der Nebel. Und endlich sah ich, wer (oder vielmehr was) das blinkende Licht abgab: eine Boje.
Ich konnte es kaum fassen. Wer setzte schon mitten in der Einsamkeit eine blinkende Boje aus? Nun gut, nach meiner Begegnung mit einem fliegenden Schiff schockte mich so schnell nichts mehr. Aber dennoch … irgendetwas stimmte hier nicht.
Wie konnte die Boje überhaupt ihr Licht aussenden? Eigentlich musste sie hier doch komplett von der Stromzufuhr abgeschnitten sein, und eine batteriebetriebene Boje hatte ich noch nie erlebt.
Auch als ich näher heranschwamm, entdeckte ich keinen Ursprung des Lichtes. Vielmehr schien es aus dem Nichts zu kommen. Das Licht blinkte circa zehn Zentimeter über der Spitze der orange-weiß-gestreiften Boje auf.
Was sollte das nun wieder sein? Eine Geisterboje? »Na super!«, rief ich in den Nebel hinein. »Und was kommt als Nächstes? Zombie-Seepferdchen?«
Natürlich antwortete mir niemand. Dafür wollte ich testen, ob es sich bei der Boje wirklich um eine Geistererscheinung handelte. Ich schwamm näher heran und tippte mit dem linken Zeigefinger gegen die Oberfläche.
Tatsächlich, es gab sie, wenn auch nur für kurze Zeit. Denn durch mein Antippen entstand ein Loch in der Boje, durch das mit einem lauten Pffffft die Luft entwich. Kurze Zeit später sank die Boje in sich zusammen, und die Reste verschwanden im Meer.
Was war das nun wieder gewesen? Eine Ballon-Boje? Ein ausgesetzter Aprilscherz?
Wie dem auch sei, das Sinnieren über diesen äußerst merkwürdigen Vorgang brachte mich auch nicht weiter. Vielmehr brachte mich momentan gar nichts weiter.
Also ließ ich mich einfach auf meinem Rücken von der Wasseroberfläche treiben. Zwischendurch holte ich mir noch eine Zigarre aus meinem wasserdichten Zigarrenetui, steckte sie in den Mund und zündete sie mit meinem ebenso wasserdichten Feuerzeug an.
So ließ ich mich treiben und harrte der Dinge, die da hoffentlich kommen würden …
Fortsetzung folgt …
Copyright © 2008 by Raphael Marques




