Buffalo Bill Der letzte große Kundschafter – 10. Kapitel
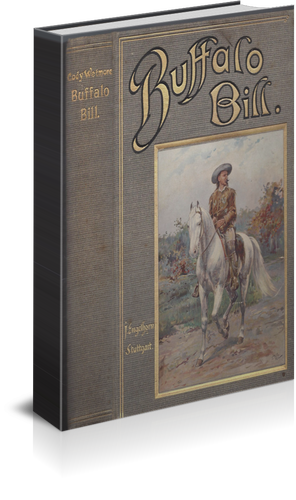 Buffalo Bill
Buffalo Bill
Der letzte große Kundschafter
Ein Lebensbild des Obersten William F. Cody, erzählt von seiner Schwester Helen Cody Wetmore
Meidingers Jugendschriften Verlag, Berlin 1902
Zehntes Kapitel
Das Echo aus Fort Sumter
Ein aus Fort Sumter ertönender Kanonendonner versetzte die ganze Gegend in Aufruhr. In Kansas, wo bereits Blut vergossen war, erreichte die Erregung eine ungewöhnliche Höhe. Auch Will sprach den Wunsch aus, sich anwerben zu lassen, doch wollte die Mutter nichts davon hören.
Mein Bruder hatte das in der Poststation abgelegte Gelübde keineswegs vergessen, und nun der Krieg auszubrechen drohte, so glaubte er, dass die richtige Zeit und Gelegenheit zur Rache gekommen sei. Jedenfalls würde er nun doch die Waffen gegen des Vaters einstige Feinde erheben und zugleich seinem Vaterlande dienen können. Unter diesem Gesichtspunkt stellte Will mit beredtem Munde und in den glühendsten Farben der Mutter die Sache dar, trotzdem aber blieb sie unerschütterlich.
»Du bist zu jung zum Soldaten«, sagte sie. »Man würde dich gar nicht annehmen, und wenn man es täte – ich könnte es nicht ertragen. Mir bleibt nur noch kurze Zeit zu leben, warte um meinetwillen mit deinem Eintritt in das Heer, bis ich nicht mehr bin.«
Eine solche Bitte konnte nicht missachtet werden, und so versprach Will, während der Mutter Lebzeiten keine Kriegsdienste nehmen zu wollen.
Längst schon war Kansas der Schauplatz bitterer Kämpfe zwischen zwei Parteien, und obwohl die Freibodenmänner seit dem Eingreifen der Regierung im Jahre 1861 im Übergewicht waren, so mussten wir doch noch manche Gräuel der Sklaverei mit ansehen. Das Leiden macht wunderbar weich, und unsere gute Mutter hatte selbst schon so viel durchgemacht, dass der Kummer anderer stets eine teilnehmende Saite in ihrem Herzen berührte. So wurde auch unser Haus ein Unterschlupf auf jenem geheimen Wege, den die Sklaven auf ihrer Flucht nach den Freistaaten nahmen. Mancher dieser armen Kerls fand bei uns Obdach, Kleidung und Nahrung, und viele erreichten durch der Mutter Hilfe den sicheren Hafen.
Ein alter Mann, Onkel Tom genannt, fasste bei dieser Gelegenheit eine solche Zuneigung zu unserer Familie, dass er uns nicht mehr verlassen wollte, und so behielten wir ihn als Gehilfen beim Betrieb des Gasthofs. Mehrere Monate wohnte er schon bei uns, und wir Kinder hatten ihn sehr liebgewonnen. Jeden Abend nach dem Essen saß er in der Küche am Feuer und erzählte einer atemlos lauschenden Zuhörerschaft die wunderbarsten Geschichten aus der Blütezeit der Sklaverei. Eines unvergesslichen Abends, als Onkel Tom, umgeben von seinen jugendlichen Zuhörern, an seinem gewohnten Platze saß, sprang er plötzlich mit einem dumpfen Schreckensruf in die Höhe. Einige Männer waren in die Wirtsstube getreten, und der Laut ihrer Stimmen trieb Onkel Tom in seine kleine Kammer und unter das Bett.
»Frau Cody«, sagte einer der unwillkommenen Gäste, »wir wissen, dass Sie davongelaufene Sklaven beherbergen, und sind gekommen, Ihre Besitzung zu durchsuchen. Wenn wir unser Eigentum finden, so können Sie uns nicht wehren, es an uns zu nehmen.«
So betrübt die Mutter auch für unseren armen Onkel Tom war, so wusste sie doch, dass eine Weigerung nichts nützen würde. Sie konnte nur hoffen, es sei dem alten Schwarzen gelungen, zu entfliehen.
Doch nein, Onkel Tom lag unter seinem Bett, wo ihn sein grober Herr gar bald fand. Es mag sein, dass es auch gute und menschenfreundliche Sklavenhalter gegeben hat, allein der bittere Fluch der Sklaverei lag eben darin, dass sie der Rohheit und Unmenschlichkeit Tür und Tor offen ließ, und niemals werde ich es vergessen, welche Barbarei der Eigentümer des guten Onkel Tom an den Tag legte. Das Haar des schon ganz alten Sklaven war schneeweiß, dennoch wurde ihm ein Strick um den Hals gelegt und er trotz unserer inständigen Bitten aus dem Hause gezerrt, wobei jeder Schrei, den er ausstieß, ihm nur einen heftigen Fußtritt eintrug. Nachdem er außer Sicht und sein Stöhnen außer Hörweite war, weinten wir bitterlich in der Mutter liebevollen Armen.
Onkel Tom aber entfloh ein zweites Mal und kehrte in unser Haus zurück, doch nur, um dort zu sterben. Wenn wir uns auch über den Tod des armen alten Mannes grämten, so dankten wir doch Gott, dass er der menschlichen Grausamkeit entrückt war.
Da Will seinem Vaterlande nicht als Soldat dienen durfte, so beschloss er, dies in anderer Weise zu tun. Er nahm Dienste bei einer von der Regierung ausgerüsteten Proviantkolonne, die Lebensmittel nach Fort Laramie zu schaffen hatte. Bei dieser Reise wurde ihm Gelegenheit geboten, durch seine als Grenzbewohner gesammelten Erfahrungen und durch seine Kunst als Schütze ein Menschenleben zu retten.
Reisen nach dem Westen waren zu jener Zeit durch Räuber und Indianer mit so vielen Gefahren verbunden, dass Auswanderer gewöhnlich danach trachteten, sich unter den Schutz irgendeines großen Frachtzuges zu stellen. Auch unter den Fittichen jener Proviantkolonne, bei der Will angestellt war, reisten mehrere Auswandererfamilien.
Als man eines Tages an den Ufern des Platte River die Lager aufgeschlagen hatte und die verschiedenen Teilnehmer des Zuges mit den Vorbereitungen für die Nacht und die am Morgen darauf erfolgende Weiterreise beschäftigt waren, wurde Mamie Perkins, ein kleines Mädchen einer Auswandererfamilie, zum Wasserholen an den Fluss geschickt. Wenige Augenblicke später sah man plötzlich einen riesigen Büffel aufs Lager zujagen. Das heftigste Geschrei und Gewehrfeuer vermochte ihn weder zurückzuhalten noch von seiner Bahn abzulenken. Gleich einem Wirbelsturm kam er herbeigejagt, setzte über Seile und Kisten, warf Wagen um und streute den Inhalt in alle Winde.
Mamie, die kleine Wasserträgerin, hatte inzwischen ihren Eimer gefüllt und war im Begriff, auf dem vom Büffel eingeschlagenen Weg zurückzukehren. Allzu erschrocken, um sich von der Stelle rühren zu können, beobachtete sie mit todesblassem Gesicht und offenem Munde, wie das wütende Tier laut aufstampfend und gesenkten Kopfes auf sie zu gerannt kam.
Will hatte geschlafen, war aber bei dem Lärm sofort aufgesprungen. Rasch griff er zur Flinte, lief dem kleinen Mädchen entgegen, zielte und feuerte auf den Büffel. Das riesige Tier neigte sich plötzlich auf die Seite, taumelte noch einige Yards vorwärts und brach dann etwa zwölf Fuß vor dem entsetzten Kinde zusammen.
Ein vielstimmiger Schrei der Erleichterung ertönte, und während den jugendlichen Büffeljäger eine Schar bewundernder Männer umgab, wurde Mamie zu ihrer Mutter gebracht. Will aber, der sein Lob nie gerne singen hörte, entwischte, sobald er sah, dass die Leute ihn als Helden feiern wollten, und versteckte sich in sein Zelt.
Nachdem das Fort Laramie erreicht war, begab sich Will vor allem auf die Suche nach Alf Slade, einem Direktor der Pony-Expresslinie, deren Hauptstation sich in dem zwanzig Meilen vom Fort entfernten Horseshoe befand. Trotzdem Will seine Bitte um Anstellung durch einen Empfehlungsbrief Russells unterstützte, machte Slade doch Einwendungen.
»Sie sind zu jung für einen Ponyreiter«, sagte er.
»Ich war schon voriges Jahr drei Monate als solcher angestellt und bin inzwischen viel stärker geworden«, antwortete Will.
»Sind Sie der junge Reiter, der zu Chrismans Abteilung gehörte?«
»Ja.«
»Gut, dann will ich’s mit Ihnen versuchen. Wenn Sie die Arbeit nicht aushalten, werde ich Ihnen einen leichteren Dienst übertragen.«
Wills Ritt ging von Red Buttes, am nördlichen Platte, bis Three Crossing am Sweetwater und betrug sechsundsiebzig Meilen.
Der Weg führte durch eine entsetzlich wilde Gegend; abenteuerlustige Leute konnten sich dort nicht über Mangel an aufregenden Erlebnissen beklagen. Als Will eines Tages an seiner letzten Station angelangt war, fand er den zur Fortsetzung der Reise bestimmten Reiter an einer tödlichen Verwundung, die ihm Indianer beigebracht hatten, daniederliegen. Da kein anderer Ersatzmann zur Stelle war, so übernahm es Will freiwillig, die fünfundachtzig Meilen für den Verwundeten zurückzulegen. Er führte sein Vorhaben nicht nur glücklich durch, sondern erreichte auch seine eigene Endstation ohne Verspätung – hatte somit einen Gesamtritt von dreihundertzweiundzwanzig Meilen bewältigt. Für den Reiter war keine Ruhepause möglich gewesen, dafür aber hatte er einundzwanzig Pferde auf diesem Eilritt – dem längsten, der je von einem Ponyreiter gemacht worden war – benutzt.
Kurze Zeit darauf traf Will mit dem sogenannten California Joe, einem in den Grenzstaaten berühmten Manne, zusammen. Er stand halb versteckt neben hohen, den Pfad begrenzenden Felsblöcken, als Wills Auge zum ersten Male seiner ansichtig wurde, und sofort griff der Ponyreiter nach seiner Flinte. Der Fremde jedoch hatte ebenso rasch seine Flinte fallen lassen und hob nun die Arme in die Höhe als Zeichen freundlicher Absichten. Will hielt sein Pferd an und ließ seinen Blick voll Interesse auf dem ganz in Leder gekleideten Mann ruhen.
California Joe, eine durch General Custers Buch Prärieleben bekannt gewordene Persönlichkeit, war ein Mann von wunderbarer Körperkraft, fest und stark wie eine Eiche. Sein rotbraunes Haar hing ihm in Locken auf die Schultern herab. Er trug einen Vollbart und seine blitzenden, durchdringenden Augen strahlten in hellem Glanze. Von einer Familie des Ostens abstammend, hatte er eine gute Schulbildung genossen, die jetzt durch Mangel an Übung etwas eingerostet war.
»Bist du der Bursche, von dem man mir erzählt hat – der jüngste Reiter der Expresslinie?«
Will gab eine bejahende Antwort und nannte seinen Namen.
»So, so«, fuhr Joe in seinem Präriedialekt fort, »du hast natürlich wieder Geld in deinem Beutel dort? Ich bin nämlich auf einem Streifzug nach dem Big Horn begriffen und fand zwei Kerls, die sicherlich dir auflauerten. Wir hatten einen kleinen Strauß miteinander, und ich konnte ihnen nicht helfen, sie mussten ins Gras beißen.«
Will dankte ihm aufs wärmste und bat ihn, sich doch nicht den Gefahren am Big Horn auszusetzen, worauf California Joe nur lachte und Will aufforderte, weiterzureiten.
Auf seiner Station angekommen, erzählte Will sein Abenteuer, worauf der Posthalter sagte: »Na, fahr wohl, California Joe, dich sieht man nicht wieder!«
Will aber hatte eine bessere Meinung von seinem neuen Freunde gefasst und prophezeite dessen glückliche Rückkehr.
Dieses Vertrauen wurde drei Monate später durch California Joes Erscheinen in dem am Overlandpfad befindlichen Lager gerechtfertigt. Man begrüßte ihn aufs herzlichste, und sämtliche Reiter versicherten ihm, dass sie nicht geglaubt hätten, ihn lebend wiederzusehen. Darauf erzählte er ihnen sein allerdings höchst interessantes Erlebnis.
»Vor einiger Zeit«, begann er, »begab sich ein großer Trupp Goldgräber in die Gegend des Big Horn-Tales. Da sie niemals wiederkehrten, sandte mich der General auf Kundschaft nach ihnen aus. Die Gegend wimmelte dort von Indianern, und ich musste scharf auf der Hut sein. An eine Belästigung durch Weiße dachte ich selbstverständlich nicht. Einmal ließ ich aus Versehen meine Pistole an dem Platze liegen, wo ich mein Mittagsmahl eingenommen hatte, und als ich den Verlust bemerkte, ging ich den gleichen Weg zurück. Eben war ich im Begriff, die Waffe aufzuheben, da bemerkte ich, dass ein Weißer heimlich meiner Spur folgte. Wohl ahnte mir nichts Gutes, allein ruhig bestieg ich wieder mein Pferd und ritt langsam weiter, als ob ich nichts gesehen hätte. Die nächste Nacht nun verfolgte ich den eingeschlagenen Weg so lange, bis ich ein Lager fand, zu dem der Fremde ohne Zweifel gehörte. Wie ich erwartet hatte, war er einer von den dreien, die dort die Nacht verbrachten, doch sah ich fünf Pferde angepfählt. Ich wette, was du willst, Freund Billy«, wandte er sich an Will, »dass die zwei dir auflauernden Schurken die im Lager fehlenden Männer waren. Sie dachten jedenfalls, ich hätte Gold gefunden, wollten mir nun bis zur Grube folgen, mich dann abtun und sich der Mine bemächtigen.
Es ist wahr, Gold gibt es dort die Menge, aber nicht nur das, sondern auch viel Silber, Eisen und Kupfer; doch niemand nimmt davon Notiz, solange man eben Gold haben kann. Von denen aber, die auf Gold ausgehen, muss gar mancher seinen Skalp zurücklassen.
Tag für Tag verfolgten wir dieselbe Fährte, wobei einer von den Männern mir nachging, der andere vorausschlich, mich dabei aber stets im Auge behielt und seinem Gefährten den Weg vorzeichnete. Als wir ins Herz des Indianergebietes kamen, musste ich alle nur denkbare Vorsicht beobachten; jeder kleinen Rauchsäule, die ein Dorf oder Lager bezeichnete, wich ich aus, auch erlegte ich nicht ein einziges Wild, um meine Munition zu sparen.
Endlich kam ich an eine Stelle, die deutliche Spuren eines Kampfes zeigte. Schädel und Knochen lagen umher, und schon nach einem kurzen Überblick bestand kein Zweifel mehr, dass Weiße an diesem Kampfe teilgenommen hatten. Mein Reisezweck war damit erfüllt, denn ich konnte nun mit voller Sicherheit berichten, dass die vermissten Weißen von Indianern aus dem Leben befördert worden waren.
Es fragte sich jetzt nur, ob ich zurückkehren konnte, ohne selbst den Indianern in die Hände zu fallen. Vor allem aber musste ein Mittel gefunden werden, meinen weißen Verfolgern auszukneifen.
Noch in derselben Nacht begab ich mich vorsichtig und zum Glück unbemerkt zum Bett eines Flüsschens hinab, folgte dessen Lauf, ritt am Lager meiner weißen Feinde vorbei und nahm den Indianerpfad erst etwa eine halbe Meile vom Lager entfernt wieder auf.
Es war das Beste, was ich hatte tun können. Denn noch war ich erst eine kurze Strecke weit geritten, als ich das wohlbekannte Siegesgeschrei der Rothäute vernahm und daraus schließen konnte, dass die Indianer meine unliebsamen Bekannten überfallen und skalpiert hatten. Dasselbe Schicksal hätte auch mich ereilt, wenn ich nicht einen anderen Weg eingeschlagen hätte.
Eines aber lasst euch sagen, Jungens«, schloss Joe seine Erzählung, »die Gegend dort ist großartig, reich an hohen Bergen, lieblichen Tälern und mächtigen Bäumen.«
Ungefähr um die Mitte September machten sich die Indianer in der Nähe des Sweetwater auf immer beunruhigendere Weise bemerkbar. Einmal wurde Will aus einem Hinterhalt überfallen, zum Glück aber ritt er eines der flüchtigsten Ponys der Gesellschaft und entkam, sich flach auf den Rücken seines Pferdes legend, glücklich den Rothäuten. Auf der Vorspannstation fand er den Posthalter ermordet, und da die Pferde gestohlen waren, musste er auf dem gleichen Tiere bis zu der zwölf Meilen entfernten Station Plontz reiten.
Einige Tage später rief der die verschiedenen Stationen der Linie inspizierende Beamte Will beim Umsteigen hastig zu: »Überall sind Spuren von Indianern, halten Sie Ihre Augen offen!«
»Ich bin auf der Hut«, antwortete Will, während er das Pferd wechselte und davonjagte.
Der Pfad führte durch eine schauerliche Wildnis. Berge mit schroff überhängenden Klippen und riesigen schwarzen Tannen umdüsterten ihn. Die Sinne des jugendlichen Reiters aber waren durch sein gefahrvolles Leben geschärft, und so prüfte er, während er den Weg in rasender Eile hinabjagte, mit geübtem Blick jeden dunklen Felsen und Baumstamm auf etwaige ihm auflauernde Feinde. Gerade vor Will, wenn auch weiter unten im Tale, lag ein großer Felsblock, auf dessen Spitze er eine Sekunde lang einen dunklen Punkt erscheinen sah.
Trotzdem behielt Will seine Richtung bei, bis er in Schussweite gelangt war, dann aber bog er scharf nach der anderen Seite hin ab. Der Anschlag der Feinde war misslungen. Hinter dem Felsblock stieg eine Rauchsäule auf, und zwei Indianer in prächtiger Kriegsrüstung und mit bemalten Gesichtern kamen zum Vorschein. Auf dieses Zeichen hin sprengte von der entgegengesetzten Seite des Tales eine Schar schreiender Rothäute aus dem Walde heraus.
Gelang es Will, den vor ihm liegenden schmalen Engpass vor den Indianern zu erreichen, so befand er sich in Sicherheit. Die hinter dem Felsblock hervorgekommenen Indianer hatte er nicht zu fürchten, da sie unberitten waren. Es handelte sich also nur darum, den aus dem Walde daherjagenden Rothäuten zu entkommen, deren Häuptling ein äußerst flüchtiges Pferd ritt. Immer mehr näherte sich dieser dem Engpass, und bald musste Will sich sagen, dass ein Entfliehen unmöglich sei. So stellte er sich zum Kampfe auf und zog seine Pistole hervor, während der Indianer den Bogen spannte.
Will war jedoch eine Idee flinker. Seine Pistole krachte, und der Indianer glitt getroffen aus dem Sattel. Sein Fall gab das Zeichen zu einem wahren Pfeilregen, von denen einer Wills Pferd verwundete. Trotzdem wurde die Station noch rechtzeitig erreicht.
Die Überfälle der Indianer nahmen jetzt einen immer bedrohlicheren Charakter an. Zwischen Splitt Rock und Three Crossing raubten sie eine Post- und Vorratsstation vollständig aus, töteten den Fuhrmann, sowie zwei Reisende und verwundeten Leutnant Flowers, den Kontrolleur dieser Abteilung. Sie bemächtigten sich der Pferde aus verschiedenen Vorspannstationen und belästigten unaufhörlich die Expressreiter und Fuhrleute. So frech wurden schließlich die Indianer, dass die Expressritte sechs Wochen lang eingestellt werden mussten. War eine besonders wichtige Botschaft oder Sendung zu befördern, so ließ man eine Postkutsche unter scharfer Bedeckung abgehen. Diese bestand aus vierzig Mann, aus Fuhrleuten, Expressreitern, Posthaltern und Rancheros, die unter dem Befehl des erfahrenen Präriekenners, des sogenannten Wilden Bill, mit dem Will seit Jahren befreundet war, standen.
Nicht Auflehnung gegen die Gesetze hatte jenem seinen Spitznamen eingetragen, sondern nur seine Verwegenheit und sein unerschütterlicher Mut. Dabei war er äußerlich ein fast vollkommen schöner Mensch: groß, stark und ebenmäßig gebaut, mit breiten Schultern und kraftvoll entwickelter Brust. Er hatte ein hübsches Gesicht mit klaren blauen Augen, einem energischen, schöngeschnittenen Munde und einer Adlernase, dazu braunes, lockiges Haar, das ihm bis auf die Schultern herabhing. Einer feinen, gebildeten Familie angehörend, schien er gleich Bill von einem Urahnen die Leidenschaft für das wilde Prärieleben geerbt zu haben.
Zu jener Zeit war der Wilde Bill bereits ein berühmter Kundschafter und leistete während des Krieges in dieser Eigenschaft den Vereinigten Staaten von Amerika große Dienste.
