Das Gespensterbuch – Siebente Geschichte – Teil 4
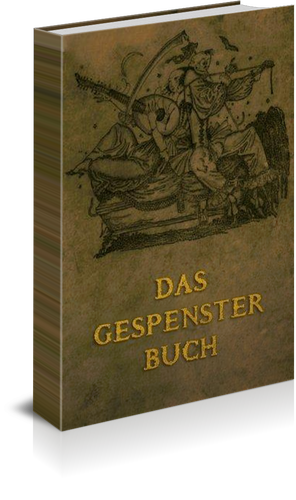 Das Gespensterbuch
Das Gespensterbuch
Herausgegeben von Felix Schloemp
Mit einem Vorwort von Gustav Meyrink
München 1913
Die Spinne
Von Hanns Heinz Ewers
4. Teil
Donnerstag, 17. März
Ich bin in einer merkwürdigen Aufregung. Ich spreche mit keinem Menschen mehr; selbst Frau Dubonnet und dem Hausknecht sage ich kaum mehr Guten Tag. Kaum lasse ich mir die Zeit, um zu essen. Ich mag nur noch am Fenster sitzen, mir ihr zu spielen. Es ist ein aufregendes Spiel, wirklich, das ist es.
Und ich habe ein Gefühl, als müsse morgen etwas vorfallen.
Freitag, 18. März
Ja, ja, es muss heute etwas passieren. Ich sage mir vor – ganz laut spreche ich zu mir, um meine Stimme zu hören – dass ich ja deshalb hier sei. Aber das Schlimme ist: Ich habe Angst. Und diese Angst, dass mir etwas Ähnliches zustoßen könne, wie meinen Vorgängern in diesem Raum, mischt sich seltsam in die andere Angst: die vor Clarimonde. Ich kann sie kaum auseinanderhalten.
Ich habe Furcht, schreien möchte ich.
6 Uhr abends
Rasch ein paar Worte, in Hut und Mantel.
Als es fünf Uhr war, war ich zu Ende mit meiner Kraft. Oh, ich weiß es jetzt gewiss, dass es irgendeine Bewandtnis haben muss mit dieser sechsten Stunde des vorletzten Wochentages – nun lache ich nicht mehr über den Schwindel, den ich dem Kommissar vormachte. Ich saß auf meinem Sessel, mit Gewalt hielt ich mich da fest. Aber es zog mich, riss mich fast zum Fenster. Ich musste spielen mit Clarimonde – und dann wieder diese grässliche Angst vor dem Fenster. Ich sah sie da hängen, den Schweizer Kommis, groß, mit dickem Hals und grauem Stoppelbart. Und den schlanken Artisten und den untersetzten kräftigen Sergeanten. Alle drei sah ich, einen nach dem anderen und dann zusammen alle drei, an demselben Haken, mit offenen Mündern und weit herausgestreckten Zungen. Und dann sah ich mich selbst, mitten unter ihnen.
O diese Angst! Ich fühlte wohl, dass ich sie ebenso sehr von dem Fensterkreuz hatte und dem grässlichen Haken da oben, wie vor Clarimonde. Sie mag mir verzeihen, aber es ist so: In meiner schmählichen Furcht mischte ich sie immer hinein in das Bild der drei, die da hingen, die Beine tief schleifend auf dem Boden.
Das ist wahr, ich fühlte keinen Augenblick in mir einen Wunsch, eine Sehnsucht, mich zu erhängen; ich halte auch keine Furcht davor, dass ich das tun möchte. Nein – ich hatte nur Angst vor dem Fenster selbst – und vor Clarimonde – vor etwas Schrecklichem, Ungewissen, das jetzt kommen musste. Ich halte den leidenschaftlichen, unbezwingbaren Wunsch, aufzustehen und doch ans Fenster zu gehen. Und ich musste es tun …
Da schellte das Telefon. Ich nahm die Muschel, und ehe ich noch ein Wort hören konnte, schrie ich selbst hinein: »Kommen! Sofort kommen!«
Es war, als ob der Schrei meiner gellenden Stimme im Augenblick alle Schatten in die letzten Ritzen des Fußbodens jagte. Ich war ruhig im Augenblick. Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn und trank ein Glas Wasser; dann überlegte ich, was ich dem Kommissar sagen solle, wenn er komme. Endlich ging ich ans Fenster, grüßte und lächelte.
Und Clarimonde grüßte und lächelte.
Fünf Minuten später war der Kommissar da. Ich erzählte ihm, dass ich endlich der Geschichte auf den Grund komme; heute möge er mich noch mit Fragen verschonen, aber ich würde ihm gewiss in Kurzem merkwürdige Enthüllungen geben können. Das Komische dabei war, dass, als ich ihm das vorlog, ich durchaus überzeugt war, dass ich die Wahrheit sage. Und dass ich es jetzt noch fast so fühle – entgegen meinem besseren Wissen.
Er bemerkte wohl meinen etwas sonderbaren Gemütszustand, besonders, als ich mich wegen meines ängstlichen Schreies ins Telefon zu entschuldigen und ihn möglichst natürlich zu erklären versuchte – und doch nicht recht einen Grund dafür fand. Er meinte sehr liebenswürdig, ich solle durchaus keine Rücksicht auf ihn nehmen; er stände mir immer zur Verfügung, das sei seine Pflicht. Lieber komme er ein Dutzend Mal vergebens, als dass er einmal auf sich warten lasse, wenn es nötig wäre. Dann lud er mich ein, heute Abend mit ihm auszugehen, das würde mich zerstreuen; es sei nicht gut, wenn ich immer so ganz allein sei. Ich habe angenommen – obwohl es mir schwerfiel; ich mag mich nicht gerne trennen von diesem Zimmer.
Samstag, 19. März
Wir waren in der Gaieté Rochechouart, in der Cigale und in der Lune Rousse. Der Kommissar hatte recht gehabt: Es war gut für mich, dass ich einmal hier herauskam, andere Luft atmete. Anfangs hatte ich ein recht unangenehmes Gefühl, so, als ob ich etwas Unrechtes tue, als ob ich ein Deserteur sei, der der Fahne den Rücken gekehrt habe. Dann aber legte sich das; wir tranken viel, lachten und schwatzten.
Als ich heute Morgen ans Fenster trat, glaubte ich in Clarimondes Blick einen Vorwurf zu lesen, vielleicht aber bilde ich mir das nur ein: Woher soll sie denn überhaupt wissen, dass ich gestern Nacht aus war? Übrigens dauerte das nur einen Augenblick, dann lächelte sie wieder.
Den ganzen Tag haben wir gespielt.
Sonntag, 20. März
Ich kann heute nur wieder schreiben: Den ganzen Tag haben wir gespielt.
Montag, 21. März
Den ganzen Tag haben wir gespielt.
Dienstag, 22. März
Ja, und das haben wir auch heute getan. Nichts, gar nichts anderes. Zuweilen frage ich mich, wozu eigentlich, warum? Oder: Was will ich eigentlich, wohin soll das führen? Aber ich gebe mir nie eine Antwort darauf. Denn es ist gewiss, dass ich nichts anderes wünsche als gerade das. Und das, was auch immer kommen mag, ist es, wonach ich mich sehne.
Wir haben miteinander gesprochen in diesen Tagen, freilich kein lautes Wort. Manchmal haben wir die Lippen bewegt, öfter nur uns angesehen. Aber wir haben uns sehr gut verstanden.
Ich hatte recht gehabt: Clarimonde machte mir Vorwürfe, weil ich weglief am letzten Freitag. Dann habe ich sie um Verzeihung gebeten und gesagt, dass ich es einsähe, dass es dumm von mir gewesen sei und hässlich. Sie hat mir verziehen und ich habe ihr versprochen, dass ich nie mehr weggehen wolle von diesem Fenster. Und wir haben uns geküsst, haben die Lippen lange an die Scheiben gedrückt.
Mittwoch, 23. März
Ich weiß jetzt, dass ich sie liebe. Es muss so sein, ich bin durchdrungen von ihr bis in die letzte Fiber. Mag sein, dass die Liebe anderer Menschen anders ist. Aber gibt es einen Kopf, ein Ohr nur, eine Hand, die irgendeiner anderen von tausend Millionen gleich wäre? Alle sind verschieden, so mag auch keine Liebe der anderen gleich sein. Absonderlich ist meine Liebe, das weiß ich wohl. Aber ist sie darum weniger schön? Beinahe bin ich glücklich in dieser Liebe.
Wenn nur nicht die Angst wäre! Manchmal schläft sie ein, dann vergesse ich sie. Aber nur auf Minuten, dann wacht sie wieder und lässt mich nicht los. Sie kommt mir vor, wie ein armseliges Mäuslein, das gegen eine große schöne Schlange kämpft, sich entwinden will ihrer starken Umarmungen. Warte nur, du dumme kleine Angst, bald wird diese große Liebe dich fressen.
Donnerstag, 24. März
Ich habe eine Entdeckung gemacht: Ich spiele nicht mit Clarimonde – sie spielt mit mir.
So kam es.
Gestern Abend dachte ich – wie immer – an unser Spiel. Da habe ich mir fünf neue verzwickte Folgen aufgeschrieben, mit denen ich sie am Morgen überraschen wollte, jede Bewegung trug eine Nummer. Ich übte sie mir ein, um sie möglichst schnell machen zu können, vorwärts und dann rückwärts. Dann nur die geraden Ziffern und dann nur die ungeraden, und alle ersten und letzten Bewegungen der fünf Folgen. Es war sehr mühselig, aber es machte mir viel Freude, brächte es mich doch Clarimonde näher, auch wenn ich sie nicht sah. Stundenlang übte ich so, aber endlich ging es wie am Schnürchen.
Heute Morgen nun trat ich ans Fenster, wir grüßten uns, dann begann das Spiel. Hinüber, herüber, es war unglaublich, wie schnell sie mich verstand, wie sie im selben Augenblicke fast alles tat, was ich machte.
Da klopfte es; es war der Hausknecht, der mir die Stiefel brachte. Ich nahm sie an; wie ich zum Fenster zurückging, fiel mein Blick auf das Blatt, auf dem ich meine Folgen notiert hatte. Und da sah ich, dass ich soeben nicht eine einzige all dieser Bewegungen ausgeführt hatte.
Ich taumelte beinahe, ich fasste die Lehne des Sessels und ließ mich hineinfallen. Ich glaubte es nicht, las das Blatt wieder und wieder. Aber es war so: Ich hatte soeben am Fenster eine Reihe von Folgen gespielt – und nicht eine von meinen.
Und ich hatte wieder das Gefühl: Eine Tür öffnet sich weit – ihre Türe. Ich stehe davor und starre hinein … nichts, nichts … nur dieses leere Dunkel. Dann wusste ich: Wenn ich jetzt hinausgehe, bin ich gerettet; und ich empfand wohl, ich konnte jetzt gehen. Trotzdem ging ich nicht. Das war, weil ich das bestimmte Gefühl hatte: Du hältst das Geheimnis. Fest in beiden Händen. Paris – du wirst Paris erobern!
Einen Augenblick war Paris stärker als Clarimonde.
Ach, nun denke ich kaum mehr daran. Nun fühle ich nur meine Liebe und in ihr diese stille, wollüstige Angst.
Aber in dem Augenblick gab es mir Kraft. Ich las mir noch einmal meine erste Folge durch und prägte mir jede Bewegung deutlich ein. Dann ging ich zurück ans Fenster.
Genau gab ich Acht auf das, was ich tat: Es war keine Bewegung darunter, die ich ausführen wollte.
Dann nahm ich mir vor, den Zeigefinger an der Nase zu reiben. Aber ich küsste die Scheibe. Ich wollte trommeln auf der Fensterbank, aber ich fuhr mit der Hand durch das Haar. Es war also gewiss, nicht Clarimonde machte das nach, was ich tat: Ich tat vielmehr das, was sie mir vormachte. Und tat es so schnell, so blitzartig, dass es fast zur selben Sekunde geschah, dass ich mir auch nun noch manchmal einbildete, von mir aus wäre die Willensäußerung ausgegangen.
Ich also, der so stolz darauf war, ihre Gedanken zu beeinflussen, ich bin es, der so ganz und gar beeinflusst wird. Nur – dieser Einfluss ist so leicht, so weich, o, es gibt nichts, das so wohltuend wäre.
Ich habe noch andere Versuche gemacht. Ich steckte beide Hände in die Taschen, nahm mir fest vor, sie nicht zu rühren; starrte zu ihr hinüber. Ich sah, wie sie ihre Hand hob, wie sie lächelte und mir leicht drohte mit dem Zeigefinger. Ich bewegte mich nicht. Ich fühlte, wie meine Rechte sich heben wollte aus der Tasche, aber ich krallte die Finger tief in das Futter. Dann langsam, nach Minuten lösten sich doch die Finger, die Hand kam heraus aus der Tasche und der Arm hob sich. Und ich drohte ihr mit dem Finger und lächelte. Es war, als ob gar nicht ich selbst das tue, sondern irgendein Fremder, den ich beobachtete. Nein, nein – so war es nicht. Ich, ich tat es wohl – und irgendein Fremder beobachtete mich. Eben der Fremde, der so stark war und die große Entdeckung machen wollte. Aber das war ich nicht …
Ich – was geht mich irgendeine Entdeckung an? Ich bin da, um zu tun, was sie will, Clarimonde, die ich liebe in köstlichster Angst.
Freitag, 25. März
Ich habe den Telefondraht zerschnitten. Ich habe keine Luft mehr, immer gestört zu werden von dem albernen Kommissar, gerade dann, wenn die seltsame Stunde anbricht …
Herrgott – warum schreibe ich das nur! Kein Wort ist wahr davon. Es ist, als ob mir jemand die Feder führe.
Aber ich will … will … will hier das hinschreiben, was ist. Es kostet mich eine ungeheure Überwindung. Aber ich will es tun. Nur einmal noch … das … was ich will.
Ich habe den Telefondraht zerschnitten … ah …
weil ich musste. Da steht es, endlich! Weil ich musste, musste.
Wir standen am Fenster heute Morgen und spielten. Unser Spiel ist anders geworden seit gestern. Sie macht irgendeine Bewegung und ich wehre mich, solange es geht. Bis ich endlich nachgeben muss, willenlos das zu tun, was sie will. Und ich kann gar nicht sagen, welch wundervolle Lust es ist, dieses Besiegtwerden, dieses Hingeben in ihren Willen.
Wir spielten. Und dann, plötzlich, stand sie auf, ging zurück in das Zimmer. So dunkel war es, dass ich sie nicht mehr sehen konnte; sie schien verschwunden im Dunkel. Aber gleich kam sie wieder, trug in beiden Händen ein Tischtelefon, ganz wie meines. Sie setzte es lächelnd nieder auf das Fensterbrett, nahm ein Messer, schnitt die Schnur durch und trug es wieder zurück.
Wohl eine Viertelstunde lang habe ich mich gewehrt. Meine Angst war größer als je zuvor, aber umso köstlicher war dies Gefühl des langsamen Unterliegens. Und endlich brachte ich meinen Apparat, schnitt die Schnur durch und stellte ihn zurück auf den Tisch.
So ist es geschehen.
Ich sitze an meinem Tisch; ich habe Tee getrunken, soeben hat der Hausknecht das Geschirr hinausgetragen. Ich habe ihn nach der Zeit gefragt, meine Uhr geht nicht recht. Fünf Uhr fünfzehn ist es, fünf Uhr fünfzehn …
Ich weiß, wenn ich nun aufsehe, wird Clarimonde irgendetwas tun. Sie wird irgendetwas tun, das ich auch tun muss.
Ich sehe doch auf. Sie steht da und lächelt. Nun – wenn ich doch den Blick wegwenden könnte! Nun geht sie zur Gardine. Sie nimmt die Schnur ab – rot ist sie, genauso wie die meines Fensters. Sie macht eine Schlinge. Sie hängt die Schnur oben an den Haken des Fensterkreuzes.
Sie setzt sich und lächelt.
Nein, das kann man nicht mehr Angst nennen, was ich empfinde. Es ist eine entsetzliche, beklemmende Furcht, die ich doch nicht eintauschen möchte um nichts in der Welt. Es ist ein Zwang so unerhörter Art, und doch so seltsam wollüstig in seiner unentrinnbaren Grausamkeit.
Ich könnte gleich hinlaufen und das tun, was sie will. Aber ich warte, kämpfe, wehre mich. Ich fühle, wie es immer stärker wird mit jeder Minute …
So, ich sitze wieder hier. Ich bin rasch hingelaufen und habe getan, was sie wollte: die Schnur genommen, die Schlinge gemacht und an den Haken gehängt …
Und nun will ich nicht mehr aufsehen, ich will nur hierhin auf das Papier starren. Denn ich weiß, was sie tun wird, wenn ich nun wieder sie ansehe … nun in der sechsten Stunde des vorletzten Wochentages. Sehe ich sie, so muss ich tun, was sie will, ich muss dann …
Ich will sie nicht ansehen …
Da lache ich – laut. Nein, ich lache nicht, irgendetwas lacht in mir. Ich weiß weshalb: über dieses »Ich will nicht …«
Ich will nicht und weiß doch ganz sicher, dass ich muss. Ich muss sie ansehen, muss, muss es tun … und dann … das Übrige.
Ich warte nur, um diese Qualen noch länger auszudehnen, ja das ist es. Diese atemlosen Leiden, die höchste Wollust sind. Ich schreibe, schnell, schnell, um noch länger hier zu sitzen, um diese Sekunden der Schmerzen auszudehnen, die meiner Liebe Lüste ins Unendliche steigern …
Noch mehr, noch länger …
Wieder die Angst, wieder! Ich weiß, ich werde sie ansehen, werde aufstehen, werde mich erhängen: Nicht davor fürchte ich mich. O nein – das ist schön, das ist köstlich.
Aber etwas, irgendetwas anderes ist noch da – was danach kommt. Ich weiß nicht, was es sein wird – aber es kommt, es kommt ganz sicher, ganz sicher. Denn das Glück meiner Qualen ist so ungeheuer groß – o, ich fühle, fühle, dass ihm ein Entsetzliches folgen muss.
Nur nicht denken …
Irgendetwas schreiben, irgendetwas, gleichgültig was. Nur schnell, nur nicht besinnen …
Meinen Namen – Richard Bracquemont, Richard Bracquemont, Richard …oh, ich kann nicht mehr weiter, Richard Bracquemont … Richard Bracquemont … jetzt … jetzt … ich muss sie ansehen … Richard Bracquemont … ich muss … nein, noch mehr … Richard … Richard Bracque…
*
Der Kommissar des IX. Reviers, der auf wiederholtes telefonisches Anläuten keine Antwort erhalten hatte, betrat nun sechs Uhr fünf Minuten das Hotel Stevens. Er fand im Zimmer Nr. 7 die Leiche des Studenten Richard Bracquemont am Fensterkreuz hängen, genau in derselben Lage wie seine drei Vorgänger.
Nur das Gesicht hatte einen anderen Ausdruck; es war in grässlicher Angst verzerrt, die Augen, weit geöffnet, drangen heraus aus den Höhlen. Die Lippen waren auseinandergezogen, die starken Zähne fest übereinander gebissen.
Und zwischen ihnen klebte, zerbissen und zerquetscht, eine große schwarze Spinne, mit merkwürdigen violetten Tupfen.
Auf dem Tisch lag das Tagebuch des Mediziners. Der Kommissar las es und begab sich sofort in das gegenüberliegende Haus. Er stellte dort fest, dass die zweite Etage seit Monaten leer stand und unbewohnt war …
