Das Gespensterbuch – Siebente Geschichte – Teil 3
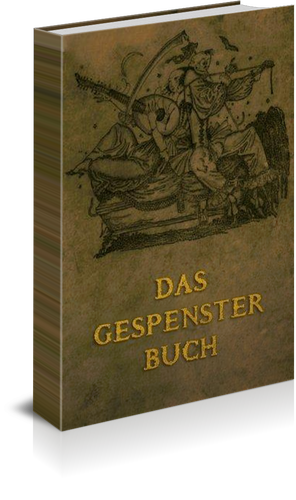 Das Gespensterbuch
Das Gespensterbuch
Herausgegeben von Felix Schloemp
Mit einem Vorwort von Gustav Meyrink
München 1913
Die Spinne
Von Hanns Heinz Ewers
3. Teil
Montag, 7. März
Ich bin nun überzeugt, dass ich nichts entdecken werde und neige der Ansicht zu, dass es sich bei den Selbstmorden meiner Vorgänger nur um einen seltsamen Zufall gehandelt hat. Ich habe den Kommissar gebeten, nochmals in allen drei Fällen eingehende Nachforschungen veranlassen zu wollen, ich bin überzeugt, dass man schließlich doch die Gründe finden wird. Was mich betrifft, so werde ich so lange wie möglich hierbleiben. Paris werde ich hier nicht erobern, aber ich lebe umsonst hier und mäste mich ordentlich an. Dazu studiere ich tüchtig, ich merke ordentlich, wie ich in Schuss komme. Und endlich habe ich noch einen Grund, der mich hier hält.
Mittwoch, 9. März
Also ich bin einen Schritt weitergekommen. Clarimonde – Ach so, ich habe von Clarimonde noch nichts erzählt. Also sie ist mein dritter Grund, hier zu bleiben, und sie ist es auch, wegen der ich in jener verhängnisvollen Stunde gerne zum Fenster gegangen wäre – aber gewiss nicht, um mich aufzuhängen. Clarimonde – warum nenne ich sie nur so? Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, aber es ist mir, als müsse ich sie Clarimonde nennen. Und ich möchte wetten, dass sie sich wirklich so nennt, wenn ich sie einmal nach ihrem Namen frage.
Ich habe Clarimonde gleich in den ersten Tagen bemerkt. Sie wohnt auf der anderen Seite der sehr schmalen Straße und ihr Fenster liegt dem meinen gerade gegenüber. Da sitzt sie hinter den Vorhängen. Übrigens muss ich feststellen, dass sie mich früher beobachtete, wie ich sie, und sichtlich ein Interesse für mich bewies. Kein Wunder, die ganze Straße weiß ja, dass ich hier wohne und weshalb, dafür hat Frau Dubonnet schon gesorgt.
Ich bin keine sehr verliebte Natur und meine Beziehungen zur Frau sind immer sehr kärglich gewesen, wenn man aus Verdun nach Paris kommt, um Medizin zu studieren und dabei kaum so viel Geld hat, um sich alle drei Tage einmal satt zu essen, dann hat man an etwas anderes zu denken, als an die Liebe. Ich habe also nicht viel Erfahrungen und vielleicht habe ich diese Sache ziemlich dumm angefangen. Immerhin, mir gefällt sie, so wie sie ist.
Im Anfang ist mir gar nicht der Gedanke gekommen, mein Gegenüber in irgendwelche Beziehungen zu mir zu bringen. Ich habe mir nur gedacht, da ich nun doch einmal hier sei, um zu beobachten, und sonst mit dem besten Willen nichts zu erforschen habe, so könne ich gerade so gut mein Gegenüber beobachten. Den ganzen Tag lang kann man doch nicht über den Büchern sitzen. Ich habe also festgestellt, dass Clarimonde die kleine Etage allein bewohnt. Sie hat drei Fenster, aber sie sitzt nur an dem Fenster, das dem meinen gegenüber liegt; sie sitzt da und spinnt, an einem kleinen altmodischen Rocken. Ich habe so einen Spinnrocken einmal bei meiner Großmutter gesehen; aber die hatte ihn auch nie gebraucht, ihn nur geerbt von irgendeiner Urtante: Ich wusste gar nicht, dass man heute noch damit arbeitet. Übrigens ist der Spinnrocken von Clarimonde ein ganz kleines, feines Ding, weiß und scheinbar aus Elfenbein; es müssen ungeheuer zarte Fäden fein, die sie macht. Sie sitzt den ganzen Tag hinter den Vorhängen und arbeitet unaufhörlich, erst wenn es dunkel wird, hört sie auf. Freilich wird es sehr früh dunkel in diesen Nebeltagen in der engen Straße, um fünf Uhr schon haben wir die schönste Dämmerung. Licht habe ich nie gesehen in ihrem Zimmer.
Wie sie aussieht – Ja, das weiß ich nicht recht. Sie trägt die schwarzen Haare in Wellenlocken und ist ziemlich bleich. Die Nase ist schmal und klein und die Flügel bewegen sich. Auch ihre Lippen sind bleich, und es scheint mir, als ob die kleinen Zähne zugespitzt wären wie bei Raubtieren. Die Lider schatten tief, aber wenn sie sie aufschlägt, leuchten ihre großen, dunklen Augen. Doch fühle ich das alles viel mehr, als ich es wirklich weiß. Es ist schwer, etwas genau zu erkennen hinter den Vorhängen.
Noch etwas: Sie trägt stets ein schwarzes geschlossenes Kleid; große lila Tupfen sind darauf. Und immer hat sie lange schwarze Handschuhe an, wohl um die Hände nicht bei der Arbeit zu verderben. Es sieht seltsam aus, wie die schmalen schwarzen Finger, schnell, scheinbar durcheinander, die Fäden nehmen und ziehen – wirklich, beinahe wie ein Gekrabbele von Insektenbeinen.
Unsere Beziehungen zueinander? Nun, eigentlich sind sie recht oberflächlich, und doch kommt es mir vor, als ob sie viel tiefer wären. Es fing wohl so an, dass sie zu meinem Fenster hinübersah – und ich zu dem ihren. Sie beobachtete mich – und ich sie. Und dann muss ich ihr wohl ganz gut gefallen haben, denn eines Tages, als ich sie wieder so anschaute, lächelte sie, ich natürlich auch. Das ging so ein paar Tage lang, immer öfter und öfter lächelten wir uns zu. Dann habe ich mir fast stündlich vorgenommen, sie zu grüßen; ich weiß nicht recht, was mich immer wieder davon abhielt.
Endlich habe ich es doch getan, heute Nachmittag. Und Clarimonde hat wieder gegrüßt. Nur leise, aber ich habe es wohl gesehen, wie sie genickt hat.
Donnerstag, 10. März
Gestern bin ich lange aufgesessen über den Büchern. Ich kann nicht gerade sagen, dass ich viel studiert habe: Ich habe Luftschlösser gebaut und von Clarimonde geträumt. Ich habe unruhig geschlafen, bis tief in den Morgen hinein.
Als ich ans Fenster trat, saß Clarimonde da. Ich grüßte und sie nickte wieder. Sie lächelte und sah mich lange an.
Ich wollte arbeiten, aber ich fand die Ruhe nicht. Ich setzte mich ans Fenster und starrte sie an. Da sah ich, wie auch sie die Hände in den Schoß legte. Ich zog an der Schnur die weiße Gardine zurück und – im selben Augenblicke fast – tat sie das gleiche, wir lächelten beide und sahen uns an.
Ich glaube, wir haben wohl eine Stunde so gesessen. Dann spann sie wieder.
Samstag, 12. März
Diese Tage gehen so hin. Ich esse und trinke, ich setze mich an den Arbeitstisch. Ich zünde dann meine Pfeife an und beuge mich über ein Buch. Aber ich lese keine Silbe. Ich versuche immer wieder, aber ich weiß zuvor, dass es gar nichts fruchten wird. Dann gehe ich ans Fenster. Ich grüße, Clarimonde dankt, wir lächeln und starren uns an, stundenlang …
Gestern Nachmittag um die sechste Stunde war ich ein wenig unruhig. Die Dämmerung brach sehr früh herein und ich fühlte eine gewisse Angst. Ich saß an meinem Schreibtisch und wartete. Ich fühlte einen fast unbezwinglichen Drang zum Fenster – nicht um mich aufzuhängen, sondern um Clarimonde anzusehen. Ich sprang auf und stellte mich hinter die Gardine. Nie, scheint es mir, habe ich sie so deutlich gesehen, trotzdem es schon recht dunkel war. Sie spann, aber ihre Augen schauten zu mir herüber. Ich fühlte ein seltsames Wohlbehagen und eine ganz leise Angst.
Das Telefon klingelte. Ich war wütend auf den albernen Kommissar, der mich mit seinen dummen Fragen aus meinen Träumen riss.
Heute Morgen besuchte er mich, zusammen mit Frau Dubonnet. Sie ist zufrieden genug mit meiner Tätigkeit, es genügt ihr vollständig, dass ich nun schon zwei Wochen lang lebe, im Zimmer Nr. 7. Der Kommissar aber will außerdem noch Resultate. Ich habe geheimnisvolle Andeutungen gemacht, dass ich einer höchst seltsamen Sache auf der Spur sei; der Esel hat mir alles geglaubt. Auf jeden Fall kann ich noch wochenlang hierbleiben – und das ist mein einziger Wunsch. Nicht wegen Frau Dubonnets Küche und Keller – Herrgott, wie rasch wird einem das gleichgültig, wenn man immer satt ist – nur wegen ihres Fensters, das sie hasst und fürchtet, und das ich so liebe, dieses Fenster, das mir Clarimonde zeigt.
Wenn ich die Lampe angezündet habe, sehe ich sie nicht mehr. Ich habe mir die Augen ausgeguckt, um zu sehen, ob sie ausgeht, aber ich habe sie nie einen Schritt auf die Straße setzen sehen. Ich habe einen großen bequemen Lehnstuhl und einen grünen Schirm über der Lampe, dessen Schein mich warm einhüllt. Der Kommissar hat mir ein großes Paket Tabak gebracht, ich habe nie so guten geraucht und trotzdem kann ich nicht arbeiten. Ich lese zwei, drei Seiten, und wenn ich zu Ende bin, weiß ich, dass ich nicht ein Wort verstanden habe. Nur das Auge nimmt die Buchstaben auf, mein Hirn lehnt aber jeden Begriff ab. Komisch! Als ob es ein Schild trage: Eingang verboten. Als ob es keinen anderen Gedanken mehr zulasse als den einen: Clarimonde …
Endlich schiebe ich die Bücher weg, lehne mich tief zurück in meinen Sessel und träume.
Sonntag, 13. März
Heute Morgen habe ich ein kleines Schauspiel gesehen. Ich ging im Korridor auf und ab, während der Hausknecht mein Zimmer in Ordnung brachte, vor dem kleinen Hoffenster hängt eine Spinnwebe, eine dicke Kreuzspinne sitzt darin. Frau Dubonnet lässt sie nicht wegfangen: Spinnen bringen Glück, und sie halte gerade genug Unglück in ihrem Haus. Da sah ich, wie eine andere, viel kleinere Spinne, vorsichtig um das Netz herumlief, ein Männchen. Behutsam ging es ein wenig auf dem schwanken Faden der Mitte zu, aber so wie das Weibchen sich nur rührte, zog es sich schleunigst zurück. Lief an ein anderes Ende und versuchte von Neuem, sich zu nähern. Endlich schien das starke Weibchen in der Mitte seinen Werbungen Gehör zu schenken, es rührte sich nicht mehr. Das Männchen zupfte erst leise, dann stärker an einem Faden, sodass das ganze Netz zitterte; aber seine Angebetete blieb ruhig. Da kam es schnell, aber unendlich vorsichtig näher heran. Das Weibchen empfing es still und ließ sich ruhig, ganz hingebend, seine zärtliche Umarmung gefallen; unbeweglich hingen sie beide minutenlang mitten in dem großen Netz.
Dann sah ich, wie das Männchen langsam sich löste, ein Bein ums andere; es war, als wolle es sich still zurückziehen und die Gefährtin allein lassen in dem Liebestraum. Plötzlich ließ es los, und lief, so schnell es nur konnte, hinaus aus dem Netz. Aber in demselben Augenblick kam ein wildes Leben in das Weibchen, rasch jagte es nach. Das schwache Männchen ließ sich an einem Faden herab, gleich machte die Geliebte das Kunststück nach. Beide fielen auf das Fensterbrett. Mit dem Aufgebot all seiner Kräfte versuchte das Männchen zu entkommen. Zu spät, schon fasste es mit starkem Griff die Gefährtin und trug es wieder hinauf in das Netz, gerade in die Mitte. Und dieser selbe Platz, der eben als Bett gedient hatte für wollüstige Begierde, sah nun ein anderes Bild. Vergeblich zappelte der Liebhaber, streckte immer wieder die schwachen Beinchen aus, versuchte sich zu entwinden aus dieser wilden Umarmung: Die Geliebte gab ihn nicht mehr frei. In wenigen Minuten spann sie ihn ein, dass er kein Glied mehr rühren konnte. Dann schlug sie die scharfen Zangen in seinen Leib und sog in vollen Zügen das junge Blut des Geliebten. Ich sah noch, wie sie endlich das jämmerliche, unkenntliche Klümpchen – Beinchen, Haut und Fäden – loslöste und verächtlich hinauswarf aus dem Netz.
So also ist die Liebe bei diesen Tieren – nun, ich bin froh, dass ich kein Spinnenjüngling bin.
Montag, 14. März
Ich werfe keinen Blick mehr in meine Bücher. Nur am Fenster verbringe ich meine Tage. Und wenn es dunkel ist, bleibe ich auch sitzen. Sie ist nicht mehr da, aber ich schließe die Augen und sehe sie doch …
Hm, dies Tagebuch ist wirklich ganz anders geworden, als ich es mir vorstellte. Es erzählt von Frau Dubonnet und dem Kommissar, von Spinnen und von Clarimonde. Aber nicht eine Silbe über die Entdeckung, die ich machen wollte. Kann ich etwas dafür?
Dienstag, 15. März
Wir haben ein seltsames Spiel gefunden, Clarimonde und ich; wir spielen es den ganzen Tag lang. Ich grüße sie, sogleich grüßt sie zurück. Dann trommle ich mit der Hand gegen die Scheiben, sie sieht es kaum und schon beginnt sie auch zu trommeln. Ich winke ihr zu, sie winkt wieder; ich bewege die Lippen, als ob ich zu ihr spreche und sie tut dasselbe. Dann streiche ich von der Schläfe mein Haar zurück und schon ist auch ihre Hand an der Stirn. Ein richtiges Kinderspiel, und wir lachen beide darüber. Das heißt – eigentlich lacht sie nicht, es ist ein Lächeln, still, hingeben – genau so glaube ich selbst zu lächeln.
Übrigens ist alles nicht so dumm, wie es den Anschein hat. Es ist nicht nur ein reines Nachmachen, ich glaube, das würden wir beide bald leid werden; es muss wohl eine gewisse Gedankenübertragung dabei eine Rolle spielen. Denn Clarimonde folgt meinen Bewegungen in dem kleinsten Bruchteil einer Sekunde, sie hat kaum Zeit, sie zu sehen und führt sie schon selbst aus. Manchmal scheint es mir, als ob es gleichzeitig wäre. Das ist es, was mich reizt, immer etwas ganz Neues, Unvorgesehenes zu machen, es ist verblüffend, wie sie zugleich dasselbe tut. Manchmal versuche ich, sie aufs Glatteis zu führen. Ich mache eine Menge von verschiedenen Bewegungen schnell hintereinander; dann dieselben noch einmal und wieder. Schließlich mache ich zum vierten Mal dieselbe Reihe, aber wechsle die Folge der Bewegungen oder ich mache eine anders oder lasse eine aus. So wie Kinder, die Alle Vögel fliegen spielen. Es ist merkwürdig, dass Clarimonde auch nicht ein einziges Mal eine falsche Bewegung macht, obwohl ich so schnell wechsle, dass sie kaum Zeit hat, jede einzelne zu erkennen.
Damit verbringe ich meinen Tag. Aber ich habe keine Sekunde das Gefühl, dass ich unnütz die Zeit totschlage; es ist mir im Gegenteil so, als ob ich nie etwas Wichtigeres getrieben habe.
Mittwoch, 16. März
Ist es nicht komisch, dass mir nie ernsthaft der Gedanke kommt, meine Beziehungen zu Clarimonde auf eine etwas vernünftigere Basis zu stellen als diese stundenlangen Spielereien? Letzte Nacht dachte ich darüber nach. Ich kann doch einfach Hut und Mantel nehmen und hinuntergehen, zwei Treppen. Fünf Schritte über die Straße, dann wieder zwei Treppen. An der Tür ist ein kleines Schild, darauf steht Clarimonde. Clarimonde – was? Ich weiß nicht: Was! Aber Clarimonde steht da. Dann klopfe ich und dann …
So weit kann ich mir alles genau vorstellen, jede kleinste Bewegung, die ich mache, sehe ich vor mir. Aber ich kann mir durchaus kein Bild machen, was dann weiter kommen soll. Die Türe öffnet sich, das sehe ich noch. Aber ich bleibe davor stehen und blicke hinein in ein Dunkel, das nichts, aber auch gar nichts erkennen lässt. Sie kommt nicht – nichts kommt; es ist überhaupt gar nichts da. Nur dieses schwarze undurchdringliche Dunkel.
Mir ist manchmal, als ob es eine andere Clarimonde gar nicht gäbe, als die ich dort am Fenster sehe und die mit mir spielt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie diese Frau aussehen würde im Hut oder einem anderen Kleid als ihrem schwarzen, mit den großen lila Tupfen; nicht einmal ohne ihre Handschuhe kann ich sie mir denken, wenn ich sie auf der Straße sehen sollte, oder gar in einem Restaurant, essend, trinkend, plaudernd … ich muss ordentlich lachen, so unmöglich erscheint mir das Bild.
Manchmal frage ich mich, ob ich sie liebe. Ich kann das nicht recht beantworten, da ich ja noch nie geliebt habe. Ist aber das Gefühl, das ich zu Clarimonde habe, wirklich Liebe, so ist sie jedenfalls ganz, ganz anders, als ich sie bei meinen Kameraden gesehen oder aus Romanen kennengelernt habe.
Es wird mir sehr schwer, meine Empfindungen festzustellen. Es wird mir schwer, an etwas zu denken, das sich nicht auf Clarimonde bezieht, oder vielmehr auf unser Spiel. Denn es lässt sich nicht leugnen, es ist eigentlich dieses Spiel, das mich immer beschäftigt, nichts anderes. Und das ist es, was ich am wenigsten begreife.
Clarimonde – ja, ich fühle mich zu ihr hingezogen. Aber da hinein mischt sich ein anderes Gefühl, so, als ob ich mich fürchte. Fürchte? Nein, das ist es auch nicht, es ist eher eine Scheu, eine leise Angst vor irgendetwas, das ich nicht weiß. Und gerade diese Angst ist es, die etwas seltsam Bezwingendes, merkwürdig wollüstiges hat, die mich von ihr abhält und doch näher zu ihr hinzieht. Mir ist, als liefe ich in großem Kreis weit um sie herum, käme hier ein wenig näher, zöge mich wieder zurück, liefe weiter, ginge an einer anderen Stelle vor und dann schnell wieder zurück. Bis ich endlich – und das weiß ich ganz gewiss – doch einmal hin muss zu ihr.
Clarimonde sitzt am Fenster und spinnt. Fäden, lange, dünne, unendlich feine Fäden. Sie macht ein Gewebe daraus, ich weiß nicht, was es werden soll. Und ich kann nicht begreifen, wie sie dieses Netz machen kann, ohne immer wieder die zarten Fäden zu verwirren und zu zerreißen. Es sind wunderliche Muster in ihrer feinen Arbeit, Fabeltiere und merkwürdige Fratzen.
Übrigens – was schreibe ich da! Richtig ist, dass ich gar nicht sehen kann, was sie eigentlich spinnt; viel zu fein sind die Fäden. Und doch fühle ich, dass ihre Arbeit genau so ist, wie ich sie sehe, wenn ich die Augen schließe. Genauso. Ein großes Netz und viele Geschöpfe darin, Fabeltiere und merkwürdige Fratzen …
