Nach Amerika! – Zweiter Band – 03 – Teil 3
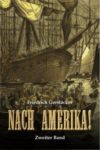 Friedrich Gerstäcker
Friedrich Gerstäcker
Nach Amerika!
Zweiter Band
Leipzig, Berlin, 1855
Das Schiff
Teil 3
Sobald sich also die Passagiere, in Kajüte wie Zwischendeck, nur erst halbwegs eingerichtet hatten, und nun erfuhren, dass sie heute noch gar nicht, sondern erst morgen früh in See gehen würden, verlangte ein großer Teil derselben, mit dem heimischen Boden dicht neben sich, auch noch einmal festes Land vor dem Abschied vom Vaterland zu betreten. Die meisten, besonders der Zwischendeckspassagiere, hatten dabei auch noch so manches einzukaufen vergessen, was ihnen auf der Reise gute Dienste leisten konnte und hier, wie sie hörten, zu bekommen war, dass sie sich in Masse übersetzen ließen, noch eine Menge Geld, oft höchst unnötigerweise zu verschwenden. Die noch deutsches Geld hatten, meinten dies hier zweckmäßig verwenden zu können, und solche, die das schon in Bremen möglich gemacht hatten, wechselten sich erst einen und dann mehrere Dollar wieder ein, den allerletzten Tag in der Heimat würdig zu feiern. Nur die Frauen wollten nicht mehr von Bord, sie hatten mit dem alten Leben abgeschlossen, den Schmerz der Trennung einmal überwunden, und sie verlangten keine Zerstreuung, ja fürchteten sie eher. Für sie begann auch hier an Bord wieder eine neue Welt, in der sie schaffen und wirken mussten, fast wie zu Hause – die Kajütspassagiere natürlich ausgenommen, denen geliefert wurde, was sie brauchten – hatten die Frauen im Zwischendeck, sich wieder eine gewisse Häuslichkeit herzurichten, um die sich die Männer wenig oder gar nicht kümmerten. Ihre Betten mussten gelüftet und in Ordnung gebracht, ihr Geschirr musste gereinigt, die Wäsche, die sie für den Schiffsgebrauch benötigten, nachgesehen werden. Die Sachen mussten auch einen Platz bekommen, und der Mann hätte ebenso gut an Bord bleiben und ihnen kleine Nägel in die Kojen schlagen können, alles daran aufzuhängen, was sie zum täglichen Bedarf gebrauchten, und tausend andere Kleinigkeiten herzurichten.
Und wie sah es noch unten im Zwischendeck aus – überall standen Kisten und Kästen umher, um die sich ihre nachlässigen Eigentümer nicht bekümmert hatten. An Auskehren war natürlich gar kein Gedanke, einige kleine Plätze abgerechnet, und selbst heißes Wasser, das bei dem späten Mittag gebrauchte Geschirr abzuwaschen, wollte der mürrische Koch nicht hergeben.
So kam der Abend heran, der die Kajütspassagiere um den gedeckten Tisch versammelte und den Zwischendeckspassagieren dünnen Tee, ohne Zucker und Milch brachte – Brot und Butter war ihnen am Nachmittag schon gut und reichlich geliefert worden. Die wenigsten machten aber Gebrauch davon; die Männer waren fast noch sämtlich an Land, viele schliefen sogar noch dort und zahlten schweres Geld für ein schlechtes Bett, dem Gewirr an Bord, und dem ungewohnten Dunst des Zwischendecks so lange als irgend möglich zu entgehen, und die Frauen hatten, mit wenigen Ausnahmen, noch nie in ihrem Leben Tee getrunken, außer wenn sie krank waren Kamille oder Pfefferminze, aber wohl viel davon gehört, dass es die Leute in der Stadt oder die Reichen tränken, und wunderten sich nun kopfschüttelnd, wie die Leute Geschmack daran finden konnten. Schiffstee ohne Milch und Zucker, aus einem Blechbecher getrunken, schmeckt auch in der Tat nicht besonders.
Das Wetter hatte sich wieder aufgeklärt, auch war die Fracht sämtlich verstaut und die untere Luke geschlossen worden, das Schiff lag mit geräumtem Deck vor Anker, und als am nächsten Morgen, mit Tagesanbruch, die Decks gewaschen wurden, begann ein reges Leben an Bord, das auf die baldige, und in der Tat auf den Morgen angesetzte Abfahrt schließen ließ. Der Weserlotse, der das Schiff in See bringen sollte, kam an Bord, einzelne, bisher noch fehlende Segel wurden aufgeholt und an die Rahen geschlagen und gleich nach dem Frühstück begann die Mannschaft ihre Arbeit an der Ankerwinde. Die Passagiere waren ebenfalls an Bord gerufen worden, aber immer noch fehlte der Kapitän wie die letzten Kajütspassagiere, die aber mit dem nächsten Dampfboot erwartet wurden. Dieses kam endlich puffend den Strom herunter, legte sich längsseits, und die sehnsüchtig Erwarteten, das endliche Signal zur Abfahrt, kamen mit ihm.
Der Kapitän, eine vierschrötige echt seemännische Gestalt, mit fast braunem Gesicht, entsetzlich großen, sehnigen sonngebräunten Händen und einem großen Paket Papiere unter dem Arm, sah freilich etwas wunderlich in seinen Landkleidern, dem schwarzen, auch nicht mehr modernen Frack und dem Zylinderhut (Schwalbenschwanz oder Nagelhammerrock und Schraube, wie die Matrosen diese Kleidungsstücke nennen) aus, schien sich auch nicht besonders wohl darin zu fühlen. Er grüßte seine Passagiere nur flüchtig und zog sich dann in die eigene Kajüte zurück, in die hinein ihm gleich der Steward oder Kajütendiener folgen musste. Der Zweite Steuermann aber, ein trockener komischer Kauz, der gerade vor der Tür stand, als es drinnen ein wenig laut herging und des Kapitäns Stimme den Jungen schimpfte, meinte ruhig zum Steuermann, als er an diesem vorüber und an Deck ging: ,,De Kaptein kann wedder syn Swalbenswanz nich uht freegen – wat de Jong vor Arbeit het.«
Mit dem Dampfboot waren auch Henkels mit Hedwig Loßenwerder in ihrer Begleitung eingetroffen, und Lobensteins, die sich schon ziemlich häuslich an Bord eingerichtet hatten und mit der ganzen Einrichtung ziemlich zufrieden schienen, begrüßten sie, wie Hedwig, auf das Herzlichste. Während sich Clara aber, mit dem Bewusstsein ihre Eltern ja schon in kurzen Monaten wiederzusehen, dem Fremden und Neuen, was sie überall berührte, mit ganzer Seele und leuchtenden Blicken hingab und sich wie ein fröhliches glückliches Kind selbst auf die Reise und all die kleinen Unbequemlichkeiten freute, die in so grellem Gegensatz zu dem bisher geführten ruhigen, aber auch vollkommen gleichförmigen Leben standen, betrat Hedwig nur schüchtern und ängstlich das Deck des Schiffes und blickte wie scheu und furchtsam umher, auf die ihr so gänzlich fremde Umgebung, auf die fremden Menschen. Sie hatte sich leicht entschlossen, das Vaterland zu verlassen, das ihr in der Erinnerung ja nur traurige, schmerzliche Szenen bot, und sogar mit innigem Dank das Erbieten angenommen, die liebe junge Frau auf ihrer Reise zu begleiten. Nun aber, da sie den Schritt getan hatte, da sie wirklich in das neue Leben eintrat, fühlte sie erst das Gewaltige desselben, fühlte erst, wie abhängig sie geworden sei von anderen fremden Menschen und fürchtete für sich selbst, ob sie auch würde dem allem genügen können, was sie unternommen würde, und was man von ihr zu erwarten berechtigt sei. Ihre eigenen Kräfte kannte sie noch gar nicht, und wie dann, wenn sie diese überschätzt hatte, und die, die nun freundlich zu ihr waren, ihre Hand in Amerika zurückzogen von ihr – drüben weit drüben über dem Meer? Dann stand sie allein, und was – was sollte da aus ihr werden?
»Du darfst nicht solch ein böses und ernsthaftes Gesicht machen, Hedwig«, sagte da Marie Lobenstein, ihre Hand nehmend und ihr lächelnd mit der eigenen über die Stirn streichend. »Jetzt fahren wir bald hinaus aufs Meer, nach dem weiten, großen Amerika, und wenn wir da traurig und verdrießlich ankommen, schicken uns die Leute am Ende wieder fort.«
»Sie sind so gut, Fräulein Marie«, sagte Hedwig leise, die ihr gebotene Hand innig drückend, »ich will auch mein Möglichstes tun, jede törichte Furcht zu überwinden.« »Fürchtest du dich?«, erwiderte aber das leichtherzige fröhliche Mädchen lachend. »Vor dem Wasser? Das kann ja gar nicht zu uns herauf, siehst du, wie hoch wir darüber stehen?«
»Ich weiß selbst nicht, wovor«, seufzte das arme Kind, »es ist wohl auch nur die neue fremde Welt, in die ich jetzt trete, und die mir das Herz beklemmt; das wird schon bald vorübergehen.«
»Es muss«, meinte Marie fröhlich, »wenn wir nur erst in See sind, werden wir uns auch vortrefflich amüsieren; wir haben Bücher zum Lesen mit und können stricken und nähen und sticken auf dem Schiff, was wir wollen; und dann lehnen wir Stunden lang der Reling und schauen in die herrliche blaue See, von der uns Herr Henkel schon so viel erzählt hat.«
So plauderte das fröhliche Mädchen dem armen Kind die Sorgen aus der Stirn, bis der Steuermann kam, sie abzuholen und ihr den eigenen Schlafplatz zu zeigen, der ihr im Zwischendeck bei zwei anderen jungen Mädchen und weitläufigen Verwandten der Familie Rechheimer angewiesen wurde. Sie sollte im Zwischendeck essen und schlafen, hatte aber die Erlaubnis über Tag, oder wenn sie sonst von ihrer jungen Herrin gebraucht wurde, mit in der Kajüte und auf dem Quarterdeck zu sein. Der Kapitän hatte aber doch endlich seinen Schwalbenschwanz über die Hände bekommen, wie der zweite Steuermann meinte, und kam nun, in blauer Tuchhose und Jacke, in der er sich vor Behagen ordentlich schüttelte, mit einer grauen Tuchmütze auf und die Füße, wie es an Bord gebräuchlich ist, in Strümpfen und Schuhen, an Deck, die nötigen Befehle des Unterwegsgehens selbst zu geben. Der Anker, der indessen von den Leuten nur gelüftet worden war, kam, unter dem fröhlichen Singen der Mannschaft, denen eine Menge der Deckpassagiere bereitwillig half, nach oben, die Rahen wurden herumgebrasst, die Segel fielen gelöst nieder und fassten, als die Schoten ausgeholt wurden, den Wind, und langsam bewegte sich zum ersten Mal der mächtige Bau durch die trübe Weserflut stromab.
Die Passagiere standen dicht gedrängt an Deck, und vorn auf der Back des Vorkastells die Leute, hie und da noch Bekannten am Ufer zuwinkend, und Grüße für andere hinüberrufend. Viele der Frauen schwenkten dabei, als sie das Ufer mehr und mehr verließen, ihre Tücher, aber sie wussten nicht wem. Es galt auch wohl mehr dem Land selbst als den Menschen, die darauf standen, und ihnen ziemlich teilnahmslos und gleichgültig nachschauten. Sie sahen täglich so viele Schiffe mit Auswanderern in See gehen, das war eins mehr, weiter nichts.
Eine alte Frau stand auch an Deck, hielt sich mit der linken Hand an der Schanzkleidung und sah hinüber nach dem Land, dessen Häuser und Baumgruppen sie hinter sich ließen und langsam an dem niederen fahlen Ufer hinglitten. Es war die alte Mutter des Webers aus Zurschtel. Sie winkte mit der rechten Hand hinüber und murmelte halblaut und mit dem Kopf dazu nickend und schüttelnd vor sich hin: »Adje Leberecht – adje Zurschtel und die alte Linde, das Haus und der Garten und die Astern – s’ist vorbei – s’ist alles vorbei, und sie sollten mich alte arme Frau nur lieber hier gleich ins Wasser werfen, ehe sie mich noch mit hinausschleppen auf das große Meer – Amerika krieg ich doch nicht zu sehen, und der Leberecht muss jetzt allein unter der Linde liegen.« Und tief aufseufzend setzte sie sich auf eine der Notspieren die dort, längsseits der Schanzkleidung befestigt waren, zog die Schürze über den Kopf und weinte bitterlich.
Ihre Tochter stand daneben, das kleinste Kind auf dem Arm, aber konnte die Mutter nicht trösten. Das Herz war ihr selbst zum Brechen voll, und die großen hellen Tränen liefen ihr dick und schwer die bleichen, abgehärmten Wangen hinunter.
Auf einem der an Deck befestigten Wasserfässer, dicht bei ihnen, saß der Mann mit den kurzgeschnittenen Haaren; die Sonne schien ihm hell und voll auf das scharfmarkierte Gesicht, dessen oberer Teil wetterbraun und hart aussah, während der untere Teil, wo jedenfalls ein nun abrasierter Bart gestanden hatte, weiß und bläulich dagegen abstach. Wenig kümmerte der sich aber um das Land, die dunklen, finster genug dreinschauenden Augen hafteten nur eine Zeit lang wie forschend auf den Gestalten der beiden Frauen, dann aber pfiff er gleichgültig ein Lied vor sich hin und trommelte mit den Fingern den Takt dazu auf dem Fass.
Diese erste Abfahrt war aber noch keineswegs ein wirklicher Abschied vom Festland; die schwache Brise trieb das Schiff mit der günstigen Ebbe nur langsam vorwärts, und als die Brise später stärker wurde, trat die Flut bald ein, die ihnen fast so viel schadete als jene nützte, und sie bald darauf zwang, wieder vor Anker zu gehen. Sie befanden sich nun ganz in der Nähe von Bremerhaven, an dem sie die Masten der im Hafen liegenden Schiffe, ja die an Land auf- und abgehenden Leute deutlich erkennen konnten.
Aber die Passagiere ärgerte das erneute Ankerwerfen; das Abschiednehmen vom Vaterland dauerte ihnen zu lang – »das Vaterland nimmt gar kein Ende«, wie Steinert meinte, der ungeduldig auf Deck auf- und abschritt und die langweiligen Ufer der Weser um sich her betrachtete, denn einmal an Bord wollten sie nun auch hinaus auf See und das auf dem Fluss Herumfahren war ihnen, besonders den mit dem Kahn Gekommenen, fatal und langweilig genug geworden. Ändern ließ sich aber an der Sache auch nichts, und die Leute schlenderten teils an Deck herum und sahen zum Land hinüber, ob sie dort irgendetwas Interessantes erkennen könnten, oder lagen lang ausgestreckt auf den Wasserfässern oder im großen Boot und rauchten ihre Pfeife. Nur in der Kajüte hatte die alte Frau von Kaulitz eine Partie Whist arrangiert – ihre Aiden konnten ihr nun nicht mehr ausweichen – und kümmerte sich dabei weder um Land noch See, um Anker oder Segel, ja wenn nur jemand von irgendetwas auf das Schiff Bezügliche sprach, wurde sie ungeduldig, und verlangte die ungeteilte Aufmerksamkeit auf das viel wichtigere Spiel.


