Aus dem Wigwam – Wakondas Sohn
Karl Knortz
Aus dem Wigwam
Uralte und neue Märchen und Sagen der nordamerikanischen Indianer
Otto Spamer Verlag. Leipzig. 1880
Vierzig Sagen
Mitgeteilt von Chingorikhoor
Wakondas Sohn
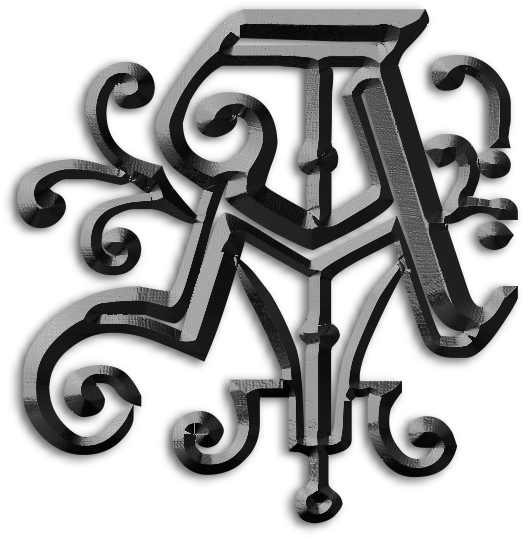 ls die Oto noch ihre Jagdgründe im Schatten der Berge des Großen Geistes durchstreiften, stand ihnen in Kriegs- und Friedenszeit ein tapferer und weiser Häuptling namens Wasabadschinga oder der Kleine schwarze Bär mit Rat und Tat zur Seite. Seine abenteuerlichen Kriegsfahrten und erstaunlichen Heldentaten bildeten lange Zeit das fast ausschließliche Gesprächsthema aller Stämme zwischen dem Mississippi und den Bergen der untergehenden Sonne und zwischen dem Missouri und dem See der Wälder. Er war stärker als ein Bär, schneller als ein Reh und schlauer als ein Puma. Keiner war so geschickt im Pferdestehlen wie er. Vor seiner Tür standen stets die besten Pferde des ganzen Landes, die er den Kusa, Omahas, Punka, Sioux und anderen Stämmen abgenommen hatte. In sternheller Nacht hatte er sich einst in das Lager der Missouri-Indianer geschlichen und denselben zahlreiche Skalpe abgezogen. Er war furchtlos in den Wigwam eines Arowak gegangen und hatte dessen liebste Squaw herausgeholt. Keiner hatte so geübte Augen, die Spuren der Menschen und des Wildes zu erkennen. Er zeigte genau, wo sich die Schlange durch das Gebüsch gewunden hatte. So schnell wie ein Eichhorn konnte er den höchsten Baum erklettern und von dort aus die Lager der feindseligen Indianer beobachten. Hungern konnte er länger als die Sandschildkröte oder der Bär des eisigen Nordens und marschieren so lange als der stärkste Adler fliegen. Niemand konnte sich mit ihm an Weisheit und Stärke messen.
ls die Oto noch ihre Jagdgründe im Schatten der Berge des Großen Geistes durchstreiften, stand ihnen in Kriegs- und Friedenszeit ein tapferer und weiser Häuptling namens Wasabadschinga oder der Kleine schwarze Bär mit Rat und Tat zur Seite. Seine abenteuerlichen Kriegsfahrten und erstaunlichen Heldentaten bildeten lange Zeit das fast ausschließliche Gesprächsthema aller Stämme zwischen dem Mississippi und den Bergen der untergehenden Sonne und zwischen dem Missouri und dem See der Wälder. Er war stärker als ein Bär, schneller als ein Reh und schlauer als ein Puma. Keiner war so geschickt im Pferdestehlen wie er. Vor seiner Tür standen stets die besten Pferde des ganzen Landes, die er den Kusa, Omahas, Punka, Sioux und anderen Stämmen abgenommen hatte. In sternheller Nacht hatte er sich einst in das Lager der Missouri-Indianer geschlichen und denselben zahlreiche Skalpe abgezogen. Er war furchtlos in den Wigwam eines Arowak gegangen und hatte dessen liebste Squaw herausgeholt. Keiner hatte so geübte Augen, die Spuren der Menschen und des Wildes zu erkennen. Er zeigte genau, wo sich die Schlange durch das Gebüsch gewunden hatte. So schnell wie ein Eichhorn konnte er den höchsten Baum erklettern und von dort aus die Lager der feindseligen Indianer beobachten. Hungern konnte er länger als die Sandschildkröte oder der Bär des eisigen Nordens und marschieren so lange als der stärkste Adler fliegen. Niemand konnte sich mit ihm an Weisheit und Stärke messen.
Er hatte neun Frauen, alle so schön wie der Weg des Großen Geistes (die Milchstraße). Obwohl sie alle in demselben Wigwam wohnten und aus derselben Schüssel aßen, so lebten sie doch stets in der größten Zufriedenheit und Eintracht. Wasabadschinga hatte zehn Söhne, die bereits alle so stark waren, dass sie den Bogen ihres Vaters spannen und seine Keule schwingen konnten. Der Töchter hatte er nur eine, und die war das schönste Mädchen im ganzen Land. Ihre Augen waren so mild wie Taubenaugen; ihre Zähne waren blendend weiß und ihr Haar war ungewöhnlich schwarz und lang. Sie nahm an allen häuslichen Arbeiten regen Anteil, und niemand hörte je ein Wort der Unzufriedenheit von ihr. Ihre Gespielinnen beneideten sie nicht wegen ihrer Schönheit, sondern fanden ihre größte Freude darin, ihr alle erdenklichen Schmucksachen zu schenken. Sie hieß Mekaia oder die Sonnenblume.
Nun geschah es eines Abends im Kornmonat, dass ein junger Mann auf einem weißen Pferd in das Dorf der Oto ritt. Er war groß und schlank; sein Haar war nicht so schwarz wie das der Indianer und dabei so fein wie die Federn auf der Brust des Kolibri. Er ritt sehr langsam und machte nicht eher Halt, bis er vor die Hütte Wasabadschingas kam, wo er abstieg und sein Pferd grasen ließ.
Er ging in den Wigwam des Häuptlings. Derselbe blieb ruhig auf seinem Lager aus Büffelfellen liegen und fragte ihn, wer er sei und woher er käme.
»Ich bin der Sohn Wakondas und komme direkt aus der Wohnung meines Vaters in den hohen Gebirgen des Sonnenunterganges.«
»Hast du viele Büffel auf deiner Reise getötet?«
»Gar keine.«
»Aber dann musst du sehr hungrig sein?«
»Wakondas Sohn erhält seine Nahrung vom Himmel, da ihm das Fleisch der Tiere auf der Erde zu hart und rau ist. Ich esse nur das Fleisch der Geisterbüffel, Geisterfische und Geistervögel, welche die Manitu am Blitzstrahl rösten und mir zuschicken. Als einziges Getränk dient mir der Regen, der frisch aus den Wolken fällt.«
»Hat dir dein Vater keine Botschaft für den Kleinen schwarzen Bär der Oto mitgegeben?«
»Gewiss. Er zeigte mir von den hohen Bergen des Westens die schöne Tochter des Oto-Häuptlings und befahl mir, hinzugehen und um sie zu werben. Sie müsse«, sprach er weiter, »Vater, Mutter und alle Bekannten verlassen und mir zum Land der ewigen Sonne und der milden Winde folgen, woselbst du sie nach einigen Jahren, wenn deine Knie schlottrig werden und deine Augen den Glanz verlieren, wiedersehen und dich ihrer Kinder freuen wirst.«
»Aber wie weiß ich, dass Wakonda dies gefügt hat?«
»Morgen, wenn die Sonne aus ihrem Schlaf erwacht, werde ich dir meinen Vater im wolkenlosen Himmel zeigen. Plötzlich wird dann ein undurchdringliches Dunkel den Himmel überziehen, und der Donner, der Wakondas Stimme ist, wird mit solchem Getöse rollen, dass alle Indianer vor Furcht zur Erde fallen werden. Wenn sie wieder aufstehen, wird das Firmament wieder klar und hell sein und die Blitze, welche meines Vaters Augen sind, werden hin und her zucken. An diesem Zeichen wirst du erkennen, dass ich Wakondas Sohn bin.«
»Wenn dies wirklich geschehen wird, wie du sagst, dann werde ich dich mit Freuden als Schwiegersohn begrüßen.«
Bald wurde überall bekannt, dass der Sohn Wakonda da sei, um die schöne Sonnenblume als Braut heimzuführen. Kein Auge im ganzen Dorf schlief in der folgenden Nacht.
Am nächsten Morgen versammelten sich alle Indianer vor der Hütte des Häuptlings und warteten mit Furcht und Zittern auf die kommenden Stunden. Der junge Mann hielt sein Besprechen pünktlich. Als die Sonne aufging, war keine Wolke sichtbar, doch schon nach einem Augenblick wurde der Himmel so schwarz wie in der dunkelsten Nacht und die Erde erzitterte unter dem Krachen des schrecklichsten Donners, dem merkwürdigerweise keine Blitze vorhergingen. Bald aber war der Himmel wieder so hell wie vorher, und die Blitze schossen von allen Seiten hernieder und zerschmetterten die dicksten Bäume und größten Felsen. Dann schloss der Große Geist seine Augen wieder und es wurde still.
Als sich die Indianer von ihrem Schrecken erholt hatten, fielen sie vor dem Fremden nieder und erkannten ihn als den Sohn Wakondas an.
Wasabadschinga aber sagte: »Er hat sich meiner Tochter würdig gezeigt und ich werde sie ihm in Gegenwart des ganzen Stammes zur Frau geben.«
Darauf ging er in seinen Wigwam und holte sie. Der Sohn Wakondas nahm sie in seine Arme und erklärte, dass er ihrer Schönheit und Anmut wegen die himmlischen Gefilde seiner Heimat verlassen habe und in das kalte und unfreundliche Land der Oto gekommen sei. Sie weinte, aber es schien mit ihren Tränen kein Ernst zu sein, denn sie lächelte freudig dabei, so wie sich die Sonne an einem Frühlingsmorgen durch den nebligen Dunst des Himmels stiehlt.
Danach wurde das Hochzeitsfest gefeiert und fröhlich getanzt, gegessen und gesungen. Als dies vorbei war, gaben sie dem glücklichen Paar das Geleit bis an den Saum des nächsten Waldes. Dann sagte der Häuptling zum Abschied:
»Ich habe dir mein Liebstes auf der ganzen Erde, meine einzige Tochter, gegeben. Sei daher stets freundlich gegen sie. Lass sie keine Schweren Lasten schleppen und schicke sie nicht in den Wald, um Holz zu holen!«
»Solche Arbeiten«, erwiderte der Sohn Wakondas lächelnd, »kennt man in den glücklichen Tälern meiner Heimat nicht. Dort scheint die Sonne stets so warm, dass man kein Feuer braucht. Mein Stamm hat weder Büffel zu jagen noch Mais zu mahlen.«
Darauf setzte er seine junge Frau hinter sich auf sein Pferd und ritt weiter.
Ungefähr drei Monate danach, zur Zeit der Ernte, als der Wald anfing, sein grünes Kleid auszuziehen und die Lüfte unfreundlich wehten, versammelten sich die Indianer des Oto-Stammes zu einem Fest in dem Wigwam ihres Häuptlings. Es war eine wundervolle Nacht und kein Lüftchen regte sich. Doch als sie eben anfangen wollten, die guten Dinge des Waldes und Flusses zu verzehren, bewegte sich plötzlich die Erde unter ihnen hin und her und ein donnerähnliches Getöse wurde hörbar. Sie wollten schnell den Wigwam verlassen, wurden aber beständig von einer Ecke in die andere geworfen, sodass sie die Tür nicht finden konnten. Als das Erdbeben nachgelassen hatte, sahen sie mit Schrecken die Veränderung ringsum. Die kleinen Ströme der Umgegend waren durch riesige Felsmassen zugedeckt, die Bäume waren mit furchtbarer Gewalt aus dem Boden gerissen worden und der Gesang der Vögel war verstummt. Sie riefen ihre Medizinmänner zusammen und fragten nach der Ursache dieser Zerstörung.
»Der Meister des Lebens ist böse«, antworteten sie, »aber wir kennen den Grund nicht. Doch bald wird jemand kommen, der uns bessere Auskunft geben kann.«
Es vergingen drei Tage, ohne dass sich jemand Fremdes sehen ließ. Doch als am Morgen danach der Häuptling vor seine Tür trat, sah er seine geliebte Tochter weinend davor stehen. Sie hatte sich sehr verändert. Ihr Auge war erblasst, ihre Wangen waren eingefallen und ihr Haar hing in wilder Unordnung auf ihre Schultern herab. Sie war nicht mehr die Sonnenblume des Stammes. Ihre Füße schwankten und ihre Stimme war kaum noch vernehmbar.
»Wo kommst du her, meine Tochter?«, fragte Wasabadschinga.
»Aus dem Tal diesseits der Gebirge.«
»Wo ist dein Gatte?«
»Tot.«
Wasabadschinga hielt die Hände vor das Gesicht, um seine Tränen zu ersticken, und fragte nach der Ursache seines Todes.
»Ehe wir die heimatlichen Berge Wakondas erreicht hatten, kam ein Mann mit weißem Gesicht auf einem kleinen schwarzen Pferd zu uns und bot wollene Decken, Perlen und Feuerwasser zum Verkauf an. Mein Gemahl wies ihn ab und machte ihm Vorwürfe, dass es sehr schlecht von ihm sei, die armen Indianer ins Unglück zu stürzen. ›Ich bin ein besserer Mann als der Sohn Wakondas‹, erwiderte jener stolz, ›denn ich verehre den einzig wahren Gott und wohne nicht mit Bären and Wölfen im Wald zusammen.‹ Mein Gemahl lächelte ob dieser Worte, doch das Blassgesicht ergriff seinen Speer, und im nächsten Augenblick lag der Sohn Wakondas leblos auf dem Boden.«
Nun konnte Wasabadschinga seinen Schmerz nicht länger verbergen und klagte so laut, dass alle Männer und Frauen des ganzen Dorfes herbeistürzten. Die Frauen zerrauften aus Trauer ihr Haar, ritzten ihre Arme mit scharfen Steinen und stimmten einen rührenden Gesang der Klage an. Sie sangen von der Liebe und dem Glück des jungen Paares, von der Grausamkeit des Blassgesichtes und von dem Zorn Wakondas, dem er in dem schrecklichen Erdbeben Luft gemacht habe.
Der Große Geist ließ die Sonnenblume nicht mehr lange auf der Erde, sondern rief sie bald zu seinem Sohn in das Land der Seelen ab. Doch kehrt sie oft zurück. Man sieht sie häufig im Schatten der Bäume sitzen, die sie früher pflanzte. Zur Zeit der Blumen pflückt sie sich in mondhellen Nächten die allerschönsten und bindet sie zu einem Strauß zusammen, den sie ihrem Gemahl bringt. Wakondas Sohn aber ist nie mehr zurückgekehrt.




