Addy der Rifleman – Auf der Fährtensuche
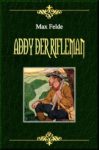 Max Felde
Max Felde
Addy der Rifleman
Eine Erzählung aus den nordamerikanischen Befreiungskämpfen
Union Deutsche Verlagsgesellschaft Stuttgart, Berlin, Leipzig, 1900
Auf der Fährtensuche
Am nächsten Morgen, es war noch vollständig dunkel, erstiegen mehrere Dutzend entschlossene, wohlbewaffnete Männer die Anhöhe, die am Abend zuvor der Schauplatz des kleinen Feuergefechtes gewesen war.
Ein feiner Sprühregen sank wie ein Nebel nieder und einzelne starke Windstöße fuhren rau und kühl über die Fluren.
Mit dem ersten Morgengrauen traten die Männer in den dichten Wald ein und bald hatten sie die Fährte der Indianer gefunden.
Die verstreut liegenden Spuren führten von der Stelle aus, wo Letztere das geraubte Vieh preisgeben mussten, Wald einwärts und sprachen deutlich dafür, dass die Indianer so schnell wie möglich das Weite gesucht hatten. Dafür zeugten das oft gewaltsam durchbrochene wirre Gestrüpp und die Sprungweite der Fußstapfen, die in dem weichen Waldboden überall dort, wo die Fußeindrücke durch den nächtlichen, frischen Blätterfall nicht schon wieder bedeckt waren, mit voller Deutlichkeit vorlagen.
Die Indianer hatten ohne allen Zweifel einen großen Vorsprung. Es war daher nur wenig Aussicht vorhanden, sie einzuholen.
Gleichwohl bestanden alle Leute darauf, noch eine größere Strecke vorzudringen. War es doch möglich, dass sich die Rothäute irgendwo in ein Versteck zurückgezogen hatten, um sich dort zu einer neuen Untat vorzubereiten, und lechzte doch jeder einzelne Farmer danach, den verhassten Räubern einen derben Denkzettel zu versetzen.
Die Männer machten sich also rüstig an die weitere Verfolgung, die zunächst ergab, dass die bisher regellos nebeneinander herlaufenden Fußstapfen auf einen schmalen westwärts führenden Waldpfad einbogen und sich zu einer einzigen Linie zusammenschlossen. Hier, auf dem einigermaßen gebahnten Wege kamen die Farmer nun rascher vorwärts und verfolgten die Fährte mit größter Energie wohl zwei Stunden weit, ohne jedoch den Feind zu Gesicht zu bekommen. Endlich verlegte ihnen ein Bach den Weg.
Als die Männer festgestellt hatten, dass jenseits des Gewässers der Pfad und die Spuren weiter liefen, erklärte Addy die fernere Verfolgung für nutzlos und riet zur Umkehr.
Davon aber wollten die wenigsten Farmer etwas wissen.
»Wir folgen ihnen«, erklärte einer, »und führte der Weg bis ans Weltende!«
»Dazu wünsche ich Euch die nötigen Siebenmeilenstiefel«, scherzte Addy und fügte, wieder sehr ernst werdend, hinzu: »Glaubt Ihr, dass ich von der Verfolgung abließe, wenn die geringste Aussicht vorhanden wäre, das Gesindel vor den Lauf unserer Flinten zu bekommen?«
»Daran zweifle ich nicht«, entgegnete ein anderer der Männer. »Aber wollt Ihr uns nicht erklären, warum Ihr die weitere Verfolgung absolut für aussichtslos haltet?«
»Das will ich Euch sagen«, erwiderte Addy. »Erstens führt die Fährte nach Westen, hält also die Richtung ein, woher die Rothäute kamen, auf die Seen. Die Spuren tragen alle Anzeichen, dass die roten Schufte es sehr eilig hatten und das lässt darauf schließen, dass sie die Verfolgung als sicher annahmen.«
»Ihr seid also der Meinung, dass sie geradeswegs in ihre Dörfer zurückkehren?«
»Gewiss, dieser Ansicht bin ich. Es waren, nach allem zu schließen, ihrer nur wenige, die aus irgendeinem Grund einen heimtückischen Putsch wohl wagen mochten, unseren Büchsen aber nicht standhalten.«
»Und zweitens – was wolltet Ihr noch sagen?«
»Zweitens«, erklärte Addy, »lässt ein Indianer, der sich auf Schleichwegen befindet, einen Wasserlauf, wie diesen Bach hier, niemals ungenutzt. Würden die Roten etwa die Absicht haben, einen Bogen zu schlagen, um vielleicht auf einem anderen Punkt ins Tal zu brechen, hätten sie sicherlich den Bach betreten.«
»Um die Fährte zu verwischen?«
»Ganz richtig, um die Fährte zu verwischen, den Bach hinauf- oder hinabzuwaten, um an einem geeigneten Punkt, der keine Fußeindrücke hinterlässt, wieder aufs Trockene überzutreten. Ihr seht aber, die Fährte führt jenseits des Wassers weiter.«
»Und wie groß schätzt Ihr die Entfernung, die sie jetzt voraus sein mögen?«
»Auf mindestens zwölf Meilen.«
»Das wäre viel!«
»Nicht zu viel für gute Läufer – und«, setzte Addy mit einem bedeutungsvollen Lächeln hinzu, »nicht zu viel, wenn man berücksichtigt, dass sie die Lektion, die sie bei Oriskany erhielten, noch in frischem Gedächtnis haben. Das macht schnelle Beine.«
Die Farmer lachten. Sie sahen wohl ein, dass die Ansicht des Jägers viel für sich hatte, und machten kehrt.
Der feine Sprühregen schien inzwischen aufgehört zu haben. Das monotone leise Rascheln in den Baumkronen war verstummt. Dafür fielen aus dem herbstlichen, aber immer noch dichten Laubdach des Waldes nun große, schwere Tropfen.
Missmutig und ihrem Groll weidlich Luft machend, wanderten die Farmer dahin.
Addy war ihnen eine gute Strecke gefolgt, rief aber dann bald Franzl an seine Seite. Die beiden verabschiedeten sich von den Männern, um, wie sie sagten, nach ihren Fallen zu sehen. Da ihr Jagdgebiet nahe lag, fand man dies begreiflich.
Die beiden bogen alsbald links ab, während die anderen auf dem Waldpfad verblieben.
Addy und Franzl, rüstig ausschreitend, durchquerten den Wald.
Nach kaum halbstündiger Wanderung neigte sich derselbe einer Talsenkung zu und sie waren an Ort und Stelle.
Hier suchten sie entlang dem Ufer des Flusses ihre Fallen auf und fanden auch richtig einige Beute. Sie reinigten die Fanggeräte und setzten frische Köder auf. Sie nahmen alsdann das erbeutete Wild aus, banden es mit Weidenruten zusammen und beluden sich damit den Rücken. Dann schlugen auch sie die Richtung zum Mohawktal ein.
»Ich will Euch nur sagen«, begann Addy, nachdem sie geraume Weile stumm am Flussufer dahingeschritten waren, sich plötzlich nach seinem Hintermann umwendend, »dass ich zu diesem Umweg meinen guten Grund hatte.«
Franzl hatte soeben seine Maultrommel zwischen die Lippen geschoben und war im Begriff gewesen, sich zur Kürzung des Weges eines vorzududeln. Sogleich aber ließ er das Instrument mit einer gewissen Virtuosität aus dem Mund in die flache Hand fallen und hing es über das rechte Ohr.
»Hab’ mir’s leicht denk’n können«, erwiderte er.
»Der Mann gestern am Waldausgang, der will mir seit dem Brand nicht mehr aus dem Sinn.«
»’s is aa merkwürdi’«, erwiderte Franzl, nachdenklich den Kopf schüttelnd. »Könnt’n ‘leicht jetzt bei Tag herausfind’n, wohin der Fred gestern so schnell verschwund’n is.«
»Ihr seid also noch immer der Meinung, dass er es war?«
»Ka’ anderer«, entgegnete Franzl bestimmt, »i machet a jede Wett!«
In dem Gesicht des Jägers stieg etwas wie Wetterleuchten auf. Aber er sagte nichts, sondern stapfte, die Blicke auf den Boden geheftet, in dem früheren Tempo weiter. Franzl folgte.
So waren sie allgemach dem Waldausgang ziemlich nahe gekommen.
Mit einem Mal hielt Addy an und betrachtete mit weit aufgerissenen Augen den Zweig eines Busches, der in Schulterhöhe quer über den schmalen Pfad hinwegragte.
Ein leiser Ausruf des Erstaunens rang sich dabei über die Lippen des Jägers.
»Was is?«, fragte Franzl.
Stumm deutete Addy auf das dornige Ästchen, an dem ein Büschel brauner Haare haftete. Sie mussten, das war auf den ersten Blick klar, entweder von einem Wild oder von einem wollenen, menschlichen Bekleidungsstoff herrühren.
Die beiden unterwarfen das Büschelchen einer genauen Untersuchung und entschieden sich schon nach kurzer Beratung dafür, dass die Haare kein natürliches Produkt seien, sondern einer gefärbten wollenen Decke oder dergleichen angehört hatten.
Dann wandten sich Addys Blicke forschend dem Boden zu. Er schob mit dem Kolben seiner Büchse sachte das frisch gefallene, welke Laub beiseite.
Wieder kam ein leiser Ausruf über seine Lippen.
Die unter dem weggeschobenen welken Laub liegende Blätterschicht überdeckte hier nicht völlig den durchweichten Erdboden, ließ vielmehr da und dort einzelne kleine Flächen frei, und auf einer derselben war der ziemlich scharfe Abdruck einer menschlichen Fußbekleidung zu bemerken.
»Kennt Ihr diese Schrift?«, fragte Addy seinen Begleiter.
Franz trat einen Schritt vor, bückte sich und besah die Fußspur. »Unser Tritt von gestern is’s nit«, entschied er, »so a Schuhwerk kann nur vun an Rot’n herrühr’n.«
»Das muss ein Blinder sehen«, bestätigte der Jäger und schob im Weiterschreiten mit der rechten Fußspitze vorsichtig noch mehr Laub beiseite.
Mit der Bloßlegung des Bodens zeigten sich auf dem Pfad immer mehr Fußspuren, die alle, wie sich nach und nach herausstellte, von der Seite her auf den Weg einmündeten und dann auf demselben talwärts weiterführten.
Bald gelangten die beiden unter eine Gruppe von Bäumen, die noch ziemlich stark belaubt waren. Hier war der Waldboden unbedeckt und an dieser Stelle hatten sie nun deutlich und klar die Abdrücke einer großen Anzahl Mokassins vor sich, die Addy als von etwa einem Dutzend Indianer herrührend schätzte.
»Die Sache wird immer interessanter«, bemerkte der Jäger. »Die Spuren scheinen genau zu dem Punkt zu führen, wo wir gestern aus dem Wald ausgetreten sind.«
Seine Annahme traf zu.
Schon nach kurzer Zeit waren sie, auf der Fährte weiterschreitend, am Waldrand angelangt. Dort aber wurde der Pfad, der von hier aus ziemlich steil zu Tal führte, steinig, die Spuren verschwanden.
»Kennt Ihr diese Schrift?«, fragte Addy.
Es war klar, dass die Fährte entweder geradeaus talab oder seitlich entlang dem Waldrand führen musste.
Addy gab der letzteren Richtung den Vorzug. Er winkte seinem Begleiter.
Die beiden überschritten eine kleine Strecke Wiesengrund, aber auch hier fanden sich keine Spuren, weil wahrscheinlich der während der Nacht niedergegangene Regen die Fußeindrücke vollkommen verwaschen hatte. Bald aber entdeckten sie unten am Fuß des Hügels, querlaufend über frisch gepflügtes Ackerfeld, eine tief ausgetretene Fährte.
Schnell sprangen sie die nur unbedeutende Berglehne hinab. Addy untersuchte nun hier die Fußstapfen, aber bald schon hielt er inne und schüttelte enttäuscht den Kopf.
»Nix … und immer wieder nix«, sagte verdrießlich auch Franzl, als dieser auf eine längere Strecke die Fährte verfolgt hatte und immer nur Mokassinabdrücke vor sich sah.
»Merkwürdig genug«, gab Addy zurück.
»Off’n g’stand’n«, bemerkte Franzl, »kunnt’s mi, wann’s nix is, für den Fred nur freu’n.«
»Da bin ich ganz Eurer Meinung – aber ich kann nun einmal den Argwohn, dass die Roten geführt wurden, nicht los werden.«
Da Franzl nichts entgegnete, sondern nur die Achseln hochzog, fuhr Addy zur Bekräftigung seiner Vermutung zu erklären weiter: »Ihr seht, es liegen auf der Strecke von hier bis zur Brandstelle mindestens ein halbes Dutzend Farmen. Muss man sich da nicht sagen: Wenn die roten Schufte es nur aus purer Mord- und Habgier auf Raub und Brandschatzung abgesehen hatten, warum schlugen sie nicht, wo sie es doch so viel bequemer hatten, die nächstliegenden Türen ein? Warum streichen sie den weiten Weg über die Äcker, noch dazu bei Nacht, dicht an allen diesen viel reicheren Farmen vorbei und wählen sich für ihre Schandtat just die unsere? Gibt das nicht zu denken?«
»Dageg’n lasst si’ nix sag’n«, stimmte Franzl bei, »aber«, fügte er mit einem Blick auf die Fährte hinzu, »wo bleibt dann der Stief’l, der si’ nit find’n lasst. Solang wir den nit hab’n, is all’weil no nix erwies’n.«
»Das ist eben der Haken«, versetzte Addy, wandte sich wieder der Fährte zu, verfolgte sie noch eine ziemliche Strecke, ließ aber wieder davon ab, und sich aufrichtend und auf seine Büchse stützend, sagte er: »Es gibt da nur noch eine Annahme.«
»Na – und?«, fragte Franzl.
»Ich will Euch sagen, dass die Roten von den Seen oben, wenn sie zu mehreren einen weiten Marsch antreten, die Gewohnheit haben, einige Reservemokassins mitzunehmen – vielleicht kommt Ihr jetzt selber darauf.«
»Ihr glaubt, dass’s dem Fred am End’ gar so an indianischen Schuhschlapp’n unterbund’n hab’n? – dös war nit schlecht!«
»Ich kann mir das wahrlich nicht anders zusammenreimen.«
»Wann das is«, versetzte Franzl lachend, »dann kunnt’ ma nach dem Stief’l lang’ such’n.« Und wieder ernst werdend, ja finster dreinblickend, setzte er hinzu: »Wisst’s was? I halt dafür, das Ding da führt zu nix, so viel hab’ i schon g’seh’n … aber ‘nüber gehn ma und halt’n dem Fred d’ Faust unter die Nas’n … beicht’n muss er …« Und des Franzls Gestalt reckte sich bei diesen Worten, als gäbe er sich von innen heraus einen förmlichen Ruck.
Addy musste über die energische Ausdrucksweise seines Begleiters lächeln, war aber mit dessen Vorschlag ganz einverstanden.
Sogleich bogen sie links nach der Hauptstraße des Tales ein, überquerten dieselbe und waren schon nach kaum einer Stunde an Ort und Stelle.
Um das Herckheimersche Wohnhaus herum war es gegen früher sehr ruhig. Die Mehrzahl der grünen Fensterläden, die dem Haus einen so freundlichen Anstrich gaben, waren sogar geschlossen.
Die Besitzung war an einen ohnehin schon reich begüterten Anverwandten des verstorbenen Generals übergegangen, der die Äcker und Felder sofort in Bewirtschaftung nahm, die Verfügung über das Wohngebäude aber sich noch vorbehielt.
Einstweilen sollte Binche, die ehemalige Haushälterin des Dahingegangenen, dasselbe instand halten und auch Fred war der Aufenthalt in demselben bis auf Weiteres freigestellt.
Die beiden Männer hatten sich dem Haus bis auf etwa hundert Schritte genähert, als der Hofhund anschlug.
Sogleich ging im oberen Stock ein Fensterladen auf. Binche bog sich, freundlich grüßend, über die Brüstung.
Bis die beiden am Hauseingang anlangten, hatte sie denselben bereits geöffnet und inzwischen auch Zeit gefunden, sich ein schneeweißes Häubchen auf die dunklen Haarflechten zu setzen.
»Gott zum Gruß!«, sagte sie schlicht und setzte, auf die verschlossen gewesene Haustür weisend, gleichsam entschuldigend hinzu: »In jetziger Zeit muss man wieder vorsichtiger sein – lieber es sich vorher bedenken, als später bereuen.«
»Da habt Ihr ganz recht, Binche«, entgegnete der Jäger. »Vorsicht kann niemals schaden. Ich fürchte, dass es gut sein wird, wenn man auf den Farmen schon bald nachsieht, ob das Pulver trocken liegt und allenthalben daran denkt, die Türen zuzuhalten.«
»Ihr befürchtet also, dass wir wieder bösen Zeiten entgegengehen?«, fragte besorgt Binche.
»Ängstigt Euch nicht«, erwiderte Addy. »Ist ja nur meine persönliche Meinung und bis jetzt glücklicherweise nichts als eine Vermutung.«
»Vermutung? Aber heute Nacht das Feuer?«
»Nun ja«, entgegnete der Jäger achselzuckend, »das Feuer weist auf nichts Gutes; aber es ist damit noch lange nicht erwiesen, dass es der Ruf zum Streit wäre.«
»Ihr habt aber doch eben selbst zur Vorsicht gemahnt?«
»Allerdings, und die kann, wie ich eben sagte, niemals schaden. So viel ist gewiss, dass Thayendanegeas sehr rachsüchtig ist, und dass er uns für die bei Oriskany empfangenen Hiebe kaum die Friedenspfeife anbieten dürfte.«
»Also glaubt Ihr, dass er wiederkommt?«
»Wer kann das sagen? Den offenen Kampf scheut er, so viel ist sicher. Dieser Ansicht war auch der Oneida. Daran hindert ihn nicht allein der Respekt, den wir ihm beigebracht haben, sondern auch die Zahl seiner Krieger, die arg zusammengeschmolzen sein soll.«
»Was wäre aber dann der Grund Eurer Sorge?«
»Ihr seid ungemein hartnäckig, Binche«, entgegnete lächelnd der Jäger. »Nachdem ich bei Oriskany oben gesehen haben, wie wacker unsere Leute dreinzuschlagen wissen, habe ich Sorgen überhaupt nicht. Thayendanegeas aber wird Vergeltung suchen, das halte ich für ziemlich sicher. Daher wäre es immerhin möglich, dass er uns ab und zu mit einem Besuch oder, dass Ihr mich recht versteht, mit dem sogenannten kleinen Krieg beehrt.«
»Also die Farmen bei Nacht und Nebel überfällt, den roten Hahn aufs Dach setzt – das Feuer gestern, es war ja schrecklich!«
»Ja, es hat tüchtig aufgeräumt, alles ist dahin bei Rump und Stumpen; die beiden Knechte verschwunden, die Kathrin skalpiert …«
»Entsetzlich!«
»Nur das Vieh, das die Schufte bereits auf die Höhe getrieben hatten, vermochten wir ihnen wieder abzunehmen.«
»Also noch ein Glück im Unglück – und dass das just Eure Farm betroffen hat!«
Die Züge der beiden Männer wurden um einen Schatten ernster.
»Sagt, Binche«, fragte Addy, »wo steckt der Fred? Seinetwegen sind wir eigentlich hier. Wir hätten ein ernstes Wörtlein mit ihm zu reden.«
»Da fragt Ihr mich zu viel. Schon seit acht Tagen war er nicht mehr im Haus.«
Fragend sahen sich die beiden Männer an.
»Und Ihr wisst nicht, wo er sich herumtreibt?«
»Er sagte nichts und ich fragte ihn nicht, als ich merkte, dass er wegging. War es in letzter Zeit doch etliche Male schon der Fall. Offen gestanden«, setzte Binche lebhaft hinzu, »bin ich herzlich froh, wenn ich ihn nicht um mich weiß, den finsteren, mürrischen Gesellen. Vordem, während der Krankheit des Herrn, war es, als ob er sich ganz gut machen würde. Seit der Testamentseröffnung ist es aber völlig aus mit ihm.«
»Ihr habt auch keine Ahnung, wo er sich hingewendet hat?«
Binche verneinte.
»Könnt Ihr Euch auch nicht denken, wann er wiederkehrt?«
»Auch darüber wüsste ich nichts zu sagen. Das letzte Mal blieb er acht, vordem etwa vierzehn Tage aus.«
»Könnt Ihr Euch etwa vorstellen, Binche, was ihn zum Weggehen von hier bestimmen mag, was er etwa auswärts treibt?«
Binche zuckte die Achseln.
»Dann«, bat Addy nach einigem Bedenken, »seid so gut, und lasst es uns doch gleich wissen, wenn er sich wieder einfindet.«
»Ist die Sache so wichtig?«, fragte Binche, und als sie merkte, dass Addy sich schon wieder zum Gehen wenden wollte, fügte sie hastig, fast bestürzt hinzu: »Nein, daraus wird nichts, ihr Männer seid ja allzeit durstig – und ihr kommt von weit her – man sieht es an euren Stiefeln.«
Binche deutete mit einer energischen Handbewegung auf die neben befindliche Veranda und verschwand dann hinter der Haustür.
»Eigentlich wollte ich Euch einen freien Augenblick verschaffen«, sagte treuherzig der Jäger zu Franzl, während sich die beiden an dem Tisch der Veranda niederließen. »Denn es lässt sich doch annehmen, dass man selbst bei unbeabsichtigt gewesenem Besuch seiner Braut etwas zu sagen hat.«
»Dazu hab’n wir zwoa, wenn uns Gott ein langes Leb’n schenkt, grade noch g’nug Zeit«, versetzte Franzl. »Sagt lieber, was mach’n mit dem Fred?«
»Da fragt Ihr zu viel«, entgegnete Addy. »Ihm nachlaufen? Wer kann wissen, wo er steckt? Es wird nichts anderes übrig bleiben, als in Geduld zu warten, bis er wiederkehrt.«
»Und wann er wirklich a schlecht’s G’wiss’n hat, d’ Lunt’n riecht und net wieda kimmt?«
»Das hielt ich kaum für ein Unglück. Ich trage ihm, selbst wenn er schuldig wäre, schon um des Herckheimers willen, nichts nach. Die Talbewohner aber könnten dessen nur froh sein. Engländer von Geburt ist er, und der Apfel fällt nie weit vom Stamm. Mein Verdacht, dass er es mit den Johnsonschen hält, ist nicht von heute. Sollte er aber wiederkommen und es sich erweisen lassen, dass seine wiederholten Drohungen gegen uns beide keine leeren waren, dass er an dem gestrigen Vorfall irgendwie teil hat, gibt es, das schwöre ich Euch, schon um der allgemeinen Sicherheit willen, wenig Federlesens.«
Binche kam nun wieder aus dem Haus, in der einen Hand einen Weinkrug, in der anderen ein Körbchen. Geschäftig entnahm die junge Haushälterin dem Letzteren zwei Zinnbecher und verschiedenes kaltes Fleisch und Brot. Sie legte von den Speisen vor und goss die Becher voll.
Die beiden Männer ließen sich nicht lange nötigen, sondern griffen ohne Umstände wacker zu.
»Nun, Binche, was sagt Ihr zu der niedergebrannten Farm?«, fragte Addy, als er und Franzl auf den Tellern ziemlich aufgeräumt hatten und der größte Durst gelöscht war.
»Was soll man dazu sagen? Das Unglück ist nun einmal geschehen und Ihr müsst den Verlust eben wohl oder übel hinnehmen.«
»Ihr seid aber doch dafür, dass wir die Hütten wieder aufbauen?«
Etwas wie Schelmerei leuchtete aus des Jägers Augen. Binche bemerkte das und sah misstrauisch zu ihm auf.
»Natürlich werdet Ihr das«, entgegnete sie und warf dann auch auf Franzl einen forschenden Seitenblick.
Dieser hatte sein Esszeug bereits beiseitegeschoben, zog nun seine Maultrommel hervor und flötete einen Dudler, als ob ihn das Gespräch der beiden anderen gar nichts anginge.
»Ob wir aber bis zum Frühjahr noch rechtzeitig fertig werden?«, fragte Addy wieder.
»Warum gerade bis zum Frühjahr?«, entgegnete Binche und fuhr, etwas verlegen lächelnd und wieder Franzl von der Seite her einen Blick zuwerfend, glättend mit den Händen über ihre Schürze. »Ihr werdet es erleben, dass die Farm schon in etlichen Wochen schöner als je zuvor dasteht.«
»Ei, das ginge aber schnell«, meinte, wirklich erstaunt, der Jäger.
»Je nun«, erwiderte Binche, »es war schon heute Morgen davon die Rede, dass alle Farmer in und um Little Falls zusammenstehen werden, die Farm wieder herzurichten.«
»Na«, sagte Addy, »wenn das ist, dann erleidet die Hochzeit ja weiter keinen Aufschub.«
Franzl begann auf seiner Maultrommel jetzt gar mächtig zu rasseln. Gleichzeitig sprang Binche resolut von ihrem Sitze auf, erwischte ihn bei seinem mächtigen Haarschopf und rief halb ärgerlich, halb lachend: »Hat es der schlechte Mensch richtig schon ausgeplaudert, diese Schwatzbase!«
Franzl machte eine arge Armesündermiene. Addy dagegen lachte herzlich über das kleine Unheil, das er mit seiner Bemerkung angerichtet hatte, und rief dann: »Ja, Binche, wenn Ihr ihn etwa verpflichtet habt, zu schweigen, dann schüttelt ihn nur tüchtig!«
Diesen Rat befolgte nun Binche nicht. Sie gab ihrem Bräutigam nur schnell noch einen liebevollen Puff und sank dann, die Hände im Schoß faltend, halb schmollend, halb verlegen lächelnd, auf ihren Stuhl zurück.
»Das ging ja noch recht gnädig ab«, meinte Addy belustigt. »Es wäre für ihn aber auch gar zu hart, Binche, würdet Ihr ihm deswegen wirklich böse sein. Er ist wahrlich nur zur Hälfte schuldig. Gestern, just vor dem Brande war es, da haben wir ihm drüben in der Fröhlich Pfalz das große Geheimnis förmlich herausgepresst.«
»Also am Wirtstisch sogar? Na, dann weiß es natürlich heute schon das halbe Tal«, entgegnete, sich sehr erbost stellend, Binche und erhob wieder drohend die Hand gegen Franzl.
Dieser wich wie erschrocken zurück, rückte seinen Stuhl und begann, als er sich in sicherer Entfernung sah, den beiden auf seinem Instrument einen Ländler vorzutrommeln.
»Ist das nicht ein recht schlechter Mensch?«, wandte sich Binche an Addy. »Da bekomme ich zum Mann einen netten Gesellen. Erst schwatzt er, wo er nicht schwatzen soll, und da ich ihm jetzt die Leviten lesen will, spielt er mir eins zum Tanz!«
»Lasst es gut sein, Binche«, sagte Addy, nachdem er die beiden eine Weile still lächelnd betrachtet hatte. »Der böse Geselle scheint mir gerade der Rechte für Euch. Hat mich herzlich gefreut, als ich von Eurem Bündnis vernahm. Doch, Binche, da die Frage von der Farm schon angerissen ist, und da Ihr über kurz oder lang die Frau Pächterin werdet, so überlegt Euch, ehe wir an den Bau gehen, ob Ihr nicht noch besondere Wünsche habt.«
Binche versprach, sich zu besinnen und ihrem Pachtherrn etwaige Wünsche noch rechtzeitig mitzuteilen.
»Gegen den Pachtvertrag, den wir beide, Franzl und ich, bereits abgeschlossen haben, hättet Ihr nichts einzuwenden?«
»Höchstens«, entgegnete Binche lachend, »dass Ihr den Pachtschilling gar zu niedrig bemessen habt.«
»So war es nicht gemeint«, erwiderte abwehrend der Jäger. »Ich wollte eigentlich fragen, ob Ihr gegen die Farm selber kein Arg habt? Die heutige Nacht hat es gelehrt, dass die roten Spitzbuben es ganz besonders auf sie abgesehen haben.«
»O«, rief Binche, »das müsste eine traurige Farmerin sein, die an der Seite ihres Mannes nicht ohne Angst und Bangen aushielte. Und Ihr selber bleibt ja auch bei uns, auf Eurem Ausgedingstüb’l.«
»Solchen tapferen Sinn lobe ich mir«, erwiderte schmunzelnd Addy. »Wenn aber, wie es scheint, die Farm eine Unglücksfarm ist – gesetzt den Fall, wir beide sind über Feld, und just dann kämen gerade wieder einmal die Roten?«
»Dann wäre«, entgegnete Binche energisch, »solange eine gute Büchse und trockenes Pulver im Hause ist, auch noch nicht alles verloren.«
»Potztausend – das nenne ich Mut haben«, versetzte belustigt Addy. »Versteht Ihr wirklich mit Pulver und Blei umzugehen?«
Statt jeder Antwort langte Binche nach des Jägers Büchse, die neben ihrem Sitz gegen die Wand gelehnt stand und erbat sich von ihm ein Zündhütchen.
Mit sicherem Blick hatte sie sofort ersehen, dass die Läufe geladen waren, und setzte nun mit kundiger Hand das Hütchen auf den einen Piston.
Nun sah sie sich nach einem Ziel um.
Etwa sechzig Schritte vom Haus entfernt, in dem nebenan liegenden Baumgut, hing an einer kurzen, auf diese Entfernung kaum sichtbare Leine ein topfartiges Gebilde nieder, das von einer üppig wuchernden Pflanze besetzt war, deren Ranken über den Rand des Behälters niederfielen.
Darauf zeigte Binche, zog den Hahn auf und legte den Schaft der Büchse an die Wange.
Sie zielte nicht lange, der Schuss krachte. Draußen flogen die Topfscherben sprühend nach allen Seiten.
»Brav!«, rief bewundernd Addy. »Ein Sapperlotsfrauenzimmerchen, dieses Binche – wird nicht nur eine brave Farmerin werden, auch eine Hausfrau, die in Zeiten der Not ihren Mann stellt!«
Franzl hatte, während sich die beiden anderen unterhielten, auf seiner Maultrommel unverdrossen weiter gedudelt. Als aber die Büchse an Binches Wange lag, da sperrte er seinen Mund mit einem Mal so gewaltig auf, dass seine Musik mit einem sehr unmelodischen Ausklang plötzlich verstummte.
»Sakra«, schrie er, als er des Treffers gewahr wurde, »wo hast denn du das Schiaß’n g’lernt?«
»I nun«, lächelte Binche, die noch rauchende Büchse an die Wand stellend, »wenn die Mannsleut in ihrer freien Zeit fast nichts anderes tun, als sich im Schießen üben, warum soll es denn eine Frauensperson bei Gelegenheit nicht auch ab und zu einmal versuchen?«
»Binche«, rief jetzt Franzl, sich erhebend und seiner Braut die Hand darbietend, »das kunnt’ ma g’fall’n – so ein tapfres Weiberl, das kann i akk’rat brauch’n.«
»Es war ein Prachtsschuss«, erklärte Addy, »auf den sich jeder Schütze etwas einbilden könnte. Binche, das habt Ihr wirklich brav gemacht!«
Binche lächelte still vor sich hin, füllte die Becher, welche die beiden Jäger nun erhoben und auf das Wohl Binches zusammenklingen ließen.
»Nur schad’ is um das schöne Pflanzerl«, sagte dann Franzl, mit einem nochmaligen Blick zum Ziel.
Auch Addy sah hinaus.
Die Wurzeln der Pflanze hingen frei in der Luft. Sie waren zwar teilweise noch von Erde umgeben, ruhten aber nur noch in einer dürftigen Bastverschlingung, die an einer dürren und steif gewordenen, etwa fingerdicken Flechte von dem Geäst des Baumes niederhing.
Binche legte den Schaft der Büchse an die Wange, zielte nicht lange und der Schuss krachte.
»Man wird das Gewächs nur in einen neuen Topf setzen müssen«, sagte Addy, »und da es ziemlich hoch hängt, wollen wir dem Binche, zum Lohn für den schönen Schuss, das beschwerliche Niederholen ersparen.«
Er langte nach seiner Büchse, für die er von jeher eine besondere Liebe und Sorgfalt an den Tag legte. Ihr zierlich geschwungener Schaft war mit allerlei silbernem Zierrat ausgelegt und die beiden Läufe von selten feiner Arbeit. Die Waffe hatte, zu damaliger Zeit noch eine Seltenheit, Perkussionszündung, die gegenüber anderen Flinten ein schnelles Feuern ermöglichte. Der Jäger rühmte an ihr, dass die Kugeln, beide Läufe zugleich abgeschossen, selbst auf größere Entfernung, stets in gleicher Höhe und auf Fingerbreite beieinander saßen.
Addy lud den abgeschossenen Lauf, machte sich schussfertig und prüfte den Stand der Sonne.
Er legte lächelnd an und im nächsten Augenblick war draußen die kaum fingerdicke Verbindung zwischen dem Baum und der Hängepflanze mitten entzwei, sodass die Letztere mit dumpfem Aufschlag zur Erde niederfiel.
Die beiden anderen hatten das Beginnen des Jägers mit größter Spannung beobachtet und brachen nun, wie aus einem Mund, in laute Rufe der Bewunderung aus.
»Sakra, man sollt’s nit glaub’n, dass so was überhaupt mögli’ is!«
»Ihr schießt einem ja, wenn es sein muss, eine Mücke von der Nasenspitze weg«, schrie Binche. »Nein so was!«
»Den schönsten Schuss, den i mein Lebtag g’seg’n hab’!«, rief Franzl ein ums andere Mal und warf Addy dabei fast neidische Blicke zu. Dann langte er nach seinem Becher, tat einen artigen Zug und sagte tief aufatmend: »Na, der Thayendanegeas, der soll uns nur kumm’n, wann er das Kuraschi hat – bei uns braucht’s ka Furcht, wann ma solchene Schütz’n und Schützinn’n hab’n!«
