Der Spion Band 1 – Die Schlacht bei Jena – 1. Kapitel
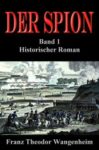 Franz Theodor Wangenheim
Franz Theodor Wangenheim
Der Spion
Band 1 – Die Schlacht bei Jena
Historischer Roman
Verlag von C. P. Melzer, Leipzig 1840
1. Kapitel
Der Herbstmonat des Jahres 1806 brachte schon ziemlich kalte Morgenluft. Darum hatte der alte Hauptmann von Wallen seine Pelzmütze ihrer Hülle von Walnussblättern entkleidet, die langjährige Freundin seines dünnhaarigen Hauptes tüchtig ausklopfen lassen und saß nun, mit derselben bedeckt, im geschnörkelten Lehnstuhl, dessen Überzug ein Dezennium vor dem Ausbruch des Siebenjährigen Krieges wie grüner Samt ausgesehen hatte. Auf dem mit großen Glasperlen ausgelegten Tisch vor dem Hauptmann lag die Zeitung, von deren grau-gelblichem Löschpapier man nur mit Mühe die Buchstaben unterscheiden konnte. Darum klemmte sich eine sehr einfache Brille über den Nasensattel des Veteranen aus dem Siebenjährigen Krieg. Trotz der Pelzmütze, welche auch in diesem Herbst mottenfrei sich den Walnussblättern entwunden hatte, saß der Hauptmann von Wallen in Uniform. Er trug niemals andere Kleider. An der linken Wade freilich waren einige Gamaschenknöpfe offen; aber an dieser Stelle war der Hauptmann bei Hochkirch stark blessiert worden und hatte einen sogenannten Wetterpropheten übrig behalten. In seiner Häuslichkeit machte er es sich bequem; warum sollte er das nicht? Aber wenn er den Braunen Hirsch besuchte – sein einziger Weg seit zwanzig Jahren – dann wurden die Knöpfe festgemacht und er schritt steif und drall durch die Straßen von Berlin.
In der Wohnung des Hauptmanns sah es reinlicher aus, wie in denjenigen so vieler alten Soldaten. Die einfachen Geräte waren spiegelblank gebohnt, die weißen Dielen des Zimmerbodens mit weißem Sand kraus bestreut, der Käfig des Sprossers mit reinlichem, grünen Papier durchzogen und, was noch mehr, die drei Hauspfeifen des Soldaten sahen aus wie neu, obwohl er auf Ehrenwort versicherte, dass er die Jüngste Anno zweiundneunzig gekauft habe. Das alles hatte einen ganz natürlichen Grund. Der Hauptmann von Wallen nämlich heiratete lange nach beendigtem Krieg die vaterlose Waise eines seiner treuesten Waffengefährten. Friederike von Schumann Sie war noch sehr jung; der Hauptmann jedoch hatte ihrem Vater auf dem blutgetränkten Bett der Ehre das Versprechen mit Hand und Wort gegeben, sie niemals zu verlassen. Und die Jungfrau reichte dem ehrlichen, blessierten Soldaten die Hand. Ja, Friederike lernte ihn lieben und die Ehe blieb nicht ohne Kindersegen; ein Töchterchen knüpfte die beiden Herzen unzertrennbar aneinander.
Der rührigen Hausfrau sorgliches Walten war im ganzen Haus auf den ersten Blick zu erkennen, und selbst das Äußere des Hauptmanns zeugte davon. Schneeweiß war die Unterbinde am Hals, schneeweiß der feine Strich, welcher oben aus der Weste guckte, der Schnurrbart nicht allein glatt gekämmt, sondern auch zierlich gedreht, wenn auch nicht militärisch, doch wie von Frauenhand mit liebender Sorgfalt. Die Zeitung aber war die stärkste Opposition dieses Schmuckes; denn kaum fand der Hauptmann einen lästigen Artikel, so fuhr er mit der hohlen Hand von oben her über den Mund, weg war Friederikes sorgfältige Künstelei und der Hauptmann kaute ärgerlich das lange Barthaar. Obwohl von Wallen ein hoher Sechziger war, so zeugte sein Gesicht, seine Gestalt von einer ehemaligen Mannesschöne; wie auch Falte aus Falte über Stirn und Wange lief, jene Frische hatte sich erhalten, die zuweilen den Neunziger noch mit Weiß und Rot schmückt. Aber von Wallens großes, blaues Auge, über welches sich nur dann und wann das faltige Augenlid wie eine Abendwolke über die sinkende Sonne herniederließ, dieses Auge, das so manches Mal begeistert flammte, wenn der große Friedrich zu Ruhm und Sieg führte. Es leuchtete noch zuweilen auf, als wollte es den alternden Leib an die frischmutige Seele des Veteranen binden.
Wie nun auch der alte Wallen in die Zeitung schaute, er las nichts. Ein unerklärliches Etwas schien die Brust des Veteranen zu bewegen, seine Gedanken schweiften anderswo, als in seiner nächsten Umgebung. Auch der Bart saß noch zierlich und die Hemdkrause und eben nestelte der Hauptmann an den Gamaschenknöpfen, als Friederike hereintrat. Noch immer eine schöne Frau! Das war das erste Bekenntnis eines jeden, der sie sah. Die gute Frau trug ihrem Mann das Frühstück auf, setzte sich ihm gegenüber, um dem lieben Alten mit freundlichen Worten das frugale Mal zu würzen. Er langte zu, stärkte sich am Inhalt des kleinen, spitzen Glases und ging sehr subtil mit seinem Schnurrbart um. Die Beiden, wie sie da einander gegenübersaßen, waren ein makelloses Bild der stillen Häuslichkeit und des Selbstgenügens. Auch Friederike hatte an diesem Morgen viele Sorgfalt auf sich verwandt; die beiden braunen Löckchen auf der hohen, weißen Stirn glänzten wie vor langen Jahren und das glatt nach oben gelegte Scheitelhaar zeugte in seiner Fülle von der rüstigen Munterkeit der werdenden Matrone.
Der Hauptmann hatte das Spitzgläschen zum dritten Mal geleert, zog das weiße Taschentuch aus der Uniform und fuhr, indem er den Mittelfinger damit bedeckte, aufmerksam genug über die schmalen Lippen, um seinen Bart nicht zu berühren.
»Es ist ja noch zu früh, lieber Mann«, versuchte ihn die gute Frau, deren großes, braunes Auge mit Wohlgefallen auf ihm ruhte, zurückzuhalten.
»Nein Riekchen«, entgegnete er, sich vom Lehnstuhl erhebend, »ich muss am Platz sein. Besser, dass ich auf den Minister warte, als er auf mich. Gib mir Hut, Degen und Stock. Sind meine Handschuhe schon bei dem Beutler gewesen?«
»Ei, freilich, lieber Mann. Sie sind weiß wie Schnee. Musst nur nicht sogleich damit an die Uniform kommen. Sieh doch! Sieh doch!«
»Wahres Soldatenblut!«, erwiderte der Veteran lachend. »Das hättest du den jungen Bürschchen vom Porte-Epée sagen müssen, denn die wissen die Hände nirgend anders als am Gefäß zu lassen; aber mir, Riekchen, mir! Na, du meinst es gut.« Er klopfte ihr zärtlich die Wange.
So mancher von meinen jungen Lesern wird sich höchlichst wundern, dass der alte von Wallen und seine Frau einander Beweise von Zärtlichkeit gaben; aber ich kann nach Pflicht und auf Gewissen versichern, dass dieses Paar von so unzähligen anderen sich auf die erfreulichste Weise unterschied. Da war niemals Unmut, Missmut, Verdruss oder wohl gar – nun, ich schweige, denn mein Buch könnte gewissen Leuten in die Hände fallen, die mich aus dem einzigen Grund, dass sie traurige, verletzende Wahrheit finden, verdammten.
Der Hauptmann war allein. Friederike holte eben aus dem großen Eichenschrank die verlangten Dinge. Obwohl der gute Alte nicht viel von Reflexionen hielt, so konnte er sich derselben doch in diesem Augenblick nicht erwehren. Doch in diese Reflexionen mischte sich ein bitteres Empfinden. Er war nahe daran, über den Bart zu fahren.
»Es ist nun einmal nicht anders«, sprach er dann mit Resignation. »Wer nicht alt werden will, der muss sich jung – Wallen, Wallen, welch dummes Zeug kommt dir zu Sinn! Hast das deinige im Feld getan, nun lass andere sich versuchen. Aber es ist doch gar zu arg, dass man antichambrieren soll. Wenn sie meiner nicht bedürften, würden sie nicht so oft den Laffen mit Goldtressen schicken. War es nur eine Ordonnanz, dass man doch wüsste, was militärisch heißt; aber es ist nun einmal in Berlin so geworden. Ehemals – Donnerw…, da bist du ja, Riekchen. Mein Hut hält sich wacker. Der Tausend, was klemmt er mir heute den Kopf! Das kommt von der Pelzmütze. Man sollte sich gar nicht verwöhnen.«
»Du bist kein Jüngling mehr.«
»War ich es noch!«, rief der Veteran, indem er kräftig den engen Hut in die Stirn drückte. »Hurra, Riekchen! Ich ein Dreißiger, und alle Minister der Erde könnten auf mich wie auf den Jüngsten Tag warten!«
»Wie du auf einmal so kriegerisch wieder aussiehst.«
»Es gibt was, ich sage dir, es gibt was.«
»Und …?«
»Und? Na und! Ich sage dir, es ist etwas im Werk.«
»Krieg?«
»Lebe wohl, mein Riekchen.«
»Böser Mann, so sage doch …«
»Nichts, nichts da. Lebe wohl.«
»Heinrich …«
»Riekchen, auf Parole, ich sagte es dir gern, aber …«
»Nur ein Wörtchen. Gibt es Krieg?«
»Adieu.«
Unaufhaltsam schritt der Hauptmann hinaus.
»Und nicht einmal einen Kuss, ehe du gehst?«, fragte sie mit leisem Vorwurf, der niemals bei ihm seine Wirkung verfehlte.
Der Hauptmann hielt, beugte den Kopf zurück, seine Frau küsste ihn.
Doch alle Mühe, ihn zum Redestehen zu veranlassen, war vergebens und nach wenigen Minuten sah ihn die gute, neugierige Frau über die Straße schreiten.
Die Frau Hauptmann sah noch durch die Fensterscheiben, sie folgte ihrem Mann mit den Augen, als eine zarte Hand sich auf ihre Schulter schmiegte und, indem sie sich wendete, berührten die frischen, schwellenden Lippen der schönen Luise ihren Mund.
»Darf er kommen, liebe Mutter?«, fragte die Jungfrau so innigen Tones, dass die Mütter nur mit einer bejahenden Kopfbewegung antworten konnte. Luise öffnete eines von den Fenstern, wie durch Zufall hatte sie das weiße Tüchelchen in der Hand behalten und die Glocke der Haustür verkündete den Eintritt eines Gastes. Bald hörte man den leichten Schritt auf der Stiege, es klopfte und der Kammergerichtsassessor, Doktor Weiß, ein junger, bildschöner Mann, begrüßte die beiden Frauen. Tief neigte er sich, als er der Mutter Hand mit dem Mund berührte, doch Luises Hand führte er zum Mund, sein Blick sprach zu ihr, und Luise verstand diese Sprache.
»Gnädige Frau«, begann der Assessor, nach dem sich Luise entfernt, um … nun, um die beiden nicht zu stören. »Es war längst mein sehnlichster Wunsch, mich bei Ihnen und dem Herrn Hauptmann ein zuführen. Ich schätze mich glücklich, dass mir das eine mindestens durch Ihre Güte vergönnt worden ist. Vielleicht sind Sie eine gütige Vermittlerin zwischen dem Herrn Hauptmann und mir.«
»Ich zweifle, Herr Assessor, dass meine Kraft da ausreichen wird. Luise kennt ihren Vater. Es tut mir leid, dass sie in keinem ihrer Briefe an Sie ihn treu beschrieben hat.«
»Briefe an mich?«
»Junger Herr, denken Sie, die Tochter des Hauptmanns von Wallen werde heimlich mit Ihnen korrespondieren? Ich bitte Sie, stellen Sie sich nie wieder so fremd. Ich habe eine sehr gute Meinung von Ihnen gefasst, billige die Neigung meiner Luise; aber sein Sie auch aufrichtig, damit ich die Meinung nicht aufgeben müsse.«
»Gnädige Frau, ich erkenne meine Torheit.«
»Nennen Sie es nicht so«, lenkte die Mutter mit gewinnendem Lächeln ein, »es ist eine tägliche Erscheinung. Freilich weiß ich nicht aus eigener Erfahrung davon zu sagen, doch kann ich mir das leicht denken. Die erste Liebe macht Mann und Frau am glücklichsten, wenn sie selbstisch sind und wie Geizige das Kleinod der ganzen Welt zu verbergen glauben. Ist es nicht so, Herr Doktor?«
»Wie gut Sie sind!«
»Ich bin zufrieden, wenn Sie das erkennen. Sie haben mir vieles zu sagen«, meinte Luise. »Wenn ich es auch erraten kann, so wünschte ich doch von Ihnen …«
»Ganz recht, gnädige Frau. Ich bin ein deutscher Mann, Preuße und spreche zu der Deutschen. Also gerade und frei. Doch bemerke ich Ihnen vorher: Ich liebe Luise. Möge sich mir in den Weg stellen, was da wolle, ich lasse nicht von meiner Liebe.«
»Das konnte ich mir denken, da ich Ihre Briefe las. «
»Nun wohl. Sie haben in mein Herz geblickt, mit umso großem Vertrauen spreche ich zu Ihnen. Es scheint, als wollte eine Krise in unserem gemeinschaftlichen Vaterland eintreten, eine Krise, die es nötig macht, dass der Frau der starke Mann zur Seite stehe, sie stütze, wenn der Sturm sie zu beugen droht. Ihre Luise und ich, meine Luise und ich … geben Sie mir …«
»Ein Wort, Herr Assessor. Ehe Sie in dieser Angelegenheit weitergehen, versuchen Sie an den Hauptmann zu kommen, an meinen Mann. Es kann Ihnen nicht schwerfallen. Wenn mich nicht alles trügt, so … doch will ich Ihnen weder Hoffnung machen noch Ihnen dieselbe rauben.«
»Schon zu öfteren Malen habe ich mich nach dem Herrn Hauptmann erkundigt. Die Auskunft, welche ich erhielt …«
»Kein Achselzucken, Herr Doktor. Ich kenne meines Mannes Denkart und er wird Ihnen seine wahre Meinung nicht vorenthalten. Sein Charakter ist in wenige Worte zu fassen: Er ist Soldat und Edelmann.«
»Das ist es eben, gnädige Frau, er ist Soldat und Edelmann, ich keines von beiden. Aus wahrhaftigem Mund weiß ich, dass der Herr Hauptmann vor Kurzem geäußert hatte: Nur ein Soldat, und wenn ihm Arm und Bein entzwei geschossen wären, sollte seine Luise zur Frau haben.«
»Das sieht ihm ähnlich …«
»Gute, beste gnädige Frau, vermitteln Sie …«
»Nimmermehr! Das, mein Herr, dürfte ich nur wagen, wenn ich auf meines Mannes Liebe und Achtung Verzicht leisten wollte. Ich bitte, nichts mehr davon. Nehmen sie jedoch die Versicherung, dass meiner Luise Wahl meinen Beifall habe. Entschuldigen Sie.«
Mit einem sehr förmlichen Knicks entfernte sich die Mutter. Ach, sie war ja so gut, so himmlisch gut; denn wie hätte sie sonst ihrer Tochter erlaubt, den Herrn Assessor an die Tür zu begleiten. Der aber dachte nicht daran, so schleunig das Haus zu verlassen. Auch bemerkte er nicht, dass Luise sich genähert hatte, sondern starrte durch das Fenster wie gedankenlos in die Straße hinein. Kein Atemzug ließ Leben in ihm vermuten. Luise verharrte ein Weilchen hinter ihm. Es wurde ihr so sonderbar, so beengend, dass sie ihn aus dem Verlorensein zurückrief. Auf ihren fragenden Blick wusste der Assessor nicht im Moment zu antworten; doch näherte er sich ihr, ergriff die weiße, zarte Hand und drückte diese an Brust und Mund.
»Sie wollen mir etwas verbergen«, unterbrach Luise das Schweigen. »Verbergen Sie mir nichts. Mag die Mutter Sie beschieden haben, wie sie wolle, meine Versicherungen sind in Ihren Händen und ich halte, was ich versprach.«
»Luise! Teure Luise!«, rief der Assessor. »Heute zum ersten Mal darf Mund gegen Mund sprechen, Auge zum Auge, und Ihre Hand ruht in der meinen. Was sind Buchstaben? Ich fühle, dass die Sprache arm sei, wenn nicht jede Regung unserer Herzen sich im Ton der Stimme, im leisesten Zug des Gesichtes zeigt oder im Auge spiegelt. Ich habe Ihre Briefe, Sie haben die meinen; aber das ist nichts. Von meinen Lippen, von meinen Herzen muss das Wort zu Ihrem Ohr, zu Ihrem Herzen dringen: Ich liebe Sie! Fühlen Sie doch ganz mit mir und alles um uns wird in nichts versinken. Wer will sich zwischen zwei Herzen werfen, die füreinander schlagen? Mögen sie doch kommen mit den verräucherten Adelsdiplomen, ich lache darüber, wenn Sie nur einfinden wie ich!«
Luise schwieg vor den letzten Äußerungen, doch sie machte unwillkürlich eine Bewegung mit der freigelassenen Hand, als wollte sie ihn am Weitersprechen hindern.
»Warum denn schweigen?«, erregte sich der junge Mann mehr und mehr, »warum denn schweigen, wo man mit allen Zungen der Erde die Beredsamkeit selbst an den Bettelstab bringen möchte? Ich hatte den Mut, mich Ihnen zu nähern. Sie … Dank, meine Luise, tausend, tausend Dank! Sie waren so gütig, oder wie soll ich denn sagen? Weg von dem gesuchten Wortschwall! Luise, du bist mein – trotz einer Welt voll Soldaten und Edelleute. Mir soll dich keiner entreißen!«
Nun erst wurde ihr klar, was den Assessor in solche Aufregung gebracht hatte. Bedenkt man, dass Luise fern von allem lauten Treiben der Welt erzogen war, so wird man ihr gern verzeihen, wenn sie vor dem heftigen Mann einen Schritt zurücktrat. Er aber hielt ihre Hand noch immer fest, folgte ihr und sein Blick hing in seliger Trunkenheit an den lieblichen Zügen, die, von holder Scham übergossen, er heute zum ersten Mal so ganz in sich saugen durfte.
»Luise«, hob er mit ungekünsteltem Zagen wieder an. Seine Stimme bebte. »Luise, ich halte den günstigen Augenblick im Fluge. Ich darf nicht von hinnen, ehe nicht Ihr süßer Mund Tod oder Leben über mich ausgesprochen hat. Gestehe ich denn vor Ihnen, was ich Ihnen so oft geschrieben habe … ach, Luise, warum musste ich vor Ihnen stehen? Wohl erblickte ich Sie eines Tages, und der Funken der Liebe entzündete mein Herz, wie auch der kühnste Schwung der Fantasie Ihr Bild mit allen Reizen schmückte, wie auch der Traumgott Sie im überirdischen Farbenreiz und ätherischen Formen vor meine Seele zauberte … eitler Tand war alles gegen die Wahrheit, die jetzt vor meinen Augen erblüht. Ich zweifle an mir selbst … Luise, überzeuge mich, dass ich lebe, wachend vor dir stehe, dass dieses Götterbild vor meinen Augen nicht in Rosenduft verschwimmen werde!«
»Teurer Mann!« Luise warf sich ihm an die Brust.
»Ja, es ist Wahrheit! Luise, diese Krone ihres Geschlechtes, liebt mich. Luise weiß nichts davon, dass ihr Geliebter noch etwas anderes bringen sollte als ein Herz voll Liebe und Treue. So fordere ich denn alles in die Schranken, was mich von meiner Liebe reißen will. Kühn will ich jedem Gegner ins Auge blicken. Mit dem Vorurteil der Stände kämpfe der feste männliche Wille den Vernichtungskampf! Jetzt zu deinem Vater.«
»Halt, mein Freund«, hinderte ihn Luise, »nicht jetzt, nicht in dieser Stimmung zu meinem Vater. Er ist so gut, so gut; doch reizen Sie ihn, dann meldet sich das soldatische Blut und er kennt keine Rücksicht, er kennt sich und uns nicht mehr. Versprechen Sie mir, nicht wahr, Sie tun es? Versprechen Sie mir, dass Sie zu gelegenerer Zeit, in einer anderen Stimmung meinen Vater aufsuchen wollen. Sie würden mich – nehmen Sie das Geständnis – Sie würden mich unglücklich machen, wenn mein Vater …«
»Er wäre grausam gegen seine Tochter?«
»Nein, ach nein! Aber ich könnte es nicht ertragen«, hauchte sie, »wenn ich Ihnen entsagen sollte.«
»Himmlisches Wesen!«, jubelte der Assessor, »habe Dank für dieses Wort! Von diesem Augenblick an bin ich der Sklave deines Winks. Gebiete und das Unerhörte will ich blindlings vollführen, um dir meinen Gehorsam zu zeigen! Jetzt will ich gehen, Luise. Soll ich von dir scheiden, ohne die Seligkeit des treulichen Du von deinen Lippen empfunden zu haben? Du meine Luise, ich …?«
»Du mein Wilhelm!«
Ha, wie glühten der beiden Lippen! In dem einen, dem ersten Kuss feierten der beiden Herzen flammend die Vermählung.
Eine sanfte Hand weckte die Liebenden aus dem seligsten Selbstvergessen – die Mutter stand zwischen ihnen. Sie zürnte nicht; nein, ihr freundlicher Blick erging sich in den schönen Zügen des jungen Mannes und der geliebten Tochter.
»Ohne es zu wollen«, begann sie ermutigend, »war ich Zeugin eures Geständnisses.
Gebe der Himmel, dass diese glühenden Herzen sich nicht in sich selbst verzehren! Gehen Sie nun, Herr Doktor, und nehmen Sie das Bewusstsein mit sich, dass Friederike von Wallen Sie gern zum Sohn annehmen wird. Dennoch muss ich Ihr Ehrenwort verlangen, dass Sie meinem Mann alles bisher Vorhergegangene verschweigen.«
»Wenn er jedoch, wie jeder gute Vater, heischt, dass ich mich zuvörderst der Liebe seiner Luise versichern soll?«
»Dann kommen Sie mit ihm zu uns.«
»So gebe ich Ihnen ohne Bedenken mein Ehrenwort …«
Ein ziemlich lautes Klopfen an der Tür unterbrach den Assessor. Der Mann, welcher hereintrat, schien sich verirrt zu haben. Er fragte in einem ziemlich fremden Jargon, ob hier nicht der Herr Hauptmann von Wallen wohne. Als man dieses bejahte, wünschte er den Hauptmann zu sprechen. Da nun dieses in dem Augenblick nicht angehen konnte, so versprach er, in einigen Stunden wiederzukommen.
»Eine sonderbare Figur«, äußerte die Mutter, als sie dem Fremden das Geleit gegeben hatte, »und noch sonderbarer im Benehmen. Ich bat um seinen Namen; denken Sie, er meinte, das täte nicht Not und husch war er auf der Straße. Der Mann sieht mir eben nicht danach aus, als wenn sich Wallen mit ihm lange unterhalten würde. Mein Mann ist allen Schwarzröcken feind, zumal denen, welche den Schulmeister verraten …«
Wieder klang die Tür. Es war der Hauptmann.
