Der Spion – Kapitel 34
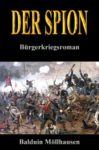 Balduin Möllhausen
Balduin Möllhausen
Der Spion
Roman aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, Suttgart 1893
Kapitel 34
Schluss
Ein Jahr und sechs Monate waren seitdem verstrichen und fertig standen alle von Martin Findegern in Angriff genommenen Bauten da. Bezahlt waren Architekten, Maurer, Zimmerleute und sonstige Gewerksmänner, bezahlt die Lieferanten und Gärtner. Nicht ein Sandkorn befand sich auf dem nunmehr mit einer vornehmen Mauer umgebenen stattlichen Besitztum, an welches kein anderer, als Martin Findegern, irgendein Anrecht besessen hätte. Nannte man ihn infolgedessen nun einen schwerreichen Mann, so ließ er es mit einer gewissen nachlässigen Würde über sich ergehen. Krehle allein vertraute er gelegentlich unter vier Augen an, dass solche Gerüchte lächerlich seien, dagegen seinem Unternehmen und dem Absatz der Waren nur förderlich sein könnten. In das villenartige Wohnhaus waren Houston und Margaretha schon vor Monaten als ein glückliches Paar eingezogen. Auf der anderen Ecke des Grundstücks erhob sich ein ähnliches Gebäude, in welchem die Kontore, die Räumlichkeiten für Zeichner und Modelle und eine sehr freundlich eingerichtete Wohnung für Markolf sich befanden. Ein geschmackvoll angelegter Garten verband die beiden Häuser gewissermaßen miteinander. Derselbe wurde durch einen breiten Weg in zwei Hälften geteilt. Die Einfahrt begrenzten zwei massive Pfeiler, welche das Riesenschild mit der leuchtenden Inschrift trugen. Wohlweislich hatte man dasselbe vor gänzlicher Fertigstellung der Bauten zur Probe angebracht, jedoch nur auf acht Tage. Dieser Zeitraum hatte genügt, die beiden alten Junggesellen zu überzeugen, dass die auf der Straße Vorübergehenden wohl die große Freude des Anblicks der prachtvollen Inschrift genossen, sie selbst dagegen, wenn in ihren Mußestunden auf der Veranda sitzend, durch die weiß gestrichenen Planken hätten hindurchsehen müssen, um sich einen ähnlichen Genuss zu bereiten. Eine ernste Beratung folgte, die von beiden Parteien mit gleichem Eifer und einer seltenen Einmütigkeit geführt wurde. Die Folge davon war, dass man noch gleichen Tages das Schild in das Sargmagazin zurückschaffte, wo Krehle ungesäumt ans Werk ging, die Rückseite mit derselben Inschrift, nur in etwas verändertem Farbenspiel, zu versehen.
Es war Sommer. In den beiden Vorgärten blühten, nach Martin Findegerns Angabe, Rosen und Vergissmeinnicht in Fülle. Die Verwaltung des Hauptgartens hatten dagegen Margaretha und Krehle in die Hand genommen. Im Hintergrund erhoben sich die reichbelebten, umfangreichen Werkstätten, die Räumlichkeiten für die Dampfmaschine, durch welche Sägen und Hobel in Bewegung erhalten wurden, und endlich ein vierstöckiges Magazin für die fertigen Möbel. Überall Klopfen, Hämmern, Fauchen, Schnarren, Kreischen und Schrammen. Überall Martin Findegern, nach wie vor in blauer Schürze, hohem schwarzem Hut und mit dem alles zugleich prüfenden, lustig blinzelnden Beobachtungsauge. In den Kontore vor den hohen Pulten standen Houston, Markolf und mehrere andere junge Leute, eifrig mit Schreiben und Rechnen beschäftigt. Krehle sollte auf Grund seiner Gelehrsamkeit ebenfalls in die Geschäftsführung eintreten, lehnte es aber bescheiden ab, nachdem er den ersten Blick in ein Kontobuch geworfen hatte und, wie er behauptete, eine volle Stunde später noch endlose Zahlenreihen vor seinen beleidigten Augen tanzten. Um nicht ganz unbeteiligt zu bleiben, unternahm er es mit großem Erfolg, täglich neue Artikel für englische und deutsche Zeitungen anzufertigen, in welchen er nach amerikanischem Muster die Erzeugnisse der Möbelfabrik von Martin Findegern, Houston und Gebrüder Durlach aller Welt als das Vorzüglichste und Berühmteste pries, was je unter menschlichen Händen hervorgegangen sei, und mit einer gewissen Berechtigung. Denn dieselbe Gewissenhaftigkeit, mit welcher Martin Findegern selbst die allerkleinsten Kindersärge herstellte, lässt er nun in dem noch immer wachsenden neuen Wirkungskreis walten.
Im Übrigen lebten die beiden alten Knaben nach wie vor in dem Schneckenhaus, wo ihre langjährigen Gewohnheiten durch nichts gestört wurden. Den Versuch, sie zur Übersiedlung in eines der neuen Häuser zu bewegen, wiesen sie sogar Margaretha gegenüber mit Entrüstung zurück. Zu glücklich und zufrieden fühlten sie sich zwischen ihren bemalten vier Pfählen. Da Martin nur noch aus Liebhaberei hin und wieder einen Sarg anfertigte, fand Krehle wenig Gelegenheit zum Lackieren. Mit umso größerem Fleiß widmete er sich dafür der Malerei und der Gartenbestellung. Trotz des engen Zusammenlebens und der zwischen ihnen vermittelnden freundlichen Einflüsse verbrachten sie ihre müßige Zeit abwechselnd im herzlichsten Einvernehmen und im bissigsten Hader. Beides war ihnen im Lauf der Jahre gleich unentbehrlich geworden.
Bei ihnen wohnte nur noch Fegefeuer, beide mit der gleichen Aufmerksamkeit bedienend und stets beflissen, die einander widersprechenden guten Lehren beider mit der gleichen Gemächlichkeit in das eine Ohr herein und zu dem anderen wieder hinaus gehen zu lassen. Für ihre Verpflegung sorgte Kleopatra aufs Beste.
Wie oft Margaretha zwischen ihrer überaus freundlichen Wohnung und dem Schneckenhaus hin und her wandelte, möchte schwer zu berechnen sein. Hier wie dort war sie der freundliche Hausgeist, welcher erquickendes, heiteres Licht und belebende Wärme über das ganze Grundstück verbreitete. Zuvorkommend pflichtete sie bei, wenn Krehle ihr würdevoll väterlich ans Herz legte, den zahllosen Seltsamkeiten seines verehrten Freundes, des Herrn Martin Findegern, gegenüber pietätvoll Nachsicht zu üben, und ebenso treuherzig versprach sie bei einer anderen Gelegenheit dem ehrlichen Tischleronkel, sich durch die endlosen Schrullen des Herrn Doktor Krehle nicht in ihrem günstigen Urteil über ihn beirren zu lassen, sondern ihn sowohl als Menschen wie als großartigen Künstler und Gelehrten zu achten und zu ehren. Zuweilen begegnete sie Martin auf ihrem Weg; dann war es eine Lust zu beobachten, wie beide, sie prangend in jugendlich holder Frauenanmut, er dagegen stolz in blauer Schürze und schwarzem Zylinder, ihre Umgebung eingehend besichtigten. Wusste Martin bei solchen Gelegenheiten den langjährigen Genossen fern, so ereignete es sich auch, dass er, wie einst bei Margarethas erstem Besuch im Sargmagazin, sich zu einer kleinen Vorlesung über Weltweisheit im Allgemeinen emporschwang.
»Das Schild da oben ist wirklich ein Staat«, hieß es immer wieder einmal, »der Grethe, nämlich deiner guten Mutter, würde das Herz vor Freude lachen, wäre es ihr vergönnt, nur einen einzigen Blick darauf zu werfen. Selbst der Herr Geheimrat möchte keinen Anstoß daran nehmen, dass die Namen seiner Kinder, als mit zur Tischlerinnung gehörend, auf dem Prachtschild verzeichnet stehen. Wer hätte das geahnt! Der Herr Geheimrat ebenso wenig wie ich, als er mir damals die vierhundert Taler schenkte.«
»Sie waren also dennoch geschenkt«, fragte Margaretha freundlich.
»Bless you, Kind, nachdem du es erraten hast, will ich es nicht länger bestreiten, und wenn ich es den hoffärtigen Landstreichern anders vorredete, so geschah es, weil es kein weiteres Mittel gab, ihnen das Geld in die Taschen zu spielen. Und schuldig war ich es ihnen, weil auf dem Geschenk ihres Vaters ein großer Segen ruhte, oder ich hätte es nimmer mehr so weit gebracht.«
»Bei unserem ersten Besuch fürchtete ich, dass nie ein auch nur annähernd erträgliches Verhältnis zwischen Ihnen und den beiden Jungen zu Stande kommen würde.«
»Das bezweifelte ich selbst, denn störrisch waren sie wie Hirnholz, auf welchem das beste Hobeleisen sich umlegt, und derohalben machte ich nicht viel Umstände mit ihnen. Bless you! Was wohl aus ihnen geworden wäre, hätte ich all sogleich um die Ehre gebeten, sie bis über die Ohren in einen Geldsack stecken zu dürfen, wogegen wir jetzt alle miteinander zufrieden sein können. Und euch ein richtiger Onkel zu sein, gelobte ich mir bei eurem ersten Anblick. Denn als ich euch vor mir sah und in jedem eurer Gesichter, namentlich in deinen mutwilligen Augen, etwas von der Grethe, meiner einzigen Schwester – Gott habe sie selig – entdeckte, da war es mir, als hätte eine warme Hand sich auf mein Herz gelegt und eine vertraute Stimme mir leise zugeraunt: ›Du, Martinbruder‹, so nannte sie mich nämlich in ihrer Gutherzigkeit, ›du, Martinbruder, ich schickte dir meine Kinder. Um der Liebe willen, die zwischen uns beiden nie einen Bruch erlitt, nimm dich ihrer an, auf dass ich ruhig schlafe.‹ Ja, ja, das meinte ich zu vernehmen und ich gelobte abermals im Stillen feierlich, für euch zu sorgen. Da magst du dir vorstellen, wie mich es wurmte, als die Schlingel sich ihrem Mutterbruder gegenüber auf die Hinterbeine stellten. Doch das ist nun vorbei, und wenn der Herr Doktor Krehle hinübergeht – trotz seiner Verdrehtheiten und des verruchten Mundwinkels«, hier warf Martin zu Margarethas heimlichem Ergötzen den üblichen argwöhnischen Blick um sich, »wird ihm im Himmel jedenfalls ein feines Plätzchen, wohl gar ein Atelier angewiesen werden – kann ich ihm mit gutem Gewissen einen herzlichen Gruß an die Grethe mit auf den Weg geben. Auch soll er ihr bestellen, sie möchte sich der ewigen Seligkeit ungestört gründlich erfreuen, dieweilen ich für ihre Kinder wie ein richtiger Vater gehandelt habe; da erfährt es auch der Herr Geheimrat.«
»Ja, das taten Sie, Onkel Bless you«, beteuerte Margaretha aus vollem Herzen, ihn mit einer Bezeichnung belegend, die aus ihrem Mund jedes Mal wie süße Musik zu seinen Ohren drang, »Sie wissen aber auch, mit welcher unendlichen Dankbarkeit …«
»Unsinn, Grethe. Oder meinst du gar, ich hätte nicht selbst meine Lust daran gehabt, wie ihr alle drei gut eingeschlagen seid? Oder ich sei blind dafür, dass aus euren Angesichtern ein ganzer Berg Zufriedenheit und Glückseligkeit hervorleuchtet?«
»Nur der arme Markolf …«
»Ja, der arme Markolf«, wiederholte Martin einfallend. Die rechte Hand hinter der Schürze hervorziehend, reckte er das Spitzbärtchen nachdenklich auf. »Hm, der arme Junge mit seinem Herzeleid ist mir doppelt ans Herz gewachsen. Aber glaube mir, die Zeit hilft ihm auch über sein Herzeleid hinweg. Ich kenne das nämlich – der Herr Doktor hat freilich keinen Begriff von Liebesangelegenheiten – denn auch ich war einmal dicht vor dem Heiraten. Als es nichts wurde, ließ ich mir deshalb kein einziges graues Haar wachsen, das sagte ich dem Herrn Doktor wohl tausendmal. Und ein anderer ist Markolf bereits geworden, das lässt sich nicht leugnen. Was die Tischlerei und das Malen anbahnten, das vollendet die Geschäftsführung, die ihn sowohl wie deinen guten Mann nicht viel zu Atem kommen lässt. Ich sehe es noch kommen, dass er sich über kurz oder lang ebenfalls nach einer rechtschaffenen Hausehre umtut.«
Margaretha sann nach. Plötzlich erhellten ihre Züge sich zu einem schalkhaften Lächeln, worauf sie lebhaft fragte: »Weshalb nahmen Sie nicht einen zweiten Anlauf zum Heiraten, wenn es mit dem ersten nichts wurde?«
Martin blieb stehen. Listig blinzelnd sah er in Margarethas lachende Augen, indem er anhob: »Leicht gesagt. Was hätte aber da aus euch werden sollen? Und dann der Herr Doktor Krehle? Bless you! Der mit seinen Verdrehtheiten und dem gänzlich unpraktischen Sinn wäre trotz seiner Großartigkeit verhungert und verkommen. Keinen zweiten hätte er gefunden, der mit ihm fertig geworden wäre.« Abermals spähte er scheu um sich, fuhr aber in demselben Atem fort: »Und ferner, Grethe, nachdem ich einmal ein ordentliches Eigentum erworben hatte, widerstrebte es mir, mich von jemand beherrschen zu lassen, weder von einer Frau noch von irgendeinem anderen Menschen. Nicht einmal von dem Herrn Doktor oder gar von dir. Höchstens von der Kleopatra, wenn es sich um ein Sonntagsgericht handelt. Hier bin ich Herr und will es auch bleiben.«
Margaretha blickte zur Seite, um ein Lächeln des Mutwillens zu verheimlichen. Wusste doch keiner besser als sie, unter wessen Joch allein nicht nur der ehrliche Onkel Bless you, sondern auch Krehle, Kleopatra, Fegefeuer und endlich Hobel sich willenlos beugten.
Langsam zwischen den verschiedenen Baulichkeiten einherschreitend, waren sie in den neuen Garten eingetreten. Ringsum ertönte Klopfen, Hämmern, Fauchen, Schnarren, Knirschen und Schrammen. Vor ihnen blühten Rosen, Levkojen, Lilien und Balsaminen. Wie in den Fabrikräumen regte es sich auch hier in der kleinen Werkstatt der Natur. Bienen im grauen Arbeitskleidchen, pelzverbrämte Hummeln, funkelnde Goldkäfer und schillernde Falter, alle leisteten ihr Bestes. Der Tag war ja noch so lang und so warm. Hoch stand die Sonne, der Himmel war blau; in schwarzen Wolken entstieg der Rauch dem aus dem Maschinenhäuschen emporragenden eisernen Schornstein.
Vielleicht an demselben Tag, wohl gar zu derselben Stunde besichtigten Maurus und Lydia ebenfalls ihre aus Schutt und Trümmern neu erstandene Besitzung. Auch hier herrschte geräuschvolles Leben und Treiben, nur anderer Art, indem der Dampfkraft ein größeres Recht eingeräumt worden war. Zu dem Poltern und Stöhnen der Maschinen gesellte sich auf der einen Seite das lustige Klappern und Schnurren des Mühlenwerks, während auf der anderen große Kreissägen sich ihren Weg schnarchend durch schwere Baumstämme bahnten. Dazwischen lag freundlich einladend das nach dem Plan des niedergebrannten neu erbaute Wohnhaus mit seinen lustigen Räumen und den an der Vorderwand emporstrebenden Ranken der Kletterrose. Bevor Maurus und Lydia die zur Haustür hinaufführenden Stufen erstiegen, sahen sie noch einmal zurück. Ihre Blicke fielen auf das verwitterte, rauchgeschwärzte Schild, welches noch immer den Namen Rutherfield trug.
»Es steht nicht im Einklang mit den anderen Einrichtungen und verdiente, erneuert zu werden«, meinte Lydia nachdenklich.
»Zum Herbst«, antwortete Maurus heiter zustimmend, »bis dahin haben Onkel Martin und Krehle ihren Besuch zugesagt. Ich glaube, die beiden alten Sonderlinge schliefen nicht ruhig in ihren Gräbern, wäre es dem Onkel Martin nicht vergönnt gewesen, eigenhändig ein neues Schild anzufertigen, dem Doktor, nicht die Inschrift nach seinem eigenen Geschmack auszuführen.«
Auf Lydias schönem Antlitz gelangte ein herziges Lächeln zum Durchbruch, ein Lächeln, in welchem heiliger Seelenfriede und ungetrübtes reines Glück sich spiegelten.
Es war Mittagszeit. Leute gingen auf der Straße vorüber. Die freundlich vertraulichen Grüße, welche sie herüber sendeten, bewiesen, dass, wie einst Rutherfield, nun Maurus und seine anmutige junge Frau als treue Freunde und Berater in dem neu aufblühenden Städtchen geehrt, geachtet und geliebt wurden.
*
Jahr auf Jahr ging dahin, und auch der Tag nahte, an welchem ich zum letzten Mal das Wort ›Ende‹ unter eine mühevolle und daher doppelt liebgewonnene Arbeit schrieb, die Feder der müden Hand entsank. Jahr auf Jahr, und mit jedem neuen wuchs das Heer der verschiedenartigsten Gestalten, die sich während des regen geistigen Verkehrs mit ihnen vor meinen Blicken gleichsam verkörperten. Viele, sehr viele schauten befriedigt beglückt darein. Andere sandten mir freundliche Grüße zu. Wieder andere wendeten sich feindselig ab; sie konnten nicht verzeihen, dass ich in dem von mir beherrschten kleinen Reich dichterischen Schaffens Gerechtigkeit walten ließ. Diese versanken vor dem rückwärts spähenden Auge in Schatten. Ich hatte nichts mehr mit ihnen zu tun. Jenen dagegen – mögen sie mir nur traumhaft vorschweben – schenkte ich gern immer wieder meine herzliche Teilnahme. Indem wir uns auf diesem Feld voneinander trennten, rief ich bedauernd jeder Einzelnen ein letztes Lebewohl zu. Keine mochte ich übersehen oder vergessen; keine, die noch des Tageslichts sich erfreut, keine, die von einem unerbittlichen Geschick verfrüht in die Erde gebettet wurde.
*
Oliva, diese wunderbare Doppelgestalt! Als ich ihr vor beinah vier Jahrzehnten begegnete, auf den westlichen texanischen Grasfluren war es, da umkreiste sie, sprühend vor Jugendlust, als ebenso gewandtes, wie verwegenes tolles Bürschchen auf ihrem flinken Steppenpferd eine große Rinderherde. Ich erstaunte über die Geschicklichkeit, mit welcher sie den schweren Dienst eines Vaqueros versah, über die Klugheit und das Selbstvertrauen ihres Auftretens im Kreis verwilderter Kameraden.
Damals ahnte niemand, sie selbst am wenigsten, was ihr bevorstand, welche furchtbare Erfahrungen sie noch über sich ergehen lassen sollte. Doch wenn das Geschick es sich über Jahre hinaus zur Aufgabe gemacht zu haben schien, sie grausam zu verfolgen, so brachen endlich die Zeiten an, in welchen sich alles vereinigte, in reichem Maß zu sühnen, was schon im zartesten Kindesalter an ihr verbrochen wurde.
Sie war noch nicht lange als Herrin in Nicodemos Haus eingezogen, als dieser, fortgesetzt ängstlich auf ihren Seelenfrieden bedacht, eine günstige Gelegenheit zum Verkauf seines toten und lebenden Eigentums benutzte. Er erfüllte ihr damit einen heimlich gehegten großen Wunsch. Von dort zogen sie nach New Mexiko an den Rio Grande, wo es Nicodemo gelang, die Besitzung des Vaters Olivas, wenn auch nicht im ganzen Umfang, käuflich zu erwerben. Wohl atmete Oliva auf den Stätten ihrer frühesten Kindheit freier, wohl gewährte es ihr innige Befriedigung, die dort noch lebenden traurigen Erinnerungen an ihre toten Eltern mit freundlichen Lichtern zu durchweben. Ein Anflug von Schwermut wollte nicht ganz aus ihrem Wesen weichen. Zu sehr war sie geneigt, die Tage ihres abenteuerlichen Feldlebens und die auf dieselben entfallenden grauenhaften Ereignisse, ob wachend, ob träumend, sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Und doch begriff sie, wie Nicodemo ihr bei jeder Gelegenheit liebevoll erklärte und beteuerte, dass, ohne die gleichsam krankhafte Sucht nach Vergeltung befriedigt zu haben, eine ihr ganzes irdisches Dasein vergiftende Öde in ihrem Inneren zurückgeblieben sein würde. Erst als ein junges Leben sich unter ihren Augen kräftig entwickelte, mütterliches Glück, mütterliche Pflichten und Sorgen ihr ganzes Sein erfüllten, wich der letzte Schatten aus ihrem Gemüt. Es rief den Eindruck hervor, als ob jene Tage und Ereignisse in die fernste Vergangenheit zurückgetreten wären. So kostete es sie schließlich keine Überwindung mehr, in der Unterhaltung mit anderen ihrer und Nicodemos den Unionstruppen geleisteten Dienste freimütig zu gedenken. Vom Spion Kampbell sprach sie wie von einer dritten Person. Die heiße Dankbarkeit, mit welcher sie Nicodemo ergeben war, der mit seiner unerschütterlichen Treue nie von ihrer Seite wich, stets seine Hand schirmend über ihr hielt, sie zum Schluss vor einer Handlung bewahrte, die in ihren Folgen eine verhängnisvolle Wirkung auf ihr Gemütsleben hätte ausüben müssen, diese nie erkaltende Dankbarkeit offenbarte sich in dem unermüdlichen Bestreben, seine Wege, wie sie es einst gelobte, mit Blüten zu bestreuen, ihr beiderseitiges Glück mit den lichtesten Farben zu schmücken.
*
Daisy, Daisy! Und nunmehr zu dir, du holde bräunliche Wiesenblume der Council-Bluffs!
Weshalb zögert meine Hand, während ich an dieser Stelle deiner noch einmal gedenke? Weshalb trübt sich mein Blick, indem ich deine schlanke Gestalt mir noch einmal vergegenwärtige?
Daisy, Daisy! Du liebliches Naturrätsel!
Als ich Dich kennen lernte, befandest du dich noch nicht lange in der treuen Obhut des Missionars und seiner edelgesinnten Gattin. Dreizehn Jahre mochtest du erst zählen, und dennoch gelang es der vorauseilenden regsamen Fantasie leicht, sich ein Bild deiner jungfräulichen Blüte zu schaffen. Es war damals Winter; der Missouri trieb mit Eis. In Gesellschaft verwitterter Jäger und Fallensteller hauste ich auf der Pelztauscher-Station. Vielfach führte der Weg mich zu der Mission hinauf, um in dem freundlichen Familienkreis Mac Kinneys ein Stündchen zu verbringen. So oft ich kam, fielst du mir auf mit deiner natürlichen kindlichen Anmut, der zarten Hautfarbe und den großen zaghaften Gazellenaugen. Ich konnte dich nicht ansehen, ohne einer jungen Antilope zu gedenken, der ich grausam die Mutter raubte. Auch sie blickte so bange und schüchtern zu mir auf, folgte aber demjenigen, der ihr das denkbar größte Leid zufügte, zutraulich auf Schritt und Tritt, um sehr bald ohne einen Laut der Klage zu sterben.
Daisy, Daisy! Dir war es nicht beschieden, weit über die Grenze eben erwachter Jungfräulichleit hinauszuschauen. Und doch könntest du heute noch leben zu deinem Glück und zu dem anderer, aber es sollte nicht sein. Deine unergründliche, keine Schranken kennende Liebe führte dich in den Tod.
Daisy, Daisy!
Fern schläfst du auf einsamer Stätte. Wie oft entkeimte seitdem frühlingsgrüner Rasen deiner Decke! Wie oft tobte der wilde Präriebrand über dich hinweg! Wie oft fegten erstarrende Winterstürme den Schnee oberhalb deiner Asche in Bänke zusammen!«
Daisy, Daisy!
Du sahst es nicht, Du hörtest es nicht. Die deinen Grabhügel umfriedenden Palisaden sind längst verwittert und verbrannt, dem Erdboden gleich geworden ist der kleine Hügel selbst. Aber der Stein, welchen Markolf und sein Freund Andrieux dorthin schafften und dir zu Häupten aufstellten, gibt fernerhin Kunde von dir. Daisy steht eingemeißelt auf der geglätteten Seite des rauen Granitblocks. Ein ähnlich hergestellter Tomahawk, sich kreuzend mit einer Sternblume oberhalb des Namens, verrät deine Abstammung und warnt die Eingeborenen, die Ruhe einer Toten zu stören. Möchten auch die Hickorybäume von der Axt der westlich vordringenden Ansiedler pietätvoll verschont geblieben sein, auf dass sie im Sommer dein letztes Heim freundlich beschatten, aus ihrem Gezweig die befiederten Sänger alljährlich ihre süßesten Lieder zu dir in die Erde hinabsenden und in deine seligen Träume verflechten.
Daisy, Daisy!
Sanft und ungestört schläfst du der Ewigkeit entgegen. Ist es aber den Sterblichen vergönnt, auch nach ihrem Tod noch in Beziehung mit allem zu bleiben, was ihnen auf Erden lieb und teuer gewesen, dann umschwebt deine reine Seele gewiss oft die Stätte, auf welcher ein gebeugter Mann sein Herz zu dir in die Erde bettete.
Ende

