Felsenherz der Trapper – Teil 10.6
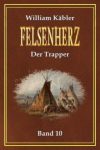 Felsenherz der Trapper
Felsenherz der Trapper
Selbsterlebtes aus den Indianergebieten erzählt von Kapitän William Käbler
Erstveröffentlichung im Verlag moderner Lektüre GmbH, Berlin, 1922
Band 10
Das Geheimnis des Gambusinos
Sechstes Kapitel
Der Angriff auf das Flachboot
Der doppelte Knall scheuchte eine Krähenschar auf, die in einer nahen Kiefer genächtigt hatte.
Krächzend strichen die Vögel über den Fluss hin. Kaum waren sie verschwunden, als vom Nordufer ein Baumfloß, das dort im Schatten wie einige zufällig angetriebene Urwaldriesen gelegen hatte, abstieß und scheinbar unbemannt auf das Südufer zuhielt. Der Trapper hatte zunächst beabsichtigt gehabt, sofort nach den Schüssen, die ja das Rohr getroffen und die Insassen des Flachbootes daher nachdrücklich gewarnt haben mussten, aus der Eiche wieder herabzuklettern und die Grotte schleunigst aufzusuchen.
Als seine scharfen Augen jedoch das Floß bemerkten und er weiter feststellte, dass dieses durch acht schwimmende Apachen mithilfe von Lassos gelenkt wurde, blieb er auf dem Baum, wo er sich durchaus sicher fühlen durfte, da infolge des vielfachen Echos, das seine Schüsse hervorgerufen hatten, niemand herausfinden konnte, wo sie gefallen waren.
Er beobachtete nun, wie das Floß, in dessen Baumkronen so ohne Zweifel eine Menge Apachen steckten, die Richtung auf jenes Schilfrohrfeld nahm, in dem das Flachboot verborgen war.
Das Mondlicht machte es ihn leicht, auch die weiteren Vorgänge genau zu verfolgen. Er gewahrte jetzt auf dem Deck des plumpen Bootes eine Bewegung, sah dunkle Schatten hin- und hergleiten. Dann stieß von dem Fahrzeug ein großes Kanu ab, schoss durch das Rohr in den Fluss hinaus.
Navajo saßen darin – an die vierzehn Krieger. Sechs ruderten. Die Übrigen knieten. Und diese begannen nun auf die schwimmenden Apachen zu schießen.
Die Apachen tauchten blitzschnell unter.
Und ebenso plötzlich zuckten aus den Baumkronen des Floßes feurige Streifen auf – Schüsse, die den Navajo galten.
Eine ganze Salve war es. Und die Wirkung blieb nicht aus.
Drei Navajo stürzten über Bord. Andere sanken getroffen über den Rand des Kanus, das sofort Wasser schöpfte und halb volllief.
Die unverwundeten Navajo, dauernd von dem Floß aus beschossen, ließen sich in den Fluss gleiten und versuchten das Flachboot wieder zu erreichen. Inzwischen war jedoch bereits vom Ufer aus eine zweite Abteilung Apachen an das schwerfällige Fahrzeug herangeschwommen und hatte sich an Bord geschwungen, hatte Harzfackeln angezündet, deren roter Lichtschein das nun folgende Morden grell beleuchtete.
Felsenherz hatte hier im Westen schon so mancher Kampfszene beigewohnt.
Aber dieses Bild, wie die im Schilfrohr steckenden Navajo einzeln durch Kugeln und Pfeile abgetan wurden, erfüllte ihn mit solcher Abscheu, dass er wiederholt die bereits wieder geladene Büchse hob, um von den blutgierigen Apachen ein paar besonders mordlustige Gesellen niederzustrecken.
Stets ließ er die Waffe wieder sinken. Denn was hätte es für einen Zweck gehabt, sich hier in die Zwistigkeiten der Rothäute einzumischen? Er hätte vielleicht dabei sein Leben aufs Spiel gesetzt. Und das waren weder die Navajo noch die Apachen wert.
Anders wäre es gewesen, wenn er den Landsmann Gottlieb Bulle dort drüben auf dem Flachboot in einer besonders gefährlichen Lage bemerkt hätte. Doch der Zwerg schien sich bereits vorher ebenso wie sein Gefährte mit dem tiefen Bass in Sicherheit gebracht zu haben.
Die Mordszene war vorüber. Felsenherz sah, dass die Apachen das plumpe Fahrzeug nochmals gründlich durchsuchten.
Eins fiel dem Trapper jetzt auf. Chokariga hatte doch gemeldet, dass die Navajo Wathama, den Unterhäuptling, auf dem Flachboot als Gefangenen bewachten. Wo war Wathama geblieben? Sollten die Navajo ihn in dem langen Kanu gehabt haben? Sollte er, als dieses schließlich völlig umgeschlagen war, gefesselt im Fluss versunken sein? Felsenherz konnte sich über diesen Punkt jetzt keine Gewissheit verschaffen. Jedenfalls aber stand das eine außer Zweifel: Die Apachen hatten auf dem Flachboot keine lebende Seele mehr vorgefunden!
Jetzt begannen sie, die im Inneren des Fahrzeugs aufgestapelten Waren an Land zu schaffen, nachdem sie das Flachboot näher an das Ufer gezogen hatten.
Sie zündeten noch mehr Fackeln an, und aus ihrem ganzen Benehmen ging deutlich hervor, dass sie weder mit der Anwesenheit des blonden Trappers und seiner beiden Geführten an dieser Stelle der Guadalupe-Berge rechneten noch das Verschwinden ihres Oberhäuptlings bisher irgendwie ungünstig gedeutet hatten.
Dann jedoch erschall plötzlich im Inneren des Flachbootes ein so durchdringendes Angstgebrüll, dass die sämtlichen an Deck und am Ufer befindlichen Roten einen Moment wie gelähmt dastanden.
Nun stürzten aus der einzigen Luke fünf, sechs Krieger, einander stoßend und drängend, hervor. Ihnen folgte eine dichte, weiße Qualmwolke, die an Stärke schnell zunahm und vom Wind träge gegen den Uferwald gedrückt wurde.
Jeden Augenblick mussten nun wohl auch die Flammen des im Inneren offenbar brennenden Fahrzeugs aus der Luke hervorschießen.
Nein – keine züngelnden Flammen waren es, die jetzt noch den Schreck der Rothäute vermehrten.
Zischend fuhr aus den hellgrauen Qualmwolken ein Funken sprühendes Etwas in die Mondnacht hinauf, zerplatzte gerade über dem Flachboot und streute einen Regen farbiger, feuriger Funken aus, die sich langsam zum Ufer herabsenkten.
Felsenherz beobachtete sprachlos vor Staunen diesen hier in der Wildnis gewiss recht seltsamen Zwischenfall.
Wo hatte wohl dieser etwas rätselhafte Gottlieb Bulle eine Rakete herbekommen? Und wer hatte diese Rakete abgefeuert?
Doch zu solchen Erwägungen blieb dem jungen Trapper jetzt keine Zeit.
Anderes gab es zu sehen, das ihm ein leises Lächeln entlockte: die Flucht der Apachen vor dieser Rakete und ihrem bunten Funkenregen, eine Flucht, die vollständig einer allgemeinen Panik glich.
Alles riss aus – alles! Gegen sechzig Apachen waren im Moment vom Ufer und vom Deck des Flachbootes wie weggefegt.
Die bunten, feurigen Funken der Rakete waren längst erloschen. Der aus dem Inneren des Fahrzeugs hervorragende Qualm wurde immer schwacher.
Zehn Minuten darauf wagten sich ein paar Krieger aus dem Uferwald wieder hervor, jedoch nur in der Absicht, die bereits an Land gebrachten drei Holzkisten weiter wegzuschaffen.
Eiligst tauchten sie mit den Kisten im Waldesdunkel unter, und nichts verriet dann mehr dem einsamen Lauscher auf der Eiche, dass noch Apachen hier zurückgeblieben seien.
Nach einer halben Stunde kletterte Felsenherz daher vom Baum vorsichtig herab und schlich der Halbinsel und der Grotte wieder zu.
Diese war von der jetzigen Liegestelle des Flachbootes etwas über dreitausend Meter entfernt. Dieser Zwischenraum schien den Apachen genügt zu haben, ihre abergläubische Angst vor dem Fahrzeug des buckligen Weißen zu überwinden, denn zu Felsenherz nicht geringem Schreck erblickte er, als er sich nun dem Steinkoloss der Halbinsel näherte, einige zehn lodernde Lagerfeuer gerade dort, wo sich vor der die Landseite der Halbinsel beschattenden Gruppe von Riesentannen eine Terrasse ohne viel Baumwuchs nach Süden zu erstreckte.
Auf dieser Terrasse, kaum achtzig Meter von den Riesentannen entfernt, lagerten jetzt die Apachen.
Felsenherz hielt es für seine Pflicht, deren Treiben eine Weile zu beobachten.
Da sie sich recht sorglos zeigten und noch nicht einmal Wachen aufgestellt hatten, konnte er hier abermals eine uralte Blutbuche, deren oberer Stamm schief nach Osten zu gewachsen war, erklettern und so einen vollen Überblick über das Lager gewinnen.
Er zählte hier nicht weniger als 200 Krieger, die in dichten Gruppen um die zehn Feuer herumstanden und lebhaft miteinander sprachen.
Die Pferde wurden weiter nach Osten zu auf einer Waldlichtung von weiteren zwölf Apachen bewacht, die dort ebenfalls zwei Feuer brennen hatten.
Die Aufregung der Rothäute konnte nur einen Grund haben. Das lange Ausbleiben des Oberhäuptlings hatte die Krieger jetzt doch besorgt gemacht!
Felsenherz hatte genug gesehen. Er verließ die Buche und schlich im Bogen auf die Riesentannen zu, erklomm den Zickzackpfad zur Grotte und traf hier mit Chokariga zusammen, der ebenfalls erst vor wenigen Minuten von einem abermaligen Spähergang zurückgekehrt war.
»Mein Bruder Harry hat das Lager beobachtet«, sagte der Comanche leise. »Wir dürfen hier nicht bis zum Morgen bleiben. Sobald es hell wird, werden die Apachenhunde wie die Bienen überall umherschwärmen und den Großen Bär suchen. Zu leicht können sie uns dann hier entdecken.«
»Chokariga spricht nur meine Gedanken aus«, bestätigte dies der Trapper mit einem Kopfnicken.
»Sancho und ich haben den Pferden bereits die Hufe mit Decken umwickelt«, fügte der Häuptling hinzu.
»Mein Bruder mag den Großen Bär auf die Schulter nehmen. Der Gambusino wird die Pferde hinabführen, und Chokariga will das Lager beobachten. Wenn wir die Pferde gleich um die Ecke der Halbinsel herum in den Fluss bringen, können wir schwimmend das Ostufer des Pecos erreichen.«
»Mein roter Bruder hat das Richtige vor!«, erklärte Felsenherz kurz. »Brechen wir also auf!«
Da die Apachen noch immer in erregter Unterhaltung um die Feuer herumstanden, war die Flucht aus der Grotte durchaus nicht schwierig, zumal das unvermeidliche Poltern einzelner durch die Pferde auf dem Zickzackpfad losgerissener Steine durch das Brausen der um die Halbinsel herumschießenden Wasser und durch das Rauschen der vom Nachtwind geschüttelten Bäume übertönt wurde.
Alles schien gut zu gehen. Schon waren die drei Pferde – auf Felsenherz’ Braunen war der geknebelte Große Bär festgebunden – in den Fluss geführt, schon hatte der Trapper den Comanchen herbeigeholt. Schon stiegen nun auch diese beiden in das Wasser hinein, da kam im hellen Mondlicht um die Halbinsel jenes lange Kanu der Navajo herbeigeschossen, in dem zwölf Apachen hockten, von denen sechs ruderten.
Sancho, der die Pferde am Zügel hatte und bereits schwimmen musste, weil das Ufer sehr abschüssig und der Fluss sehr tief war, wollte schleunigst in den Schatten der Felswand zurückkehren.
Die Strömung hatte ihn jedoch schon erfasst, und so trieb er mit den Tieren dem Kanu gerade entgegen.
Der Trapper und Chokariga hatten im Moment die ganze Größe der hier drohenden Gefahr erkannt.
Das Kanu durfte ihnen den Fluchtweg über den Pecos nicht versperren. Die Apachen mussten vertrieben werden.
Sie hatten ihre Büchsen bereits in die Wurzelstauden kleiner, losgerissener Bäume gehängt, damit sie diese vor Nasse schützten. Die Bäume hatten sie vor sich herschieben wollen.
Gerade als ein Apache im Kanu den Gambusino und die drei Pferde bemerkt hatte, aufsprang und einen Alarmruf ausstoßen wollte, knallte Felsenherz’ Büchse.
Der Apache stürzte rückwärts ins Wasser.
Da feuerte auch Chokariga bereits.
Beide Läufe seiner Büchse schickten das verderbliche Blei zum Kanu hinüber, und zwei weitere Krieger fielen über Bord.
Als jetzt auch Felsenherz noch einen Vierten niederstreckte, sprangen die anderen ins Wasser, tauchten und erreichten eine Ansammlung von Treibholz an der Spitze der Halbinsel.
Der Comanche war schon mit langen Stößen hinter dem Kanu, erwischte es noch glücklich, schwang sich über den Rand und warf von hier rasch sein Lasso dem kleinen Sancho zu. Auf diese Weise konnten die drei Gefährten schon nach wenigen Minuten mit dem Kanu ihre Flucht fortsetzen.
Die Apachen drüben auf dem Treibbolzberg stimmten darauf ein so gellendes Wutgeheul an, dass die im Lager befindlichen Krieger, die infolge des vielfachen Echos sich bisher nicht recht einig gewesen, wo die vier Schüsse gefallen waren, nun in hellen Scharen zum Fluss hinabstürmten.
Doch die drei Flüchtlinge in dem Kanu, hinter dem die Pferde ruhig schwammen, waren schon bis zur Mitte des Pecos gekommen und verschwanden hier hinter einem der zahlreichen Felseninselchen, die im Stromgebiet des Pecos so häufig sind.
Gleich darauf stiegen sie am Ostufer an Land, hoben das Kanu aus dem Wasser, und Felsenherz und Chokariga trugen es nun wohl eine halbe Meile stromaufwärts, während Sancho mit den Pferden und dem Gefangenen vorausritt.
Der Morgen musste bald anbrechen. Vor dem Hellwerden wollten die drei Gefährten möglichst in Sicherheit sein. Felsenherz hatte alles Nötige bereits mit dem Comanchen vereinbart.
Man überquerte nun abermals den Pecos, zerstörte das Kanu und versenkte es, indem man es mit Steinen beschwerte, umwickelte den Tieren die Hufe und wandte sich durch Schluchten und Täler wieder jenem Nebenfluss zu, wo das Flachboot herrenlos im Schilfrohr dicht am Ufer lag oder doch jedenfalls zuletzt gelegen hatte. Chokariga war sogar noch am Pecos zurückgeblieben und hatte hier alle Spuren verwischt, die auf eine Landung hindeuten konnten. Dann erst war er den anderen gefolgt.
