Felsenherz der Trapper – Teil 10.2
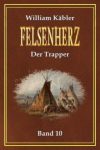 Felsenherz der Trapper
Felsenherz der Trapper
Selbsterlebtes aus den Indianergebieten erzählt von Kapitän William Käbler
Erstveröffentlichung im Verlag moderner Lektüre GmbH, Berlin, 1922
Band 10
Das Geheimnis des Gambusinos
Zweites Kapitel
Der Navajo-Späher
Der Unterhäuptling Wathama hatte sich eine Stunde nach Mitternacht dazu entschlossen, mit drei Kriegern zum Pecos hinabzusteigen und das Flachboot zu beobachten, da er klug genug war, sich zu sagen, dass der bucklige Händler vielleicht aus Vorsicht doch den Ankerplatz wechseln würde.
Wathama führte seinen Namen Nachtfalke nicht umsonst. Genau wie dieser nächtliche Räuber des Vogelgeschlechts besaß auch der Apachenunterhäuptling vortreffliche Augen, deren außerordentliche Sehschärfe durch das Leben in der Wildnis noch erhöht worden war.
Die vier Apachen, Wathama voran, näherten sich gerade zu derselben Zeit dem Ufer des Pecos, als Sancho, der Indsmenfresser, dem Schwarzen Panther die der Schlucht erklärt hatte. Er würde doch einmal nachschauen gehen, ob Felsenherz wirklich irgendeinen besonderen Grund für ein so langes Fernbleiben hätte.
Sancho nahm seine Büchse und verließ die Schlucht. Der bei jedem Westmann so hochentwickelte Ortssinn machte es ihm leicht, genau denselben Weg einzuschlagen, den die drei Gefährten beim Aufsuchen der Schlucht benutzt hatten. Von einem »Weg« war hier natürlich keine Rede. Durch das Gestrüpp am Ausgang der Schlucht lief lediglich eine alte, bereits wieder überwucherte Wildfährte, also ein ausgetretener Pfad, den wahrscheinlich einmal eine Bärenfamilie hervorgerufen hatte, wenn sie zur Tränke am Pecos gewandert war.
Die Schlucht wieder mündete in ein breites, steiniges Tal, das durch einen Canyon, einen steilen Einschnitt in den Felsen, mit dem Ufergelände des Pecos in Verbindung stand.
Der frühere Gambusino wandte bei diesem nächtlichen Gang und bei dieser unregelmäßigen Beleuchtung durch den hinter den Wolken nur zuweilen auf tauchenden Mond all jene Vorsichtsmaßregeln an, die jeder, der mit den Gefahren der nordamerikanischen Wildnis vertraut ist, ganz von selbst beobachtet.
Stets nahm er hinter Büschen, Steinen und Gestrüpp nach wenigen Schritten Deckung, durchforschte dann wieder mit den Augen die Umgebung und benutzte zur Fortsetzung des Weges regelmäßig die Momente, wo das Nachtgestirn wieder hinter dem Gewölk verschwand und tiefe Dunkelheit die Erde bedeckte.
So gelangte er bis an den Canyon, wollte gerade hinter einen dick bemoosten Felsblock schlüpfen, als er vor sich in dem Engpass ein leises Klirren hörte.
Augenblicklich duckte er sich ganz tief neben einem von den Ranken des wilden Hopfens dicht umsponnenen Dornbusch zusammen. Da trat auch schon der Mond wieder hinter den Wolken hervor, und Sancho gewahrte einen Apachen, der soeben aus dem Canyon trat und den dumpfen Ruf des Steinkäuzchens dreimal sehr geschickt nachahmte.
Dieser Apache war ein Späher, den der Unterhäuptling Wathama zum Pecos vorausgeschickt hatte.
Sancho ahnte, dass in der Nähe noch mehr Apachen steckten. Das Signal des Käuzchenrufes konnte ja nur anderen Rothäuten gegolten haben.
Was der Gambusino jedoch nicht ahnte, war die Tatsache, dass des Nachtfalken scharfe Augen die dunkle Gestalt des Westmannes schon vorhin wie einen gleitenden Schatten bemerkt hatten und dass zwei Apachen bereits im Bogen von hinten auf den Dornbusch zukrochen.
Sancho belauerte jetzt sowohl jede Bewegung des Indianers am Canyoneingang als auch nach rechts hin das mit Steinen und Felstrümmern besäte Tal.
Wathama schob sich näher. Er hatte dem anderen Apachen einen Wink gegeben, zurückzubleiben. Er hoffte mit dem Bleichgesicht, das dort vor ihm kauerte, allein fertig zu werden.
Der Gambusino aber war bereits stutzig geworden, weil der Indianer dort am Canyon soeben den Käuzchenruf wie Antwort heischend nochmals lauter wiederholt hatte, drehte sich nun gerade im selben Moment misstrauisch um, als der Nachtfalke mit geschwungenem Tomahawk auf ihn zusprang.
Sancho hatte mit irgendetwas Ähnlichem gerechnet. Der Angriff kam ihm daher durchaus nicht überraschend. Anstatt sich vollends aufzurichten, wählte er die sicherere Art, dem tödlichen Hieb zu entgehen. Er schnellte sich am Boden entlang, packte des Apachen im Sprung erhobenes rechtes Bein und riss es zur Seite, sodass der Nachtfalke seitwärts mit Kopf und Oberkörper in einen anderen Dornenstrauch fiel. Der kleine Gambusino war ebenso fix wieder auf den Beinen. Er wusste jetzt, dass er sein Leben gegen mehrere Apachen würde verteidigen müssen, wusste auch, dass ihm ein schreckliches Ende am Marterpfahl bevorstand, wenn er gerade diesen Rothäuten in die Hände fiele.
Seine bereits gespannte Büchse fuhr hoch. Noch gab der Mond so genügend Licht, den Apachen am Canyoneingang, der mit langen Sätzen heranstürmte, durch eine Kugel niederzuwerfen, bevor der erste Gegner sich aus den Dornen hochgerappelt hätte.
Sancho hatte jedoch den Begleiter Wathamas, der kaum fünf Schritte entfernt zwischen dem Steingeröll lauerte, nicht bemerkt, hatte noch nicht einmal die Büchse richtig in Anschlag gebracht, als dieser, ein älterer Krieger von ungewöhnlicher Körperkraft, lautlos hinter ihn huschte, ihm die Hände um den Hals legte und ihm so mächtig die Kehle zudrückte, dass der Gambusino sofort die Doppelflinte fallen ließ und wie gelähmt vor Schreck Wathama anstierte, der schon aufgesprungen war, Sancho den Hut vom Kopf hieb und das lange Jagdmesser schwang, indem er mit der Linken sich in des Goldsuchers Stirnhaar festkrallte.
Er hatte offenbar im Sinn, das Bleichgesicht lebend zu skalpieren.
Da – der erhobene Arm Wathamas verharrte plötzlich regungslos in der Luft.
Die blitzenden Augen stierten staunend auf die Mitte des Schädels des wehrlosen Feindes.
Denn – in dem Haarwuchs dieses Schädels fehlte ein fast kreisrundes Stück, – gerade der Skalp!
Sancho besaß keinen Skalp mehr. Der hatte schon jahrelang an dem Gürtel des Oberhäuptlings aller Apachenstämme, des Großen Bären, gehangen. Den hatte Sancho vor drei Wochen auf der Hazienda Lago del Parral dem gefangenen Oberhäuptling wieder abgenommen und trug ihn nun als seltsames Andenken an sein gefährlichstes Abenteuer und an sein noch seltsameres Geheimnis in seinem Kugelbeutel.
Wathama ließ das Messer sinken, rief leise: »Uff! Das Bleichgesicht ist bereits …«
Das Weitere brachte er nicht mehr über die Lippen. Der Gambusino, wenn auch schon halb erstickt in der Umklammerung des anderen Apachen, hatte sich doch noch lange nicht verloren gegeben, hatte blitzartig mit dem rechten Bein dem Nachtfalken einen so starken Tritt vor den Leib verletzt, dass der Unterhäuptling wiederum rücklings in die Dornen schlug.
Gleichzeitig war Sanchos Rechte zum Gürtel gefahren.
Er bekam sein Messer zu packen, stieß nach hinten zu, traf den ihn würgenden Roten gerade in die Achselhöhle – stieß nochmals zu.
Und die beiden Hände des Apachen lockerten sich.
Ein Ruck, Sancho war frei, sah sich jetzt dem dritten Angreifer gegenüber, jenem Indianer, der als Späher durch den Canyon vorausgeschickt worden war.
Der Apache hatte den Tomahawk in der hochgereckten Hand, wollte schon zuschlagen.
Wathama jedoch rief ihm einen kürzen Befehl zu, warf sich gleichfalls wieder auf den Gambusino, brüllte: »Hund! Du bist Sancho, der Indsmenfresser! Lebend sollst du …«
Auch jetzt konnte er den begonnenen Satz nicht beenden.
Der dritte Apache, den Wathama mit zum Pecos genommen hatte, war auf dem Kampfplatz erschienen, jedoch nicht allein.
Aus dem mit Geröllstücken und einzelnen Grasbüscheln bedeckten Boden war urplötzlich eine schlanke hohe Gestalt herausgewachsen.
Dieser Mann war mit einem Satz vor Wathama, schlug mit der geballten Faust zu – halb Stoß, halb Schlag – traf die Herzgrube des Unterhäuptlings, der sofort mit einem ächzenden Laut hintenüber flog. Und diese Faust beschrieb sofort einen neuen Bogen von unten nach oben, schmetterte dem zweiten noch kampffähigen Apachen unter das Kinn, beförderte ihn auf einen Geröllhaufen, wo er liegen blieb.
Der Dritte wollte entfliehen, stieß einen schrillen Schrei aus, stolperte.
Sancho hatte ihm ein Bein gestellt.
Das Messer des Gambusino fuhr dem Taumelnden zweimal in den Rücken.
Und der Apache stürzte in letzten Zuckungen über den anderen, dem Sanchos Messer vorhin erledigt hatte.
»Hallo, Felsenherz«, rief der Gambusino jetzt frohlockend, »das war Hilfe zur rechten Zeit.«
Dann sprang er auf Wathama zu, wollte auch ihm die Klinge ins Herz stoßen.
Sein Arm wurde jedoch festgehalten, er selbst zurückgerissen.
»Sancho«, sagte der blonde Trapper ernst. »Ihr kennt mich! Ich vergieße keinen Tropfen Menschenblut unnötig. Bindet die beiden Bewusstlosen – rasch! Ich werde nachsehen, ob die beiden anderen Apachen tot sind. Wenn ja, werfen wir die Leichen in den Peco. Es ist noch mehr von dem schleichenden Ungeziefer in der Nähe, und wir tun gut, unsere Anwesenheit hier in den Guadalupe-Bergen nicht zu verraten.«
Der Gambusino brummte etwas Unverständliches vor sich hin, gehorchte aber.
Zehn Minuten später waren die beiden toten Apachen im Rio Pecos versenkt, und Felsenherz und Sancho führten die an den Armen gefesselten und geknebelten Gefangenen eilends zu der Schlucht, wo der Comanchenhäuptling bereits zu des Gambusino Erstaunen die Pferde gesattelt und die Hirschkeule in große Blätter zum Mitnehmen verpackt hatte.
Zwischen Felsenherz und Chokariga genügte ein kurzer Blick zur Verständigung. Der blonde Trapper wusste nun, dass der Häuptling das Ende des Kampfes vor dem Canyon aus der Ferne beobachtet und sich sofort gesagt hatte, dass man unter diesen Umständen den allzu nahen Lagerplatz gegen einen anderen vertauschen müsse.
Die beiden Apachen wurden auf Felsenherz’ Braunen festgebunden. Dann verließen die drei Gefährten die Schlucht. Bisher hatte nur Sancho mit dem Comanchen ein paar Bemerkungen ausgetauscht und so erfahren, dass dieser ihm nach einer Weile gefolgt und Zeuge des Ausganges des Kampfes geworden war.
Als die beiden Freunde und Halbbrüder, denn Chokariga war ja kein reinblütiger Indianer, eine Strecke vorausgeritten und Sancho mit drei Pferden langsam zu folgen befahlen, teilte der Trapper dem Häuptling mit knappen Worten mit, wie er die Apachen belauscht und dann die Bekanntschaft des groben, buckligen deutschen Flachbootmannes gemacht hatte.
»Mein roter Bruder kann überzeugt sein«, fügte er leise hinzu, »dass dieser Gottlieb Bulle mich belog, als er behauptete, er befinde sich allein auf dem Flachboot. Ganz abgesehen davon, dass ein einzelner Mensch ein so großes und so plumpes Fahrzeug niemals auf Dauer allein führen kann, habe ich auch deutlich unter Deck zwei verschiedene Stimmen unterschieden, die des Zwerges, eine kreischende Fistelstimme, und einen Bass von solcher Tiefe, wie ich ihn bisher nicht für möglich hielt. Mein Bruder Chokariga wird mir also recht geben, wenn ich vermute, dass dieser Flachbootmann, dessen abschreckende Hässlichkeit wahrscheinlich bei den Apachen allerlei abergläubische Vorstellungen hervorrief, sodass sie sich nicht sofort an ihn herangetrauten, nicht so harmlos ist, wie es scheinen mag. Da wir ja ebenfalls weiter stromaufwärts dem Geheimnis des Gambusino auf den Grund gehen wollen, und da das Flachboot ebenfalls dieselbe Richtung genommen hat und in dem toten Flussarm vor Ankern liegt, dürfte es ratsam sein, uns erst mal mit diesem meinem Landsmann etwas näher zu beschäftigen. Man kann ja nie wissen, welcher Sorte von Menschen die beiden Insassen des Fahrzeugs angehören, und hier im Wildem Westen wäre es geradezu leichtsinnig …«
Er schwieg.
Der Comanche hatte ihm mit leisem Druck die Hand auf den Arm gelegt.
Sie waren beide gleichzeitig stehen geblieben. Sie hatten die Schlucht und das breite Tal längst hinter sich, waren in ein Quertal eingedrungen und standen nun am Ostrand dieses Tales, blickten schräg abwärts über einige Baumwipfel auf den im Mondlicht glitzernden Pecos.
Dort schoss ein langes, von acht Indianern gerudertes Kanu soeben hinter der kleinen Insel hervor, an der das Flachboot vorhin vertäut gewesen war. In dem Kanu, das stromaufwärts fuhr, saßen außerdem zehn weitere Rothäute, deren besondere Art von Federschmuck ihre Zugehörigkeit zu den weiter nordwestlich wohnenden Navajo verriet.
»Die schleichenden Füchse der Navajo haben ihre Dörfer am San Juan-Fluss verlassen«, sagte der Comanche, nachdem er mit Felsenherz hinter einem Busch Deckung genommen hatte.
»Wie kommen die Navajo soweit südlich in das Gebiet der Apachen? Wenn auch zwischen diesen beiden roten Völkern das Kriegsbeil jetzt gegraben ist, dürften es die Navajo ohne besonderen Grund nie gewagt haben, sich hierher zu verirren.«
Der Mond verschwand hinter dem dahinziehenden Gewölk. Es wurde so dunkel, dass der Fluss nicht mehr zu erkennen war. Als das Nachtgestirn nach drei Minuten abermals aufleuchtete, konnten Felsenherz und der Häuptling von dem Kanu nichts mehr entdecken.
»Erst das Flachboot, nun noch die Navajo!«, meinte der Trapper nachdenklich. »Chokariga – das alles behagt mir nicht! Ich habe das Gefühl, dass hier irgendetwas sich anspinnt, von dem wir nichts ahnen. Wir werden doppelt vorsichtig sein müssen! Auch die Navajo sind nicht unsere Freunde.«
Der Schwarze Panther hatte sich nach Sancho umgeschaut.
»Das kleine Bleichgesicht hat Mühe, die drei Pferde die Böschung hinaufzuführen«, sagte er. Und nach kurzer Pause. »Er kommt ohne die Gefangenen! Wo mögen sie geblieben sein?«
Felsenherz eilte dem Gambusino entgegen.
»Sancho, sind die beiden Apachen entflohen?«, fragte er hastig.
»Nur der eine, der Unterhäuptling«, erwiderte der Goldsucher wütend. »Ich hatte die Schufte, die noch so taten, als hätten sie Eure Fausthiebe noch nicht recht verdaut, doch wohl zu lose festgebunden. Jedenfalls wollte der eine Bursche mir plötzlich die Büchse entreißen.
Na – er wird’s nie wieder tun! Er liegt setzt mit zwei gutsitzenden Messerstichen drüben in einer tiefen Felsspalte. Aber Wathama ist ausgerissen. Ihr seht nun, Felsenherz, wie falsch es war, die beiden Schufte nicht gleich kalt zu machen!«
Chokariga war ebenfalls hinzugetreten und meinte kurz: »Die stinkenden Kröten der Apachen werden nach einer Stunde auf unserer Fährte sein. Hinab zum Pecos! Wir müssen ein paar Baumstämme zum Floß vereinen und weit stromabwärts landen.«
Wortlos stiegen die drei nun mit ihren Pferden zum Fluss hinab. Während Sancho und der Trapper hier das Floß herstellten, hielt der Häuptling Wache, um jeder Überraschung durch irgendeinen Feind vorzubeugen.
Die Pferde folgten dann willig auf die nur lose zusammengebundenen Baumstämme, die von der Strömung nun rasch entführt wurden.
Als das Floß um die nächste Biegung des Peco verschwunden war, arbeitete sich aus einem nahen Gestrüpp schnell ein Indianer hervor, dessen kleiner Wuchs und reicher Federschmuck ihn als Navajo erkennen ließen.
Er war nur mit Messer, Tomahawk, Bogen und Pfeilen bewaffnet, eilte jetzt einer durch angetriebene Baumstämme entstandenen Barrikade zu und zog unter dem dichten Blätterdach der Kronen ein winziges Fellboot hervor, brachte es zu Wasser, warf schnell einige grüne Äste darüber und ließ es mit der Strömung abwärts treiben. Da es weit leichter als das Floß war, hatte der Navajo-Kundschafter die drei Gefährten sehr bald eingeholt, lenkte dann mit einem Ruder, halb im Boot liegend, näher an das Ostufer heran und beobachtete, wie die drei landeten und davonritten.




