Der Schwur – Zweiter Teil – Kapitel 3
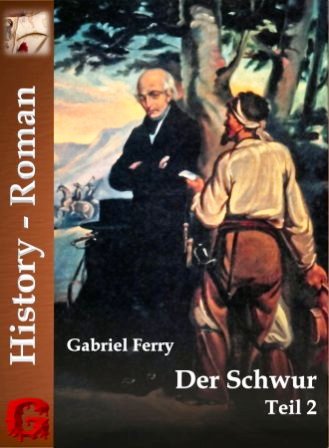 Der Schwur
Der Schwur
Historischer Roman aus dem mexikanischen Unabhängigkeitskrieg
Zweiter Teil
Ein moderner Odysseus
Kapitel 3
Eine nächtliche Unternehmung
Der Schwarze blickte Costal starr an, dann sagte er, da er sah, dass derselbe von ihm zuerst seine Meinung hören wollte: »Es gibt ohne Zweifel mehrere Wege, sich der Festung zu bemächtigen, und wenn ich der General der Armee wäre …«
»Nun, was würdet Ihr tun?«, fragte der Indianer.
»Ich würde nicht in Verlegenheit sein, den richtigen zu finden, gestehe aber, dass ich in meiner Eigenschaft als einfacher Artillerist keinen weiß, das ist auch ganz natürlich. Das ist meine Ansicht, jetzt werde ich die Eurige hören.«
»Ohne Zweifel gibt es mehrere Wege, ein Fort zu nehmen: durch Hunger oder durch Ersteigung mit Sturmleitern. Wir sind aber nicht stark genug, um sie mit bewaffneter Hand zu nehmen.«
»Dann wollen wir sie durch Hunger nehmen«, sagte der Afrikaner, »ich bin dabei, und dafür gibt es ein sehr einfaches Mittel, man schneidet ihnen die Lebensmittelversorgung ab.«
»Auf welche Weise?«
»Das ist Sache des Generals und nicht die Unsrige.«
Die Erörterung der beiden Gefährten wurde durch einen Kanonenschuss unterbrochen.
»Das war ein Schuss vom Fort«, sagte Costal.
»Nein«, entgegnete der andere, »von der Insel la Roqueta.«
Ein zweiter, diesmal aus dem Fort abgefeuerter Kanonenschuss bestätigte die Behauptung Claras, denn der Schall war weniger dumpf.
»Das ist ein mit der Besatzung der Insel verabredetes Signal«, sagte Costal, »aber zu welchem Zweck?«
Im selben Augenblick stieg vom höchsten Punkt der Festung am noch dunklen Himmel eine Rakete auf und zeichnete ihre feurige Bahn darauf ab. Nach Verlauf einiger Minuten stieg eine andere Rakete von der Insel auf.
»Das ist irgendein Schiff mit Proviant für die Belagerten«, fuhr Costal fort. »Wir wollen hier warten, bis es Tag ist, und wir werden dann genau erfahren, was zwischen dem Fort und der Insel vorgeht. Dies würde uns vielleicht ein Mittel finden lassen, wie wir den Belagerten die Versorgung abschneiden können.«
»Sie werden aber jetzt noch welche erhalten«, befand Clara.
»Ja, das wird das letzte Mal sein!«
Bald darauf durchdrang die Sonne mit ihren Strahlen die dichten Dunstschichten, die sich am Horizont aufgetürmt hatten.
»Seht Ihr da unten, nahe bei der Insel?«, fragte Costal.
Auf einem hellen Grund und über dem dichten, grünen Laubwerk der Bäume, welche die Insel einfassten, zeichneten sich in leichten Konturen die Masten und Takelage eines Schiffes ab.
»Das Schiff lag gestern nicht da«, fuhr der Indianer fort. »Nun Clara! Fällt Euch bei diesem Anblick noch nichts ein?«
»O ja, ich erfahre dadurch, dass da unten ein Schiff vor Anker liegt und dass die Belagerten neuen Proviant erhalten sollen.«
»Ich habe so meine Idee«, sagte der Indianer. »Komm, wir wollen dem General unseren Plan mitteilen.«
***
Während Clara und Costal über die Wege, die Festung zu nehmen, beratschlagten, hielten zwei wichtige Personen über denselben Gegenstand im Zelt des Obergenerals Rat und dies waren Morelos und Don Hermenegildo Galeana. Bei Ersterem waren noch Spuren heftiger ihn beherrschenden Leidenschaften sichtbar und er hatte es verschmäht, sich vom Staub, der seine Kleider bedeckte, zu reinigen.
Don Hermenegildo zeigte ein bedrohliches Gesicht, weil er düstere Wolken auf der Stirn seines viel geliebten Generals sah. Hätte es ihn betroffen, so würde kein Leid seine kriegerische Gestalt gebeugt haben.
Ein Plan der Festung und der Reede von Acapulco lag vor ihnen bei dem Schein zweier Wachskerzen ausgebreitet, der allmählich schwächer wurde, in dem Maße, wie der Tag nahte.
»Wie der Schurke Gago aussagte, könnten wir zwar Acapulco im Handumdrehen nehmen, aber unsere Eroberung wäre nicht entscheidend, solange wir nicht die Herren der Festung wären. Der Kommandant Pedro Valdez sucht, obgleich er ein Kreole ist, eine Ehre darin, sich als Spanier anzusehen. Er wolle, sagt er, dem politischen Glauben seiner Väter treu bleiben. Wisst Ihr, Don Hermenegildo, was er auf meine Aufforderungen und auf mein Anerbieten geantwortet hat?«
»Durchaus nicht!«, sagte Galeana bei diesen Worten Morelos’, »wir wollen unterdessen immer die Stadt nehmen. Das Übrige wird sich finden.«
»Aber dieses Fort!«, wiederholte Morelos, ihm den Plan auf der Karte zeigend.
Wie schon früher erwähnt, war das Fort am Ufer des Meeres in geringer Entfernung von der Stadt und inmitten umgebender unermesslicher Abgründe erbaut worden.
Es beherrschte Meer und Stadt zu gleicher Zeit. Zwei Stunden davon erhob sich die Insel la Roqueta, die der Obhut einer schwachen Garnison anvertraut war. Mittels der Brückenverbindung zur Insel konnte sich das Schloss fortwährend neu verproviantieren.
Morelos fuhr fort: »Valdez fühlt die Stärke und die Vorteile einer Stellung, die ihm im verzweifelten Notfall einen Rückzug zum Meer sichert. Das Fort hat Überfluss an Lebensmitteln und sonstigem Kriegsbedarf. So hofft er durch seinen Widerstand den königlichen Truppen Zeit zu verschaffen, ihm zu Hilfe zu eilen. Man müsste ihn zu Wasser und zu Land zugleich einschließen. Der Ausgang würde aber ebenso zweifelhaft sein, wie das Unternehmen schwierig. Tage, Wochen, Monate vergehen in Versuchen aller Art und wir haben den Schmerz, sehen zu müssen, dass, wenn wir hoffen, es seien die Lebensmittel und Munition im Schloss ausgegangen, plötzlich spanische Schiffe, von dem Doppelfeuer der Insel la Roqueta und der Festung geschützt, herankommen und die Mittel zu weiterem Widerstand in die Festung werfen.«
»Lasst uns nur erst die Stadt nehmen, General«, wiederholte Galeana. »Die Stadt wird uns wenigstens gute Hilfsmittel bieten, die uns hier auf diesem glühend heißen Strand verweigert sind. Eine verzehrende Sonnenglut, die Rückstrahlen des glühenden Sandes, in dem wir gezwungen sind, zu kampieren, haben tödliche Fieber in unserer Armee hervorgerufen. Unser Lebensmittelnachschub kommt sehr spärlich an und in sonderbarer Ausnahme von der Regel leiden die Belagerer selbst größeren Mangel als die Belagerten.
Krankheiten, der Mangel an guten Nahrungsmitteln und das Feuer der Festung lichten unsere Reihen in hohem Umfang. Deshalb müssen wir zuerst daran denken, uns der Insel la Roqueta zu bemächtigen, um den Feind auszuhungern und ihn zur Übergabe zu zwingen. Das Unternehmen ist gefährlich, ich weiß es. Wir haben kaum so viel Fahrzeuge, um sechzig Mann aufzunehmen. Wir müssen zu einer Zeit, wo die Windstöße anfangen häufig zu werden, uns zwei Stunden weit ins Meer wagen und dann in sehr geringer Anzahl eine befestigte Insel angreifen, die von einer mutigen Besatzung verteidigt ist. Dennoch will ich aber, welche Gefahren auch dabei zu überwinden sein mögen, die Expedition zum Ruhm Eures Namens ausführen.«
»Ihr habt mich gelehrt, niemals an den Erfolg eines Unternehmens zu zweifeln, was Euch anvertraut ist, Freund Galeana«, erwiderte der General lächelnd. »Dies ist so, dass die Klugheit den Gedanken daran von der Hand weisen muss.«
»Nichtsdestoweniger wage ich auf Eure Einwilligung zu rechnen, General, unter einer Bedingung …«
»Welche?«
»Eure Exzellenz werden, wenn meine Signale Euch benachrichtigen, dass die Insel genommen ist, ein gleiches mit der Stadt tun, da ich genötigt bin, auf der Insel in Garnison zu bleiben.«
Einen Augenblick blieb Morelos nachdenklich, als der Adjutant Lantejas, der in einer Art Vorzimmer des Zeltes geblieben war, da er wusste, dass der General sich mit Galeana beriet, eintrat und um die Erlaubnis bat, Costal einführen zu dürfen, um, wie er sagte, eine Mitteilung von Wichtigkeit machen zu können.
»Möge Eure Exzellenz«, sagte Don Galeana, »ihm erlauben, einzutreten. Dieser Indianer hat fast immer gute Ideen.«
Morelos machte ein Zeichen des Einverständnisses und der Indianer trat in das Zelt.
Als er die Erlaubnis zum Sprechen erhalten hatte, sagte er: »Herr General! Ich befand mich eben auf den Höhen von Hornos und habe beim Anbruch des Tages eine Goélette nahe der Insel la Roqueta vor Anker liegen sehen.«
»Nun?«
»Nun! Es wird sehr leicht und einfach sein, sich diesen Abend mit Anbruch der Nacht bis dahin zu schleichen, sich ihrer unter dem Schutz der Dunkelheit zu bemächtigen und dann, wenn wir in ihrem Besitz sind …«
»Werden wir die für das Fort bestimmten Zufuhren auffangen«, rief Galeana ungestüm, »und es dann durch Hunger zur Kapitulation zwingen. Herr General, Gott spricht durch den Mund dieses Indianers. Eure Exzellenz kann jetzt unmöglich noch die Erlaubnis verweigern, die ich nachsuchte.«
Durch die inständigen Bitten Galeanas besiegt und durch die Perspektive des Ausgangs, den ohne Zweifel die Wegnahme eines Fahrzeuges zur Folge hatte, verführt, willigte Morelos ein, die Erlaubnis zu erteilen, um die man nachsuchte.
»Wenn ich mich auf die Kenntnis der Wolken verstehe«, sagte Costal, »so zeigt der Sonnenaufgang bestimmt für diesen Abend eine finstere Nacht und ein ruhiges Meer an – wenigstens bis Mitternacht.«
»Und nach Mitternacht?«, fragte der General.
»Sturm und unruhiges Meer. Aber die Goélette und die Insel werden vor Mitternacht unser sein«, erwiderte der Indianer.
»Ich kann dies nur bestätigen«, rief Galeana.
Es wurde sogleich beschlossen, dass das Unternehmen von den beiden Galeanas, Onkel und Neffe geleitet werden sollte, eine Gunst, die sich der Oheim für seinen Neffen aus erbeten hatte. Der Hauptmann Lantejas sollte mit Costal zusammen ein kleines Fahrzeug unter ihrem Befehl kommandieren.
»Der brave Don Cornelio würde es uns im Leben nicht verzeihen, eroberten wir die Insel ohne ihn«, sagte Galeana.
Der Hauptmann lächelte mit martialischer Miene, obgleich er im Geringsten nichts dagegen gehabt hätte, wenn er von den Gefahren dieser Expedition ausgeschlossen worden wäre. Er machte aber gute Miene zum bösen Spiel und exaltierte große Freude, dass man daran dachte, ihm diese Ehre zu erteilen.
Die Vorhersagungen Costals schienen sich in allen Punkten zu erfüllen. Das Wetter war den ganzen Tag über trübe. Die Vorbereitungen für den Abend wurden getroffen.
Um acht Uhr ungefähr nahm jeder seinen Platz in den Fahrzeugen ein, die ungefähr achtzig Mann fassen konnten.
Die Fahrzeuge bestanden aus zwei größeren Booten und einem kleinen Kanu. Alles war im ziemlich miserablen Zustand. Sie mussten sich damit begnügen, da sie zu jener Zeit die einzige militärische Marine war, welche die Insurgenten besaßen.
Endlich stach man in die See, die Riemen sorgfältig mit Leinwand umhüllt, damit sie weniger Geräusch im Wasser verursachten. Die Nacht war in der Tat so dunkel, dass das hohe steile Ufer und die schwarzen Umrisse des Schlosses sogleich unsichtbar wurden.
In dem von Don Cornelio kommandierten Kanu waren außer Costal und den vier Ruderern noch fünf Costennos, im ganzen elf Mann.
Dieses Fahrzeug war das am wenigsten beladene, fuhr deshalb an der Spitze und diente der bescheidenen Flotte als Steuerschiff.
Der Indianer saß am Ruder und machte, obgleich er alles leitete, den Hauptmann auf ein Schauspiel aufmerksam, das er übrigens nur allein zu sehen bekam. Ein paar große Haifische tauchten von Zeit zu Zeit im glänzenden Kiel des Kanus auf.
»Ihr seht wohl diese Bestien«, sagte Costal, »die uns so hartnäckig verfolgen, als vermuteten sie, dass das Kanu, das uns trägt, halb verfault ist. Ich wünschte wohl, dass mein Freund Pepe Gago einer von ihnen wäre, ich würde ihn im Angesicht der anderen erdolchen.«
»Denkt Ihr noch an diesen Schurken?«, fragte Don Lantejas.
»Mehr als jemals und ich würde die Armee Morelos’ nicht verlassen, auch in dem Falle nicht, wenn meine Kapitulation angelaufen wäre, allein in der Hoffnung, dass er eines Tages das Fort Acapulco, in dem der erbärmliche Verräter eingeschlossen ist, erobern wird.«
Lantejas schenkte für den Augenblick dem, was der Indianer sagte, nicht viel Aufmerksamkeit. Die Befürchtung, die Costal in Betreff der Dauerhaftigkeit des Kanus ausgesprochen hatte, beschäftigte ihn mehr, als die Rachepläne desselben. Er hätte gewünscht, so bald wie möglich auf der Insel la Roqueta zu landen, natürlich nicht aus Kampfeslust.
»Dieses Kanu kommt verdammt langsam vorwärts«, sagte er zum wiederholten Mal.
»Ihr habt immer Eile, Euch mit dem Feind zu messen«, sagte Costal lachend, »wir müssen jetzt den Lauf unseres Fahrzeugs hemmen, denn wir nähern uns der Insel.«
Tatsächlich erschien ein schwarzer Punkt wie ein Seevogel, der sich einen Augenblick auf den Wogen ausruht, bevor er sich wieder aufschwingt, auf dem Wasser zu schwimmen. Dies war die fragliche Insel, düster, schweigend und ohne Wachtfeuer.
»Ich glaube mit Eurer Erlaubnis, Señor Capitano, wir werden gut tun, die übrigen Fahrzeuge hier zu erwarten, um Don Galeana um die Erlaubnis zu bitten, vorangehen zu dürfen. Unser Kanu ist gerade klein genug, um damit eine Erkundigung der Insel vornehmen zu können, während man dort ein großes Fahrzeug leicht entdecken würde.«
»Sehr gern!«
Auf Befehl des Hauptmanns ließen die Ruderer ihre Ruder sinken. Gleich darauf langte das Fahrzeug Galeanas an.
»Was gibt es?«, rief er, »habt Ihr etwas bemerkt?«
Don Cornelio teilte ihm die Absicht Costals mit, die er auch für gut fand, und die drei Barken blieben zurück, während das Kanu sich zum Erkunden anschickte. Allmählich erhob sich die Insel immer deutlicher über der Oberfläche des Meeres, aber noch war es unmöglich, irgendetwas auf dem Land in der Dunkelheit zu unterscheiden, wenn man nicht die scharfen Spitzen der Masten und die Kreuzrahen eines kleinen, vor Anker liegenden Schiffs dazu rechnen wollte. Dies war eben die Goélette.
Die Riemen, deren Umhüllung aus nasser Leinwand das Geräusch hemmten, kreischten in den Dollen nicht stärker als das Pfeifen der Meerschwalbe, der Vorläuferin der Stürme, und unterbrachen, wenn sie sich ins Wasser senkten, nicht einmal das leichte Murmeln der hohlen See. Die dem Kanu nachfolgenden Haie zogen glimmende Furchen durch die Wellen.
Nach Verlauf einiger Augenblicke dieser schweigenden Fahrt zeichnete sich das Schiff auf dem erdigen Ufer der Insel la Roqueta ab. Dann sah man deutlich Lichtschimmer aus den Öffnungen der hinteren Stückpforte. Das Schiff erschien in der Nacht wie ein riesiger Wal, der seine Augen öffnet, um zu erspähen, was weit vor ihm vorgeht.
»Das wäre ein hübscher Streich, wenn wir uns dieser Goélette zuerst bemächtigen«, sagte der Hauptmann. »Das würde unsre Landung auf der Insel bedeutend vereinfachen.«
»Ich dachte eben auch daran«, erwiderte der Indianer, »die Hauptsache ist dabei, dass uns die wachhabenden Matrosen nicht entdecken. Vorwärts, die Zeit drängt, es ist bald Mitternacht und dieser weiße Schaum, der auf dem Wasser wirbelt, zeigt die Rückkehr des Windes an, und zwar eines Sturmwinds.«
Bei diesen Worten drückte Costal die Stange des Ruders seitwärts, das Kanu beschrieb einen Bogen, der es aus dem Bereich der Lichtstrahlen der Goélette trug.
Einige leichte Windstöße trugen sich übers Meer. Das Kanu näherte sich unterdessen dem Teil der Insel, der am weitesten von dem kleinen vor Anker liegenden Fahrzeug entfernt war.
Nur noch einige Augenblicke und es verbanden sich die Gefahren des Landes mit denen des Meeres, dessen furchtbare Bewohner fortfuhren, dem Kielwasser des Kanus hartnäckig zu folgen.
Obgleich man schon die Brandung gegen die Klippen der Insel schlagen hörte, so glaubten Costal und der Hauptmann weit entfernt zu sein, als dass die Schildwachen sie in der Finsternis bemerken konnten. Plötzlich strahlte das Vorderteil der Goélette hell auf. Noch waren die Männer im Kanu geblendet von der plötzlichen Helle, als sich ein Zischen im Wasser hören ließ.
Das Kanu erhielt einen scharfen Stoß in einem Schaumregen, im selben Augenblick schlug ein entsetzliches Geschrei an das Ohr derjenigen, die sich darin befanden. Ein Entsetzensschrei entfuhr ihnen, zwei Soldaten, die wie durch einen Wirbel fortgetragen schienen, verschwanden im Meer, wohl an zehn Schritte von Bord.
Zwei Haie waren zugleich verschwunden, einer blieb, der aber seinerseits auch Beute zu erwarten schien.
Don Cornelio stand mit Costal im hinteren Teil, die Kugel, welche die beiden Soldaten in den Tod riss, hatte das Kanu derart beschädigt, dass das Vorderteil viel tiefer als das Hinterteil im Wasser lag.
Costal schrie: »Bei Gott und beim Teufel! Das Kanu ist nicht mehr zu lenken!«
»Was soll das heißen?«, fragte ihn Lantejas von diesem Unglück erschreckt.
»Sehr wenig, nur dass die verdammte Kugel ein Stück des Vorderteils mit weggerissen hat und nun sinkt die Spitze zuerst.«
Ein Angstschrei der beiden Unglücklichen im vorderen Teil, die schon halb im Wasser standen, führte dem Hauptmann die unentrinnbare Gewissheit der Worte Costals ins Gedächtnis.
»Großer Gott!«, schrie der Hauptmann, »wir sind verloren!«
»Jene da, das stelle ich nicht in Abrede«, erwiderte Costal mit unerschütterlichem Gleichmut, »aber nicht wir. Haltet Euch da fest und verliert mich nicht aus den Augen. So! Da! Nur sachte!«, fuhr er fort, einen der Küstenbewohner zurückstoßend, der in der Mitte des Kanus saß und sich, vom Wasser erfasst, an den Kleidern des Indianers anklammerte. »Hier sorgt jeder für sich.«
Als der Unglückliche versuchte, sich krampfhaft festzuhalten, stieß ihm Costal sein Messer in den Leib und warf ihn über Bord. Diesmal verschwand auch der dritte Hai, noch ein entsetzlicher Schrei, und dann verschwand alles unter Wasser.
»Er hat es so gewollt«, sagte der Indianer immer noch ruhig, »möge sein Beispiel den anderen zur Lehre dienen.«
Jeder wendete diese Worte auf sich an und wagte es nur noch, sich an dem unter Wasser gesetzten Teil anzuklammern.
Drohende Stimmen schienen aus der Tiefe des Abgrunds an die Oberfläche des Meeres aufzutauchen oder zu den Ohren der Schiffbrüchigen, auf den Flügeln des Sturmwinds getragen zu werden. Der Himmel verfinsterte sich von Minute zu Minute und das Meer wurde schwarz wie der Himmel. Blendende Blitze zerrissen hin und wieder die dichten Wolken und zeigten im Augenblick die Unendlichkeit der wogenden Wassermassen.
Der furchtbare Leichenzug der Meeresungeheuer wurde von Neuem sichtbar. Durch ihre Beute nur noch heißhungriger gemacht, schwammen sie langsam neben dem schon zur Hälfte geflutetem Fahrzeug her. Ein Mann versank, um nicht wieder zu erscheinen, ein Zweiter wurde ungestüm von einem dieser Ungeheuer von einer Planke gerissen, seinem letzten Rettungsmittel, um das er krampfhaft in seine Arme presste.
Bei diesem entsetzlichen Anblick rief Don Cornelio, der mehr tot als lebendig schien, Gott und alle Heiligen mit einer Inbrunst an, von der man sich wohl leicht eine Vorstellung machen kann.
»Vertraut mehr Eurem Mut als den Heiligen Eures Paradieses«, sagte ihm der unerschütterliche Heide an seiner Seite.
»Wenn es nicht für Euch geschieht …«
Costal beendete seinen Satz nicht, er blickte mit besorgter Miene um sich. Ein Dritter war soeben verschlungen worden, denn die Fortschritte des eindringenden Wassers am Bug des Bootes machten fast eine Verdoppelung der Kräfte im hinteren Teil nötig, wo sich der Indianer, Lantejas und noch ein Dritter aufhielten, um nicht herabzustürzen. Je mehr Leute aber im Vorderteil verschwanden, desto mehr schien das Kanu, von seiner Last erleichtert, eine horizontale Lage einzunehmen.
»Könnt Ihr schwimmen?«, fragte Costal.
»Ja, eben genug, um mich einige Minuten über dem Wasser zu erhalten.«
»Gut«, sagte der Indianer kurz, und bevor noch Lantejas Zeit hatte, seine Absicht zu durchschauen, hatte Costal den Moment, in dem eine starke Welle das Kanu auf die eine Seite legte, benutzt, ihm nach derselben Seite eine so heftige Erschütterung beigebracht, dass es vollständig umschlug.
Der Hauptmann wurde mit einer solchen Schnelligkeit vom Meer verschlungen, dass er auch keinen Schrei ausstoßen konnte. Eine Sekunde später fühlte er sich so heftig an seinen Kleidern erfasst, dass er verschlungen zu werden glaubte. Er kam vollständig betäubt wieder an die Oberfläche. Costal hielt ihn mit einer Hand und klammerte sich mit der anderen an das Kanu, das mit umgekehrtem Kiel auf dem Meer trieb.
»Fürchtet nichts«, sagte der Indianer, »ich bin bei Euch.«
Durch seine Anstrengungen mit denen vereint, die der unglückliche Hauptmann automatisch mitmachte, brachte er es dahin, den Letzteren rittlings auf den Kiel des Kanus zu setzen.
Dann schwang sich der Indianer neben ihn.
Von den elf Personen, die noch einen Augenblick vorher zusammen gewesen waren, blieben nur noch diese beiden übrig.
»Ich habe, um Euch zu retten, alle die anderen armen Teufel geopfert«, sagte Costal. »Noch eine Viertelstunde und das Kanu wäre untergegangen. Jetzt werden wir, solange wenigstens der Sturm nicht heftiger wird, auf dem Kanu herumschwimmen, bis die anderen Fahrzeuge kommen, uns zu retten.«
Es kam dem Hauptmann nicht im entferntesten an, dem treuen und ergebenen Costal eine in seinem Interesse begangene Grausamkeit vorzuwerfen.
Während er seine aufrichtigen Danksagungen an den Indianer mit seinen glühenden Gebeten an den Himmel untermischte, beschäftigte sich Costal mit der Kaltblütigkeit eines Kalfaterers auf einer Schiffswerft, mithilfe seines Messers in der Länge des wurmstichigen Kiels, ziemlich tiefe Einschnitte zu machen, sodass man sich mit einer Hand daran halten konnte.
Dann sagte er mit seinem so ruhigen und ironischen Ton: »Haltet Euch brav und vertraut den Heiligen nicht zu viel.«
Bald hatte er mehrere Öffnungen gemacht, die groß genug waren, um die Hand hineinstecken zu können und sich so fest zu klammern, dass sie durch die sich in jedem Augenblick vergrößernden Wellen nicht mehr fortgerissen werden konnten.
Als sich beide so auf dem gebrechlichen Wrack eingerichtet hatten, versuchte Costal, den dichten Schleier der Finsternis, der sie umgab, zu durchdringen. Aber auch die häufiger werdenden Blitze zeigten ihm nur ein schwarzes, drohendes Meer und in der Ferne die Insel und die imposanten Umrisse der belagerten Festung. Die drei übrigen Fahrzeuge waren unsichtbar und kein Echo antwortete auf die Schreie, welche die beiden Schiffbrüchigen ausstießen, um ihre Gefährten herbeizurufen.




