Felsenherz der Trapper – Teil 9.1
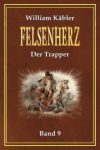 Felsenherz der Trapper
Felsenherz der Trapper
Selbsterlebtes aus den Indianergebieten erzählt von Kapitän William Käbler
Erstveröffentlichung im Verlag moderner Lektüre GmbH, Berlin, 1922
Band 9
Die belagerte Hazienda
Erstes Kapitel
Die sechs Vaqueros
In einer dunklen, windigen Sommernacht lagerten in einer hügeligen Prärie dicht am Nordufer eines kleinen Baches, der in den nahen Rio Grande del Norte, den heutigen Grenzfluss zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten von Nordamerika, einige Meilen weiter westlich mündete, fünf Männer, die sämtlich die farbenprächtigen und fantastischen Anzüge der Vaqueros, der mexikanischen Rinderhirten, trugen.
Sie lagen auf dem Bauch um ein kleines Feuer herum, über dem ein großer Blechkessel stand, dessen dampfender Inhalt würzig nach Tee duftete. Neben den fünf sehnigen, sonnengebräunten Männern lehnten an starken Zweigen des Buschwerks, das diesen Platz umgab, ihre kurzen Büchsen. Im Hintergrund der Lichtung aber weideten sechs Pferde, denen die Vorderfüße gefesselt waren, sodass sie sich nur langsam bewegen konnten.
»Es hat wirklich keinen Zweck, den verdammten Rothäuten noch länger nachzuspüren, die unserem Herrn die hundert Rinder fortgetrieben haben«, klagte der Älteste der Männer, ein sehr großer, hagerer Mexikaner, indem er seinen Blechbecher aus dem Kessel füllte und von einer zuvor gebratenen Rehkeule ein Stück herunterschnitt. »Drei Tage suchen wir nun schon umsonst diese Gegend ab. Der letzte Regen hat alle Spuren ausgetilgt. Die Apachen – denn fraglos waren es wieder diese diebischen Schufte – sind längst über den Rio Grande hinüber. Morgen früh kehren wir um. Señor Alvaro wird wohl einsehen, dass wir unsere Schuldigkeit getan haben. Wäre der Regen nicht gekommen, hätten wir die Indsmen ganz sicher abgefasst.«
»Hast recht, Benito«, meinte ein anderer Vaquero.
»Wir reiten morgen zu der Hazienda zurück. Diese Gegend hier ist ohnedies nicht recht geheuer. Die verwischte Fährte, die wir heute Nachmittag dort weiter nördlich fanden, rührt bestimmt von einem größeren Indianertrupp her. Wenn die Rothäute so sorgfältig ihre Spuren auslöschen, dann führen sie stets etwas im Schilde.«
»Du musst es ja wissen, Sancho«, sprach ein Dritter der Männer mit einer gewissen Hochachtung. »Du hast ja jahrelang als Gambusino die Gebiete der Apachen und der nördlicheren Stämme durchstreift.
Und deinen Namen Indsmenfresser wirst du wohl nicht ohne Grund erhalten haben.«
Sancho, ein kleiner, starkknochiger Mann mit schwarzem Bart und lebhaften, dunklen Augen, lachte grimmig und schob seinen breitrandigen Filzhut so weit ins Genick, dass seine Gefährten den kahlen blutroten Fleck auf der Mitte des sonst dicht behaarten Schädels sehen konnten.
»Dort saßen einst Haut und Haare, Amigos!«, meinte er. »Der Große Bär, der Oberhäuptling der Apachen, trägt meinen Skalp noch heute am Gürtel. Fünf Jahre sind’s her, dass ich ihn verlor. War eine wilde Sache damals. Kam mit knapper Not lebend davon. Seitdem habe ich das Gambosino-Handwerk aufgegeben. Kriegen mich die Apachen nochmals, dann ist’s vorbei mit dem Indsmenfresser! Doch … reden wir nicht mehr davon!«
»Weshalb erzählst du dein damaliges Abenteuer eigentlich nicht, Sancho?«, fragte der alte Benito nun, der bei dem Besitzer der Hazienda Lago del Parral eine Art Vertrauensposten bekleidete.
Der Indsmenfresser machte eine abwehrende Bewegung. »Lass die alten Geschichten ruhen, Benito«, sagte er schroff und schob noch ein Stück der Rehkeule zwischen die tadellosen Zähne. »Ich werde jetzt unseren Jüngsten als Wache ablösen. Mitternacht ist nahe, und in einer so windigen Nacht schleichen zu leicht ein paar skalplüsterne Rothäute so nahe heran, dass sie uns …«
Er schwieg plötzlich und griff nach seiner Büchse, starrte dabei scharf in das Dunkel hinein, wo sich im Hintergrund die Leiber der sechs Pferde undeutlich abzeichneten.
Benito hatte ebenso schnell und geistesgegenwärtig eine Handvoll trockener Reiser in die Glut geworfen, da auch er nun eine hohe Gestalt wahrgenommen hatte, die auf eine Büchse gelehnt neben den Pferden kaum vier Schritte entfernt stand.
Die Flammen leckten knisternd höher und beleuchteten den Fremden, der regungslos zu den Männern hinblickte und nun unvermittelt mit einer hellen, durchdringenden Stimme sagte: »Ihr würdet besser tun, das Feuer auszulöschen. Der Apachen listige Schlangenbrut windet sich unhörbar durch das rauschende Präriegras. Die Ohren und Augen eures jungen Wächters waren für diese Nacht zu ungeübt, und das Messer eines Indsman ist schneller als der Warnruf eines Vaquero, der mit den Schrecken der Wildnis nicht vertraut ist.«
Sancho war aufgesprungen und näher an den schlanken Mann im ledernen Jagdwams herangetreten. »Heißt das etwa, dass die Apachen unserem Freund Juan ausgelöscht haben?«, fragte der Indsmenfresser hastig.
»Das heißt, dass sie es tun wollten«, erklärte der Fremde gelassen.
»Also habt Ihr es verhindert, Fremder?«
Der blondbärtige Mann, der um den Hals ein rotseidenes Tuch mit einer Koralle als Busennadel trug und in dessen Ledergürtel außer einem Messer mit Scheide noch ein Tomahawk steckte, nickte nur und wiederholte: »Löscht das Feuer aus! Dann nehmt Eure Pferde und folgt mir!«
»Wer seid Ihr denn?«, fragte der alte Benito misstrauisch, der ebenfalls aufgestanden war.
»Ein Trapper«, meinte der Blondbärtige schlicht.
»Oho!«, rief Sancho da. »Ein Trapper! Das besagt gar nichts! Es treibt sich jetzt genug weißes Gesindel in den Prärien herum, dem der Boden in den Städten zu heiß geworden ist! Fremder, wir sind keine Greenhorns, nein, im Gegenteil! Gewöhnlich ist es Sitte, dass man seinen Namen nennt, wenn man hier in der Wildnis …«
Der Blonde hatte die Achseln gezuckt und sich umgedreht, wollte wieder in den Büschen untertauchen.
Doch Sancho, von Natur hitzig und voreilig, fasste ihn rasch beim Arm und rief: »Halt, Mann, Euer Benehmen erscheint mir verdächtig!«
Der hochgewachsene Trapper hatte halb den Kopf zurückgewandt.
»Lasst mich los«, meinte er ruhig. »Wenn ich Euch gesagt habe, dass ich Euren Freund Juan vor dem Messerstich einer Rothaut bewahrte, so hättet Ihr …«
In demselben Moment ertönte außerhalb der Büsche in der Prärie das klägliche Heulen des Kojoten, des Präriefuchses.
Der Trapper hatte mitten im Satz seine Rede unterbrochen und schien angestrengt zu lauschen.
Die Büsche raschelten fortgesetzt im Wind, sodass schwächere Geräusche anderer Art kaum zu hören waren.
Abermals heulte draußen ein Kojote.
Da war der Trapper auch schon, Sancho beiseite schleudernd, mit beiden Füßen in die Flammen gesprungen, trat das Feuer aus und rief befehlend: »Rasch mit den Pferden über den Bach hinüber und dort auf den Hügel mit den drei Buchen hinauf. Mein roter Bruder Chokariga, der Schwarze Panther, warnt uns durch die Stimme des Präriefuchses!«
Der Name Chokariga veranlasste den alten Benito zu der überstürzten Frage: »Mann … Ihr seid Felsenherz, der Trapper, nicht wahr? … Ihr müsst es sein! Euer Äußeres …«
»Nehmt die Pferde!«, befahl der Blonde ärgerlich.
Das Feuer war erloschen. Nur einzelne Äste glimmten noch. Tiefes Dunkel herrschte nun auf der Lichtung. Die Vaqueros gehorchten eiligst. Im Nu hatten sie ihren Pferden die Fußfesseln abgenommen und führten sie aus dem Buschwerk heraus und durch den kaum anderthalb Meter tiefen Bach ans Südufer und weiter ein Stück durch die Prärie bis zu dem von drei alten Buchen gegrünten Hügel. Ihre Augen hatten sich wieder an die Dunkelheit gewöhnt. Als Benito als Erster den Hügel erreicht und erklommen hatte, fand er hier zu seinem Erstaunen den jüngsten Vaquero Juan bereits vor.
Da … jenseits des Baches ein gellendes Wutgebrüll, ein so durchdringendes Geheul aus zahlreichen Indianerkehlen, dass Sancho, der Indsmenfresser, Benito ganz heiser vor Erregung zuraunte: »Apachen sind’s! Das Gebrüll kenne ich! Wenn euch euer Leben lieb ist, Amigos, so verhaltet euch ganz still!«
Der Vaquero Juan erklärte jetzt hastig: »Wo sind denn Felsenherz und sein roter Freund, der Comanchenhäuptling, die mir vor einer knappen Viertelstunde das Leben retteten? Zwei Apachenspäher hatten mich bereits zu Boden gerissen, und das Messer des einen fuhr schon nach meiner Kehle, als Felsenherz die roten Schufte mit der Faust niederschlug. Er schickte mich dann über den Bach hierher und befahl mir, trockene Buchenäste zu sammeln für den Fall, dass die Apachen uns hier angreifen sollten. Da liegen schon drei Haufen für drei Feuer, deren Schein den Indsmen das Anschleichen erschweren und uns das Zielen erleichtern wird.«
Der alte Benito zeigte jetzt die meiste Entschlossenheit und Klugheit. »Verteilen wir uns hier auf der Spitze des Hügels«, sagte er. »Nur Juan mag bei den Pferden in der Mitte unter den Bäumen bleiben. Und sperrt die Augen auf, Amigos! Es geht um unsere Skalpe! Felsenherz und Chokariga werden sich schon einfinden. So berühmte Präriemänner wie die beiden lassen sich von den Apachen nicht abfassen! Da können wir ganz außer Sorge sein!«
Die fünf Vaqueros legten sich nun in nicht allzu weiten Zwischenräumen in das Gras und starrten aufmerksam in die dunkle Prärie hinab.
Das Gebrüll der Apachen war längst wieder verstummt. Nichts war mehr zu hören als das Rauschen der Buchen und das Wispern des Präriegrases.
Der ziemlich steile Hügel, der von den Vaqueros jetzt besetzt war, erhob sich etwa dreihundert Meter vom Bach entfernt aus der hier recht ebenen Grassteppe.
Sancho, der Indsmenfresser, hatte sich seinen Platz an der dem Bach zugekehrten Seite gewählt. In der Seele dieses Mannes, der viele Jahre einen unerbittlichen Vertilgungskrieg gegen die Apachen geführt hatte und der nun seinen alten Feinden hier wieder begegnet war, regte sich sehr bald die Angst um seine und seiner Freunde Sicherheit immer stärker. Nach kaum drei Minuten kroch er dann zu Benito hinüber und flüsterte ihm zu: »Alter Ben, es ist ein Unsinn, dass wir Felsenherz’ Befehl befolgt haben! Weshalb bleiben wir auf diesem Hügel? Wir wollen schleunigst zu Pferde uns nach Süden zu davonmachen. Unsere Gäule sind ausgeruht und …«
»Sancho!«, unterbrach der bejahrte Vaquero ihn, »ein Trapper wie Felsenherz rät nie etwas Dummes! Das solltest du dir selbst sagen! Wenn eine Flucht nach Süden möglich wäre, hätte …« Er schwieg. Denn von der Südseite des Hügels war der scharfe Knall eines Büchsenschusses herübergedrungen.
Fast gleichzeitig brüllte Juan: »Ich werde die Zweighaufen anzünden!«
Abermals ein Schuss, und dann die Stimme des an der Südseite postierten Mannes. »Sie sind da! Benito … Achtung!«
Juan hatte sein Präriefeuerzeug bereitgehalten.
Die Flammen lohten auf. Die drei Reisighaufen gaben genug Licht, um die Abhänge des Hügels übersehen zu können, die nur schwachen Graswuchs hatten.
Merkwürdigerweise erfolgte jedoch kein Angriff vonseiten der Apachen. Keine Rothaut ließ sich blicken. Sancho war an seinen Platz zurückgekehrt, versuchte nun mit den Augen das Dunkel dort unten zu durchdringen und entdeckte doch keine Spur von den gefürchteten Feinden.
»Wer weiß, worauf der Alfonso geschossen hat!«, brummte er ärgerlich. »Wir hätten fliehen sollen! Das wäre das Richtige gewesen!«
Juan war indessen auf eine der Buchen geklettert und schlug hier mit einem Handbeil ein paar starke trockene Äste ab.
Als er nun wieder herabturnte und sich von dem untersten Ast zu Boden fallen lassen wollte, krachte in der Prärie dicht vor Sanchos Beobachtungsplatz ein Schuss.
Juans Filzhut flog ein Stück davon und fiel in eins der Feuer. Die Kugel hatte den Hut getroffen und noch des Vaqueros Kopfhaut leicht gestreift.
»Ah … so ist’s gemeint, verdammtes Gesindel!«, fluchte der Indsmenfresser, zielte kurz und feuerte auf die Stelle, wo er soeben den Schuss dort am Fuß des Hügels hatte aufblitzen sehen.
Sancho hatte nicht umsonst so viele Jahre in der Wildnis sich mit den Rothäuten herumgeschlagen.
Auf seinen Schuss hin schnellte aus dem Gras ein Apache hoch und sank dann wieder rücklings zu Boden.
»Der Fünfundvierzigste!«, brummte Sancho, und seine Augen leuchteten in unauslöschlichem Hass. »Das halbe Hundert wird diesmal noch voll werden! Dann habe ich meinen Schwur erfüllt … endlich!«
Er lud schnell den abgeschossenen Lauf seiner Doppelbüchse und stieß die Kugel mit dem Ladestock fest.
Juan, trotz seiner erst 20 Jahre doch nicht ganz unerfahren, nahm sich den Schuss und den verbrannten Hut zur Warnung und erstieg die andere Buche von der Innenseite, sodass er von der Prärie aus nicht beschossen werden konnte. Er musste für neues Feuerungsmaterial sorgen, da die Flammen bereits bedenklich zusammensanken und die Nacht noch lang war.
Gerade als er diesen zweiten Baum glücklich erklettert hatte, knatterten aus dem Dunkel heraus einige zwanzig Schüsse, die sämtlich den armen Pferden gegolten hatten.
Die sechs Tiere, die nur mit den Zügeln zusammengebunden und nun von mehreren Kugeln getroffen waren, keilten erst wild aus, rissen sich voneinander los und jagten dann den Hügel nach verschiedenen Seiten hinab. Benito blickte ihnen beklommen nach. Ein Vaquero ohne Pferd ist nur noch ein halber Mensch. Diese Leute, von Jugend an im Sattel, von Jugend an gewohnt, kaum ein paar Schritte zu Fuß zu gehen, sind ohne ihr Pferd fast wie ein Lahmer, dem man die Krücken weggenommen hat. Kein Wunder, dass der alte Vaquero es fast bereute, so ohne Weiteres den Rat des Trappers Felsenherz befolgt zu haben, zumal die Apachen, die unten in der Prärie im hohen Gras lagen, das Davonstürmen der sechs Tiere mit einem gellenden Hohngeschrei begleitet hatten.
Und weiter verging den auf dem Hügel Umzingelten die Nacht in derselben Weise unter steter Wachsamkeit und steter Sorge, dass die Rothäute jeden Augenblick einen allgemeinen Angriff wagen konnten.
Dann begann der Morgen zu grauen. Das dunkle Gewölk, das bisher den Himmel bedeckt hatte, lichtete sich gleichzeitig und mit den ersten Sonnenstrahlen spannte sich ein blauer, wolkenloser Himmel über die endlose Prärie aus, in der eine trügerische, verderbendrohende Ruhe herrschte, denn … von den Apachen war weit und breit nichts zu bemerken. Selbst der durch Sancho erschossene Indianer war verschwunden.
Die sechs Vaqueros wussten trotzdem, dass zahlreiche Augenpaare dauernd den Hügel beobachteten und dass jeder Buschstreifen, jeder Strauch ringsum einige der roten Feinde verbarg.




