Xaver Stielers Tod – Kapitel 15
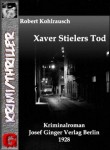 Robert Kohlrausch
Robert Kohlrausch
Xaver Stielers Tod
Kriminalroman
Erschienen 1928 im Josef Ginger Verlag Berlin
Fünfzehntes Kapitel
Der frühe Morgen, von trübem Regendunst wenig verheißungsvoll umwölkt, fand Stefan doch schon wieder wach. Er brannte darauf, seinen Entschluss auszuführen, und erhob sich weit vor seiner gewohnten Zeit. Aber ein paar Stunden mussten in Untätigkeit und Grübelei noch gewartet werden, bis er zur Tat machen konnte, was ihm Erleichterung für seine Pein verschaffen sollte.
Der Untersuchungsrichter, der den ungerecht auf Stefan gefallenen Verdacht lebhaft bedauerte, kam seinen Wünschen freundlich entgegen, als er sie persönlich vortrug. Und so fand er sich bald im Besitz einer schriftlichen Erlaubnis, Hanna Rainer in ihrer Untersuchungshaft aufzusuchen zu dürfen.
Jähes Angstgefühl überfiel ihn plötzlich. Was er sich als Befreiung von schwerer Qual erdacht hatte, verwandelte sich nun, es Wirklichkeit werden sollte, in schmerzliches Gefühl. Was wird dies Wiedersehen bringen, welches Ende mochte diese Begegnung nehmen? Zukunft und Glück hingen ab von dem, was die nächste Stunde gab oder nahm. Langsamer, weit langsamer, als er in begieriger Hoffnung sein Haus verlassen hatte, machte Stefan den Weg zu dem großen, roten, düster durch den Regen blickenden Gebäude, hinter dessen Gittern er Hanna wiedersehen sollte.
Die schweren eisernen Torflügel hatten sich für ihn geöffnet und hinter ihm geschlossen, er ging über einen von des Tages Feuchtigkeit schwarzen Hof, durch einen langen, hallenden Gang mit geweißten Wänden. Eine Tür wurde wieder für ihn aufgetan, und nun blieb er allein in einem nüchtern, öden Sprechzimmer, das frostige Kühle von seinen Wänden auszuströmen schien. Ein lautes Brausen des Blutes war in Stefans Ohren, atemraubend schlug ihm das Herz in der Brust.
Ein Laut von der Tür, – er wandte sich mühsam um. Das Misstrauen gegen Hanna lag auf ihm gleich einer schweren Last. Nun stand sie vor ihm, die beiden Hände nach ihm ausgestreckt, bleich und mit grauen Schatten unter den müden Augen, aber doch mit einem Licht heller Freude darin.
»Gott sei Dank, du bist gekommen!«
Er stand vor ihr, als ob er ihre ausgestreckten Hände nicht sähe, wiederholte nur mit heiserer Stimme tonlos: »Ja, ich bin gekommen.«
Ein Erstaunen, bisher noch kein Schrecken, wurde in ihrem Blick wach. Sie schaute zu dem Beamten hinüber, der ihrer Unterredung beiwohnen musste und sich, eine Zeitung hervorziehend, auf die Bank unter dem Fenster setzte, mit ihren Augen fragend, ob dieses Mannes Anwesenheit an Stefans verwandeltem Wesen die Schuld habe.
Dann ergänzte sie die stumme Frage durch Worte. »Wir können offen miteinander sprechen. Was wir sagen, kann jedermann hören. Ach, und ich habe solche Sehnsucht gehabt, mich auszusprechen mit dir. Du weißt ja, was andere von mir denken, gilt mir gleich. Aber ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können, weil ich mir immer wieder überlegte, was ich dir sagen würde, wenn du kämst. Ich wusste ja, dass du kommen würdest, wenn es möglich wäre. Du hast es möglich gemacht, und ich kann dir nun danken, dass du da bist.«
Wieder streckte sie die Hände nach ihm aus, und er konnte nicht widerstehen, er legte die seinen hinein.
Aber zugleich fuhr es ihm durch den Sinn: Weshalb hatte sie die Worte schlaflos immer wieder überlegen müssen, die sie mit ihm sprechen wollte? Die Wahrheit brauchte keine Vorbereitung und kein Überlegen. Doch er fragte nicht, sondern blieb stumm wie bisher, und sie war so voll von dem, was ihr Herz bewegte, dass ihr seine Schweigsamkeit nicht auffiel.
Unaufhaltsam brach es aus ihr hervor, was die lange Nacht hindurch nach Worten gesucht und gedrängt hatte. »Mir ist immer noch, als wenn ich in einem wüsten Traum wäre. Dass ich dir hier gegenüberstehen muss, ist es denn fassbar, ist es denkbar? Ich verhaftet, ich im Gefängnis, angeklagt, einen Menschen vergiftet zu haben! Wenn ich mir mein Vaterhaus vorstelle, meine Kindheit, mein ganzes Werden und Wachsen fern von allem Hässlichem, aller Not – und nun hier! Ich kann es immer noch nicht glauben, obwohl ich es mit Augen sehe. Wie vom Blitz getroffen war ich, als ich so plötzlich verhaftet wurde. Nur der Gedanke an dich hat mir Halt gegeben. Ich wusste, du würdest unerschütterlich fest an mich glauben, mochte sich auch sonst alles gegen mich wenden, mochte sich das Netz des Verdachtes noch fester und enger schürzen in furchtbarer Verstrickung.«
Sie schwieg eine Sekunde lang atemlos. Der Graf schaute düster vor sich hin und sagte langsam: »Eine furchtbare Verstrickung, – ja.«
»Das ist es. Man muss vernünftig und gerecht sein. Ich bin heute früh schon vernommen worden, und es ist mir dabei zum klaren Bewusstsein gekommen, wie vieles mich zu belasten und gegen mich zu zeugen scheint. Sie haben wirklich kaum anders gekonnt, als mich zu verhaften, von ihrem juristischen Standpunkt aus. Dass ich diesen Inder gekannt habe, das ist mein größtes Unglück.«
»Aber woher …?«
»Woher ich ihn kenne? Du hast es wohl vergessen, ich habe schon einmal davon gesprochen, dass er neben seiner Bühnentätigkeit spiritistische Sitzungen hielt, an denen ich teilgenommen habe, weil sie mich interessierten. Wenn ich geahnt hätte, dass unter all den Teilnehmern gerade nur ich dieses Menschen Augen auf mich ziehen würde, dass er sich in mich verliebte …«
»Hanna! Dieser fremde Zauberkünstler in dich verliebt?«
»Leider ja. Dadurch hat sich das Unheil angesponnen. Er ist oft an unserem Haus vorbeigegangen, er hat dort gestanden und nach meinen Fenstern hinübergeschaut. Man weiß das von ihm selbst. Er ist auch verhaftet worden und hat es vor Gericht ausgesagt. Ich habe ja nichts davon geahnt.«
»Hanna, das ist nicht wahr!«
»Stefan!«
»Ich weiß, von einer Zusammenkunft mindestens weiß ich, die du mit ihm gehabt hast.«
Sie hatte mit erschrockenem Staunen bei seinem heftigen Ausbruch aufgeschaut, nun aber schüttelte sie mit ruhigem Lächeln den Kopf.
»Stefan, du bist eifersüchtig auf diesen Menschen, der mir so gleichgültig ist, wie die Steine dieser Wand.«
»Seit wann denn gibt eine Dame von gutem Ruf einem künstlerischen Landstreicher ein Rendezvous, wenn er ihr gleichgültig ist?«
Hanna blieb auch jetzt noch ganz ruhig. Das milde Lächeln verschwand nicht von ihrem Gesicht. »Was ich getan habe, tat ich für dich. Alles, alles, – auch dies.«
»Das kann ich nicht verstehen«, stieß er kurz hervor.
»So lass mich dir’s erklären. Sieh, du warst selbst ja doch auch in Verdacht gekommen, deshalb war ich in Todesangst um dich und habe mir den Kopf zermartert, wie dir zu helfen wäre. Da bin ich an einem Abend ans Fenster getreten und habe hinausgeschaut, in meine Grübelei versunken. Gegenüber stand im Laternenlicht ein Mensch, den ich gar nicht beachtete, bis er zu mir herübergrüßte. Da fiel mir ein, dass es Amaru war, der Inder.«
»Der in dich verliebt war.«
»Ich wusste das damals ja noch nicht. In dem Augenblick schien es mir wie Schicksalsfügung, dass er dort stand. Meine Gedanken hatten sich schon viel mit ihm beschäftigt an dem Abend. Ich hatte mir gesagt, er war vermutlich in der ganzen Stadt hier allein im Besitz des Giftes gewesen, an dem dein Bruder gestorben war. Sollte durch ein Gespräch mit ihm nicht vielleicht herauszubringen sein, wer in seiner Wohnung an das Gift hatte kommen und einen Teil davon entwenden können? Das Gericht hatte den Punkt vielleicht nicht genügend scharf untersucht. Ich wollte sehen, ob ich auf diesem Weg etwas herausbringen könnte, was dich von diesem furchtbaren Verdacht entlastet. Da schrieb ich ihm und bat ihn um die Zusammenkunft, von der du gehört hast.«
»Von dir also ging es aus, dass …«
»Es mag unrichtig unklug, unpassend gewesen sein, dass ich es tat, aber nur deinetwegen ist es geschehen. Und wenn es unklug war, ich bin auf der Stelle dafür gestraft worden. Statt mir zu helfen, mir einen Wink zu geben, der mich auf die richtige Spur lenkte, fing dieser Mensch an – dort im Café, mitten unter all den Leuten, die vielleicht etwas davon hören konnten, – mir von seiner Liebe zu sprechen. Dass er nur an mich dächte, nicht ohne mich leben könnte, – was weiß ich? Darum hat er sich vor unserem Haus herumgetrieben, darum zu meinen Fenstern hinübergestarrt. Als ich das hörte, da bin ich rasch aufgestanden und fortgegangen und habe schon damals bitter genug bereut, was ich getan hatte.«
Stefan war noch tiefer in sein finsteres Grübeln versunken. Eine nach Hannas Worten eingetretene Stille unterbrach er durch die Worte: »Der Brief aber, den du geschrieben hast …«
»An Amaru?«
»Nein, an meinen Bruder.«
»Ich habe nur einmal an ihn geschrieben, als ich ihm ankündigte, dass ich ihn deinetwegen aufsuchen würde. Aber ich weiß, von welchem Brief du sprichst. Auch bei der Vernehmung war davon die Rede, dass ihn die Frau deines Bruders im Anzug des Toten gefunden hätte. Was ich dort über den Brief gesagt habe, kann ich dir nur wiederholen: Er war an dich, nicht an ihn.«
»Aber wie …?«
»Ja, ja, lass es dir sagen. Ich hatte zufällig keine Marken mehr im Haus, als ich den Brief geschrieben hatte. Da nahm ich ihn mit mir in meiner Tasche zur Post, an der ich doch bei nötigen Besorgungen vorüberkam. Unterwegs traf ich dich. Du warst eilig auf dem Weg zur Gesandtschaft. Ich konnte dir nur schnell die Hauptsache von dem sagen, was ich dir geschrieben hatte. Da sprach ich erst gar nicht von dem nun überflüssigen Brief, und auch hinterher unterblieb es durch Zufall.«
»Dass ich dich getroffen habe, weiß ich. Aber wie kam der Brief in meines Bruders Tasche?«
»Das war an dem Abend im Pavillon. Dein Bruder war ja so freundlich entgegenkommend auf meine Wünsche für dich. Als wir das Allgemeine durchgesprochen hatten, fing er an, von euren beiderseitigen Vermögensverhältnissen zu reden und wollte berechnen, wie viel jedem von euch blieb, wenn euer Vater dich nicht benachteiligte. Das ging nicht, ohne dass er es aufschrieb. Er suchte vergeblich nach Papier und beichtete mir mit seinem liebenswürdigen Lachen, dass er aus Künstlereitelkeit niemals ein Taschenbuch trüge, weil es die schlanke Figur verdürbe. Da fiel mir der Brief ein, der noch in meiner Handtasche steckte. Was darin stand, war ja für ihn kein Geheimnis. Ich gab ihm das Papier, er machte seine Berechnung darauf, und als wir die Hoffnung auf dein Kommen aufgeben mussten, verabredeten wir noch eine neue Zusammenkunft für einen anderen Tag, und er machte sich auf den Brief eine Notiz darüber. Ach, er hat ja den Tag nicht mehr erlebt.«
Stefans Gesicht hatte sich ein wenig aufgehellt, aber noch immer kämpften Zweifel und Glauben in seinen Zügen. »Ach, Donner, wenn ich dir glauben könnte«, rief er mit einem ähnlich zwiespältigen Ton.
»Wenn – was …?«
Erschrocken über den Klang ihrer Worte sah Stefan auf Hanna. »Ja, ja, wenn du mir alle die Zweifel vom Herzen wegnehmen könntest, von denen ich so schändlich gepeinigt werde, dann – wahrhaftig Hanna, dann wär’ ich der glücklichste Mensch«.
»Stefan!« Es war ein heiserer Schrei, womit sie seinen Namen rief. Und er sah gleichzeitig einen Ausdruck von fassungslosem Entsetzen auf ihrem Gesicht wie nie zuvor auf dem eines anderen Menschen. Abwehrend hatte sie die Hände gegen ihn ausgestreckt, als ob er mit einer Mörderwaffe vor ihr stände. Ganz langsam, Silbe für Silbe, wie fallende Blutstropfen kam es von ihren Lippen: »Du, – du, – Stefan, – du zweifelst an mir?«
»Ja, lass mich wahr sein. Es ist furchtbar, aber es ist so. Solchen Tag wie gestern habe ich noch niemals erlebt. Und wenn ich …«
»Du zweifelst an mir, – es ist ja nicht möglich.« Sie stand wie zu Stein geworden. Kaum hörbar klangen ihre Worte durch den öden Raum.
»Vergib mir, Hanna, wenn ich es getan habe, wenn ich es noch tue. Die Wahrheit muss heraus. Alles, was du mir gesagt hast, klingt wahrscheinlich und glaubhaft. Aber da gibt es noch etwas anderes. Die Baratta will gesehen haben, du hättest meinen Bruder in seiner Wohnung geküsst …«
»Stefan!«
»Sie hat es ausgesagt vor Gericht, sie will es beschwören …«
»Jetzt ist es aus.« Die Hände sanken Hanna schlaff herab, ihr Kopf neigte sich vornüber, sie schien unter einem furchtbaren Druck kleiner zu werden. »Du glaubst einem vor Eifersucht wahnsinnigen Weib mehr als mir, – jetzt ist es aus.«
»Verzeih mir, hab ein wenig Geduld mit mir, – ich glaubte dir ja so gern, – aber ein Eid …!«
Hanna starrte vor sich nieder auf den Boden und sprach so nach unten hin, als ob sie dort undeutlich niedergeschriebene Worte mühevoll ablese. »Du warst mir alles. Warst mir der feste Grund, auf dem ich stand. Warst mir ein Fels, auf den ich mein Leben baute. Du hast ihn mir unter den Füßen fortgezogen, – jetzt ist es aus.«
»Hanna, – Hanna, – höre mich doch …!«
»Ich hätte nicht an dir gezweifelt, und wenn eine Million Zeugen eine Million Eide gegen dich geschworen hätten. Du hast es getan. Was nun kommt, gilt mir gleich. Mögen sie mit mir machen, was ihnen beliebt.«
»Glaub mir doch, dass ich selbst am allerschwersten unter meinen Zweifeln leide. Dass meine Liebe zu dir …«
»Davon sprich mir nicht mehr. Geh!«
»Dich verlassen soll ich, – so, – so dich verlassen?«
Langsam, automatenhaft wandte sie sich zu dem Beamten um. »Wir wollen gehen, – kommen Sie.«
»Mein Gott, Hanna …«
Sie hob die Hand, um sie gleich wieder bleischwer sinken zu lassen. Ohne Blick, ohne Wort ging sie mit schweren Schritten an ihm vorüber und hinaus.
Es war Stefan, als ob auch ihm der Boden unter den Füßen wankte. Schwindelgefühl ergriff ihn, er meinte, die Mauern fielen auf ihn herab. In dumpfer Geistesabwesenheit ging er über den weißen Gang zurück, über den schwarzen Hof. Alles erschien ihm wie eine Traumumgebung undeutlich und schattenhaft. Er fuhr zusammen, als er Stimmen im Torwächterzimmer vernahm. Eine weibliche Stimme war es und eine männliche. Langsam kam ihm das Gefühl, dass ihm die weibliche Stimme bekannt war. Und er sah nun auch nähertretend, wer dort sprach. Liselotte Hell war es, die lebhaft, mit gerötetem Gesicht auf den Wärter einredete. Sobald sie Stefan erblickte, wandte sie sich aber mit rascher Bewegung ihrer kleinen Gestalt auf ihn zu.
»Graf Hersberg, Sie! Das ist ja herrlich, dass ich Sie hier treffe. Sie müssen mir helfen. Ich will Hanna besuchen, unsere liebe, liebe, so schändlich misshandelte Hanna. Der Mann hier will mich nicht hineinlassen. Sie müssen ihm sagen, dass ich ihre Freundin bin, dass ich sie notwendig, notwendig, notwendig sehen muss.«
»Ich kann dabei nichts machen«, sagte Stefan und wunderte sich über den verwandelten Klang seiner Stimme. »Sie müssen Erlaubnis haben, und es ist nicht so leicht, sie zu bekommen.«
»Aber Sie waren doch drin, Sie haben doch Hanna gesehen?«
»Ich habe sie gesehen.« Dumpf und schwer klangen die Worte.
»Wie geht es ihr? Wie hat sie ausgesehen, unsere gute, liebe, arme Hanna? Oh, diese schändlichen, schändlichen Menschen, die sie so ins Unglück hineingebracht haben!«
Langsam hob Stefan den Kopf und sah mit brennenden Augen auf das durch freundschaftlichen Eifer gerötete zierliche Gesicht von Liselotte. »Sie halten Hanna für unschuldig?« Dumpf und schwer tat er auch diese Frage.
»Ob ich, – aber wie können Sie denn überhaupt so fragen, Graf? Da gibt es doch gar keinen Zweifel. Wer sie hineingebracht hat in dies Unglück, wir wissen es ja leider Gottes immer noch nicht, aber dass Hanna keinen Menschen ermordet hat, – ach, es ist ja Unsinn, überhaupt nur davon zu reden. Wir kennen doch unsere Hanna, Sie haben sie von ganzem Herzen lieb, – jawohl, wir können jetzt offen darüber sprechen, – wie sollte da von uns einer an ihr zweifeln?«
»Schelten Sie mich, schelten Sie mich tüchtig aus, meine gute, warmherzige kleine Richterin. Ich habe wirklich …«
»Schelten. Das will ich Ihnen besorgen. Sie haben wirklich gezweifelt an unserer ehrlichen, wahrhaften, jede Verstellung und Lüge hassenden Hanna? Dann kann ich nur sagen: Schämen Sie sich, Graf Hersberg. Jawohl, schämen Sie sich so gründlich, wie sich ein Mensch nur schämen kann. Dann verdienen Sie dieses große, gute, warme Herz von Hanna ja gar nicht. Sie müssen sich schämen, schämen, in Grund und Boden schämen, – so wahr hier ein Mann kommt, auf den ich ebenso wütend bin wie auf Sie.«
Während sie sprachen, hatte der Wächter durch stummes Öffnen des Tores ihnen zu verstehen gegeben, dass ihres Bleibens in seinem kleinen Reich nicht länger sei. Stefan war auf die Straße hinausgetreten, und Liselotte war ihm dorthin gefolgt. In ihrem freundschaftlichen Eifer hatte sie kaum bemerkt, wie sich das Tor – vielleicht absichtlich leise – hinter ihnen schloss. Jetzt war ihr Blick nach links hin die regennasse Straße hinuntergeglitten, und sie hatte dort einen Herrn eilig herankommen sehen. Stefan war ihr mit seinen Augen gefolgt und hatte nun auch den sich Nahenden erblickt. Er machte mit Kopf und Hand eine Bewegung heftigen Unmuts und sagte: »Grabert, – er? – Dem will ich nicht begegnen. Er hat mich in dies abscheuliche Misstrauen hinein gehetzt. Leben Sie wohl, mein liebes gnädiges Fräulein und entziehen Sie mir Ihre Gnade nicht ganz.«
Er wandte sich eilig um und ging die Straße zu der Seite hinunter, wo Grabert ihm nicht begegnen konnte.
»Guten Tag, verehrte Kollegin«, sagte der herangekommene Detektiv. »Warum läuft Graf Hersberg denn so rasch vor mir davon?«
»Wahrscheinlich, weil er inzwischen auch erkannt hat, was für ein schlechter, abscheulicher Mensch Sie sind. Jawohl, starren Sie mich nur mit Ihren großen Augen an. Das macht mir gar keinen Eindruck mehr.«
»Nicht mehr? Ich bemerke zu meiner Freude, Sie mischen in den Essig Ihrer Missgunst wenigstens ein Tröpfchen Süßigkeit. Wenn auch der Himmel Ihrer Gunst leider augenblicklich umwölkt ist, so scheint mir doch, das tempus praeteritum war nicht so ganz ungünstig für mich.«
»Ach, ob Sie lateinisch, türkisch oder arabisch reden, das ist mir ganz egal. Wütend bin ich auf Sie, geradezu wütend. Und nur, um das noch vom Herzen loszuwerden, bin ich nicht auch vor Ihnen davongelaufen wie der Graf.«
»Aber neulich sind wir doch ganz gute Freunde gewesen, – an dem Abend, als ich den Vorzug hatte, das gnädige Fräulein aus dem Wasser zu ziehen. Es war sogar die Rede von einem Teilhabergeschäft.«
»Lassen Sie mich nur mit Ihren Geschäften in Ruhe. Mit Ihnen will ich keinerlei Gemeinschaft mehr haben. Sie haben mich betrogen und hintergangen, – jawohl! Mich und meine gute, brave Knusperhexe die Sie jetzt auch mit Vergnügen bei lebendigem Leib braten würde, wie die wirkliche Knusperhexe das mit Hänsel und Gretel tun will. Sie haben sich gestellt, als ob der ganze Zweck von Ihrem Herumspionieren der wäre, den Grafen Hersberg zu entlasten, und im Geheimen haben Sie gegen meine liebe, liebe, gute Hanna Rainer gearbeitet. Sie sind schuld, Sie ganz allein, wenn sie jetzt hinter dieser gräulichen, scheußlichen Mauer gefangen sitzt, und wenn ich hier stehen muss und nichts machen kann, als heulen über Hannas Unglück und Ihre Schlechtigkeit.«
Sie hatte zur Bekräftigung ihrer Worte mit ihrem aufgespannten Regenschirm ein paar für den Schirm sehr schädliche, sonst aber gänzlich eindruckslose Stöße gegen die Mauer des Gefängnisses getan und brach nun in herzhaftes Weinen aus.
»Aber mein gnädiges Fräulein …«
»Ich bin kein gnädiges Fräulein für Sie«, brachte sie schluchzend hervor, doch ließ er sich nicht irre machen.
»Hören Sie mich nur wenigstens an. Ich kann Ihnen sagen, je mehr ich über die Sache nachdenke, umso weniger kann auch ich an die Schuld Ihrer Freundin glauben. Wieweit – ich bin doch auch nur ein Mensch – meine wahrhaft herzliche Zuneigung für Sie dabei mit spielt …«
»Ach, sprechen Sie doch nicht von solchen Dingen.« Ihre Tränen hörten plötzlich auf zu fließen, und sie warf ihm einen immer noch nassen, aber doch erheblich besänftigten Blick zu.
»Doch, davon muss ich reden. Wenn es auch ein ganz unpassender Moment ist, ich muss Ihnen sagen, dass ich Sie schauderhaft gern habe. Wahrhaftig, seit unserer nassen Begegnung neulich am Abend bin ich mit meinen Gedanken immerfort bei Ihnen gewesen. Ich habe nur Ihretwegen so viel auch an Fräulein Rainer gedacht, nur Ihretwegen bin ich heute hier auf dem Weg zu ihr …«
»Sie wollen zu Hanna?«
»Jawohl. Ich will noch einmal mit ihr sprechen und sehen, ob wir die Wahrheit nicht endlich doch ans Licht bringen können. Und so wahr ich hier stehe, das geschieht Ihretwegen, Fräulein Liselotte.«
»So vertraulich brauchen Sie noch nicht gleich zu sein deswegen und mich Liselotte zu nennen«, sagte sie mit einem letzten kleinen Schluchzen. »Aber wenn die Sache so liegt, wie Sie sagen, dann machen Sie doch schnell und gehen Sie hinein. Und befreien Sie meine Freundin aus diesem grässlichen scheußlichen Gefängnis. Und wenn Sie das getan haben, dann können wir ja vielleicht – ich sage vielleicht – auch einmal über etwas anderes sprechen. Und nun machen Sie schnell, schnell, schnell – adieu.«
Sie wandte sich um und lief davon in den graubraunen Regendunst hinein. Grabert aber nahm sich noch vollkommen Zeit, ihr nachzuschauen, solange sie sichtbar war, und sagte dabei mit liebevollem Nachdruck: »Du bist wahrhaftig ein reizender Balg!«




