Felsenherz der Trapper – Teil 7.2
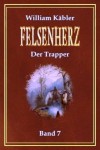 Felsenherz der Trapper
Felsenherz der Trapper
Selbsterlebtes aus den Indianergebieten erzählt von Kapitän William Käbler
Erstveröffentlichung im Verlag moderner Lektüre GmbH, Berlin, 1922
Band 7
Die Mumie Matazumas
Zweites Kapitel
Von Apachen gehetzt
Die warme Mittagssonne schien in einen von hohen Bergen umgebenen Felsenkessel hinein, an dessen Ostwand hinter einer Gruppe von Tannen ein kleines Blockhaus stand.
Vor diesem Blockhaus lag auf einem weichen Graslager ein Indianer, dessen schwarzes, langes Haar schopfartig hochgebunden und mit Adlerfedern und Perlenschnüren verziert war.
Das linke Bein der Rothaut trug am Oberschenkel einen Verband. Ein vergifteter, aus dem Hinterhalt abgeschossener Pfeil hatte den Schwarzen Panther, den berühmten Comanchenhäuptling, vor vierzehn Tagen getroffen und ihn auf ein langes Krankenlager geworfen.
Neben dem Comanchen lehnte an einer Tanne eine Doppelbüchse. Außerdem hatte er noch im Gürtel ein Jagdmesser und einen zierlich gearbeiteten Tomahawk stecken.
Der Häuptling blickte abermals zur Sonne empor. In seinem edel geschnittenen Gesicht zeigte sich eine gewisse Unruhe.
Er erwartete seinen weißen Bruder Felsenherz, der am Morgen den Talkessel verlassen hatte, um irgendein Wild zu schießen.
Felsenherz hätte längst zurück sein müssen. Allerdings hatte er, als er heute kurz nach Sonnenaufgang aufbrach, dem Comanchen erklärt, es sei leicht möglich, dass er länger ausbleiben würde, da es zu gefährlich sei, so nahe den Felsendörfern der Apachen, die am Rio Pecos hauptsächlich wohnten, durch den Knall einer Büchse deren Aufmerksamkeit zu erregen.
Trotzdem befiel den Schwarzen Panther nun eine von Stunde zu Stunde wachsende Sorge um seinen weißen Bruder.
Als er sich mühsam in die Blockhütte geschleppt hatte, die durch eine Balkenwand von dem längst verstorbenen Erbauer in zwei Räume abgeteilt war, und hier seinen Hunger durch gebratenes Hirschfleisch gestillt hatte, ergriff er seine Büchse und humpelte am Ufer eines klaren Baches, der den Talkessel durchfloss und durch einen Felsentunnel in das östlich gelegene Tal weiterströmte, bis an den Tunneleingang, stieg hier in das Wasser hinein, hielt die Büchse hoch über den Kopf und watete durch den dunklen Kanal in das Nachbartal, das sich nach Osten zu öffnete und von dessen Eingang man einen weiten Ausblick über die am Fuß der Berge sich hinziehende Prärie hatte.
Hier setzte er sich in ein Gebüsch auf einen Felsblock und konnte nun sowohl den Taleingang als auch die Prärie im Auge behalten.
Die Sonne neigte sich bereits den westlichen Bergspitzen zu.
Der Schwarze Panther wurde immer unruhiger. Er war jetzt überzeugt, dass Felsenherz etwas zugestoßen sein müsse.
Dann erblickte er draußen in der Prärie einen einzelnen Reiter, der soeben zwischen einer der Buschinseln hervorgekommen war.
Der Mann war ein Weißer und hing völlig erschöpft auf seinem schaumbedeckten Tier.
Das Pferd raste in unsicheren Sprüngen weiter. Der Comanche erkannte bald, dass es verwundet war. Mit einem Mal sank es denn auch vorn in die Knie.
Der Reiter flog über den Pferdehals hinweg ins Gras, sprang aber sofort wieder auf und schnallte dem jetzt matt am Boden liegenden Tier den Sattel und den Zaum ab, nahm seine Büchse auf und schaute sich suchend um.
Der Weiße war recht klein von Gestalt, aber ziemlich breitschultrig, trug eine Art Sportanzug und dazu einen Tropenhelm. Als er das Flüsschen und den Taleingang erblickte, lief er darauf zu, indem er sich bemühte, auf dem hier bereits felsigen Boden möglichst wenig Spuren zurückzulassen.
Er näherte sich dem Versteck des Comanchen, der ihn dann vorüberließ, ohne ihn anzurufen Der Kleine warf sich am Ufer des reißenden. schäumenden Flüsschens lang hin und schöpfte mit einem Blechbecher das kühle Wasser, trank gierig, erhob sich wieder und sah sich dem Schwarzen Panther gegenüber, der leise herbeigeschlichen und wie eine Statue regungslos auf seiner Büchse lehnte. Nur seine Augen durchforschten das pausbackige Gesicht des kleinen Mannes und nahmen dann allmählich einen freundlicheren Ausdruck an.
Der Kleine war vor Schreck wie gelähmt. Er glaubte, einen der gefürchteten Apachen vor sich zu haben, erinnerte sich jedoch sehr bald, dass die Apachen ja die Schädel bis auf eine Skalplocke rasiert trügen. Außerdem hatte diese Rothaut auch ein so intelligentes, offenes Gesicht, dass seine anfängliche Angst immer mehr schwand.
»Das Bleichgesicht ist auf der Flucht«, sagte der Häuptling nun. »Vor wem flieht der kleine Jäger?«
»Vor weißen Banditen und einer Schar Apachen«, stieß der Kleine hervor. »Mein Name ist John Crax. Ich bin der Diener eines sehr berühmten aber auch sehr verdrehten Gelehrten.«
»Wo wurde das Bleichgesicht überfallen?«
»Dort im Süden, wo die Jicarilla-Berge beginnen, und zwar heute Mittag. Das heißt, überfallen wurde ich selbst nicht. Nur mein Herr und der Springende Hirsch, ein Apache, der unser Führer ist. Ich war von unserem Lagerplatz nach Westen zu in die Prärie hinausgeritten, um einen Büffel zu schießen. Mit einem Mal hörte ich vom Lager her Schüsse und ein wütendes Geheul. Ich ließ mein Pferd in einem Busch zurück und kroch näher an die Talmulde heran, wo Master Blubb, mein Herr, und der Apache sich befanden. Die Sträucher machten es mir leicht, bis an den Rand des kleinen Tals heranzukommen. Da sah ich meinen Herrn und den Springenden Hirsch am Boden liegen. Die Talmulde wimmelte von Rothäuten, auch waren fünf Weiße darunter, die ich schon in El Paso bemerkt hatte. Ich wollte mich nicht auch gefangen nehmen lassen und eilte zu meinem Pferd zurück, wurde jedoch bemerkt und von fünfzig Roten gehetzt, die ich dann erst vor einer halben Stunde, nachdem sie mein Pferd angeschossen hatten, auf steinigem Boden von meiner Fährte ablenken konnte.«
»Hat das Bleichgesicht vielleicht einen blondbärtigen, großen Trapper gesehen?«, fragte der Häuptling nun.
Crax verneinte.
»Wie viele rote Krieger waren es?«, forschte der Schwarze Panther weiter.
»Mindestens hundertfünfzig. Sie hatten alle nur Skalplocken, trugen die Oberkörper nackt und waren mit schwarzen und roten Strichen bemalt. Ihr Häuptling war ein reiner Riese und hatte um die Adlerfedern und den Hals Ketten von Raubtierzähnen.«
Der Schwarze Panther nickte. »Die stinkenden Kröten der Apachen und ihr Oberhäuptling, der Große Bär, sind die Todfeinde Chokarigas, des Schwarzen Panthers. Das Bleichgesicht mag jenes Tal entlangschreiten und durch den Kanal und das Flüsschen in das nächste Tal sich begeben. Der Schwarze Panther wird ihm bald folgen.«
John Crax’ Miene hellte sich auf.
»Oh, von dem großen Häuptling der Comanchen habe ich in El Paso viel gehört«, rief er. »Der Schwarze Panther soll es nicht bereuen, wenn er mich unter seinen Schutz nimmt. Ich bin nicht feige. Nur ein Greenhorn bin ich. Aber das wird mit der Zeit wohl abgestreift werden können, das Greenhorn! – Noch etwas möchte ich dem Schwarzen Panther anvertrauen. Wir suchen eine Mumie. Und diese soll sich in einem Talkessel befinden, in den man nur durch einen Kanal hineingelangen kann, wie der Springende Hirsch uns erzählte, meinem Herrn und mir. Dies da sind ja auch die Jicarilla-Berge, und es wäre wirklich ein merkwürdiger Zufall, wenn ich auf meiner Flucht gerade an den Ort gekommen wäre, der unser Reiseziel war.«
Der Comanche hatte aufgehorcht.
»Die Bleichgesichter suchen eine Mumie?«, meinte er schnell. »Befindet sie sich in einem alten Blockhaus jenes Tals?«
Crax nickte eifrig. »Stimmt, Schwarzer Panther, stimmt, in einer verlassenen Blockhütte.«
Der Schwarze Panther überlegte und sagte dann ernst: »Das Bleichgesicht hat sein Reiseziel erreicht. Aber ich verbiete dem Bleichgesicht, die Blockhütte zu betreten!«
»Wenn es weiter nichts ist, Häuptling!«, erwiderte der Kleine achselzuckend. Ich mache mir aus Mumien verdammt wenig! … Hm … Ob die Apachen meinen Herrn etwa töten werden? Dann … dann möchte ich doch lieber versuchen, ihn zu befreien! Er soll mir nicht vorwerfen können, ich hätte ihn in der Not im Stich gelassen.«
Über des Comanchen Gesicht huschte ein Lächeln. »Das Bleichgesicht würde seinen Skalp umsonst opfern. Die Apachen werden das andere Bleichgesicht nicht lange mehr in ihrer Mitte haben. Mein weißer Bruder Felsenherz ist heute gleichfalls nach Süden zu auf die Jagd geritten und wird den stinkenden Apachenkröten bereits auf den Fersen sein. John Crax möge jetzt den Talkessel aufsuchen und …«
Er schwieg plötzlich.
Er hatte während dieses Gesprächs mit Crax die Prärie dauernd im Auge behalten, gewahrte nun einen einzelnen Reiter, der quer über dem Sattel noch einen zweiten Mann liegen hatte.
Und hinter diesem Reiter brachen aus einem fernen Wald eine Anzahl Verfolger hervor – alles Indianer, Apachen mit wehendem Federschmuck.
***
Um die Mittagsstunde des Tages hatte ein ganz in Leder gekleideter, blondbärtiger jüngerer Mann auf seinem hochbeinigen, schnellen Braunen südlich der Jicarilla-Berge einen Büffel geschickt von der übrigen Herde getrennt und dann durch einen wohlgezielten Schuss vom Sattel aus niedergestreckt.
Dieser junge Trapper war Felsenherz Als er gerade die Lendenstücke dem Büffel herausgeschnitten hatte, wurde er durch ein Schnauben seines Pferdes gewarnt, dessen indianische Dressur für einen Westmann so überaus wertvoll war.
Felsenherz sprang sofort auf, spannte die Hähne seiner Doppelbüchse und kroch aus der kleinen Schlucht empor, in der er den Büffel erlegt hatte.
Nun hatte er einen guten Rundblick über die etwas tiefer liegende Prärie.
So sah er denn etwa achthundert Meter nach Osten zu einen kleinen Weißen, der in langen Sprüngen auf ein paar Büsche zulief, wo er sich auf sein Pferd warf und nach Norden weiterjagte.
Hinter ihm waren etwa fünfzig Apachen, die aus einem Waldstreifen im Südosten aufgetaucht waren.
Felsenherz beobachtete die Verfolgung, bis der kleine Weiße und die Apachen hinter einer vorspringenden Hügelkette verschwunden waren.
Felsenherz blieb am Rande der Schlucht liegen. Er wollte feststellen, ob noch mehr Apachen den Waldstreifen verlassen würden.
Und wirklich – sehr bald tauchten weitere Rothäute auf, eine endlose Kette, wohl gegen neunzig Krieger, denen fünf Weiße und ein besonders kräftiger Roter mit Adlerfedern in der Skalplocke vorausritten.
Die Apachen und die fünf Weißen trabten auf der Spur des Flüchtlings ebenfalls nach Norden zu.
»Der Große Bär«, so murmelte Felsenherz. »Mein Bruder Chokariga wird recht gehabt haben. Die Ausgestoßenen, die wir aus dem Talkessel verdrängt und die Chokariga den giftigen Pfeil in den Schenkel geschossen haben, werden uns an den Großen Bär verraten haben. Wie käme der Apachenhäuptling sonst mit so vielen Kriegern in diese Gegend, da er doch verpflichtet ist, den Mexikanern gegen die Texaner beizustehen! Nur gut, dass wir unsere Vorsichtsmaßregeln getroffen haben. Bevor ich in unseren Schlupfwinkel zurückkehre, will ich doch erst mal nachsehen, ob nicht dort in dem Waldstreifen noch mehr Apachen stecken.«
Er ließ seinen Braunen in der Schlucht zurück und schlich durch das hohe Präriegras dem Wald zu. Der Waldstreifen war nur schmal. Hinter demselben war die Prärie buschreicher. Felsenherz sah, dass die Spuren der Apachen sämtlich nach einem dichten, breiten Gebüsch hinliefen.
Er wurde nun noch vorsichtiger, kroch im Bogen von Süden in die Büsche hinein und bemerkte nun, dass sie eine kleine Bodenvertiefung umgaben.
In dieser Talmulde lagerten zehn Apachen. Abseits lag ein toter Indianer, dem mit einem Tomahawk der Schädel eingeschlagen war. Daneben saß ein gefesselter Weißer im Gras, ein dürrer langer Mann, mit blondem, geteiltem Vollbart und einer Brille auf der Nase.
Zehn Apachen freilich waren auch für ihn als Gegner etwas zu viel. Er musste daher verseuchen, einige von ihnen wegzulocken.
Lautlos schob er sich rückwärts, bis er eine kleine Öffnung in den Büschen erreicht hatte, wo der nackte Steinboden hervortrat. Hier wählte er drei Felsstückchen von etwa Faustgröße aus und warf sie nacheinander über die Talmulde hinweg in die jenseitigen Büsche, kroch dann sofort wieder vorwärts und sah gerade noch, wie fünf der Apachen, die sämtlich infolge des Raschelns der Steinwürfe hochgeschnellt waren, mit ihren Flinten in das Gesträuch glitten.
Er wartete noch ein paar Minuten. Dann glitt er noch weiter vor, richtete sich auf.
Die fünf zurückgebliebenen Apachen kehrten ihm den Rücken zu.
Zwei lange Sätze, drei Hiebe mit dem flachen Tomahawk, ein Fußtritt – und nur der fünfte der Apachen konnte noch brüllend in den Büschen verschwinden.
Felsenherz zerschnitt die Fesseln Blubbs, wollte dann zwei der Indianergäule nehmen und mit ihnen nach Süden zu davonjagen.
Ein Ausruf Blubbs warnte ihn. Er fuhr mit dem Kopf herum.
Zwei Apachen hatten ihre Büchsen durch die Zweige geschoben.
Felsenherz warf sich lang hin. Seine Büchse lag schon im Anschlag.
Drei Schüsse – dann ein vierter – Die beiden Apachen fielen nach vorn auf das Gesicht.
Der Professor hatte seine beiden Gewehre aufgehoben und stürmte nach Süden davon. Felsenherz war dicht hinter ihm.
»Mir nach, Master!«, rief er. »Mein Pferd steht drüben!« Er zeigte nach Osten.
Blubb war kein schlechter Läufer. Nun durchquerten sie den Waldstreifen.
»Halt!«, rief Felsenherz. »Stellt Euch dort hinter jene Buche!«
Er lud rasch seine Büchse. Doch als er gerade die zweite Kugel mit dem Ladestock feststieß, kamen vier Apachen auf ihren Gäulen aus den Büschen hervorgesprengt.
»Master, Ihr gestattet, dass ich die vier erledige«, sagte Thomas Blubb gelassen. »Ich schieße leidlich und werde zumindest die Pferde treffen.«
Seine beiden Gewehre, eine Doppelbüchse und ein zweiläufiger, kurzer Karabiner taten genau so ihre Schuldigkeit wie ihr Besitzer. Die vier Pferde brachen zur Seite aus, und drei stürzten dann sehr bald zu Boden. Ihre Reiter verschwanden im hohen Gras.
Felsenherz und Blubb eilten weiter. Als sie die kleine Schlucht erreicht hatten, wo der Braune stand, meinte der junge Trapper anerkennend: »Master Blubb, Ihr seid als Gefährte hier in der Wildnis brauchbar! Steigt auf! Wir reiten zu zweien. Mein Brauner trägt die Last schon.«
»Dürfte ich fragen, wie Ihr heißt?«, sagte der Professor und musterte Felsenherz voller Interesse. »Ich selbst bin einer der bekanntesten Altertumsforscher, und ich …!«
»Steigt auf!«, mahnte Felsenherz. »Hier seid Ihr jedenfalls wie ein Kind, das erst noch das Gehen lernen soll! Wenn wir noch länger zaudern, könnten unsere Skalpe in Gefahr kommen!«
»Junger Mann«, erklärte Thomas Blubb stolz, »es ziemt sich nicht, dass wir zu zweien reiten. Ich bin der Ältere. Ich werde reiten!«
Der Trapper schwang sich in den Sattel. »Lebt wohl, Master Blubb!«, meinte er kurz. »Ihr seid ein Narr! Die Apachen werden Euch bald beweisen, was sich ziemt und was nicht!«
»Halt! Halt!«, kreischte Blubb da. »Ihr werden mich doch nicht verlassen? Gut – reiten wir zu zweien, wenigstens zuerst. Nachher dürfte es der Anstand verlangen …«
Felsenherz hatte ihn plötzlich beim Kragen gepackt und quer über den Sattel gelegt.
Der Braune trabte davon und der Professor zeterte.
»Master, … das … das ist eine derartige Unhöflichkeit, wie sie nicht einmal …«
»Haltet das Maul!«, befahl Felsenherz mehr im Scherz. »Ihr seid hier nicht in einer Universität, sondern in der Prärie, und zwar in einer Gegend, die den Apachen als Jagdgebiet gehört. Und diese Rothäute sind außerordentlich unhöfliche Leute, Master Blubb, wie Ihr ja bereits am eigenen Leibe erfahren habt. So, nun setzt Euch gefälligst nach Damenart mit dem einem Bein über den Sattelkopf und klammert Euch an mir fest.«
Der Herr Professor schwieg. Er war derart empört, dass er kein Wort mehr herausbrachte.
Felsenherz munterte seinen Braunen zu einem kurzen Galopp auf. Er wollte zunächst einmal aus der Nähe der zurückgebliebenen Apachen weg, von denen ja acht noch lebten und die noch sechs Pferde zur Verfügung hatten. Er ritt daher auch direkt auf die Südausläufer der Jicarilla-Berge zu, band seinem Pferd die dicken ledernen Hufschuhe unter, durch die er auf hartem Boden jede sichtbare Fährte vermied, und hielt sich auch weiter stets am östlichen Rand der Höhenzüge, wo er seinen Weg durch Schluchten und Täler nahm, um ein Zusammentreffen mit dem Haupttrupp der Apachen zu vermeiden.
Nach dreistündigem Ritt wollte er dem Braunen eine halbe Stunde Ruhe gönnen.
Der Professor setzte sich abseits auf einen Stein. Man befand sich hier auf einer kleinen Hochebene, die mit Felsblöcken wie besät war und der noch eine Menge uralter Riesentannen einen besonderen landschaftlichen Reiz verliehen.
Der junge Trapper holte seinem Braunen Gras, das er mit dem Messer an einer sandigen Stelle des Plateaus abschnitt. Als er mit einem Arm voll Gras zu drei Steinblöcken zurückkehrte, die er als geschützten Winkel zum Lagern ausgesucht hatte, empfing ihn Thomas Blubb mit den erregten Worten.
»Ihr hättet auch lieber hierbleiben können, Master! Ihr wollt ein Westmann sein und habt nicht mal die drei Apachen gesehen, die vorhin dort rechts in der Prärie vor einem Gebüsch hielten!«
Felsenherz starrte den Gelehrten ungläubig an. Dann rief er: »Wie – und das sagt Ihr erst jetzt! Das ist ja geradezu der Gipfel der Verblödung!« Er war nun wirklich zornig. »Mann, steht auf! In den Sattel!«, fügte er wütend hinzu, warf das Gras weg und schwang sich in den Sattel.
»Ach was!«, brummte Blubb jedoch. »Unsinn! Nur drei Apachen! Mir tun schon alle Knochen weh! Es würde den einfachsten Regeln des Anstandes entsprechen, dass Ihr jetzt …«
Felsenherz’ helle Augen flammten auf. »Narr!«, wetterte er los. »Ich werde Euretwegen nicht mein und meines roten Freundes Leben aufs Spiel setzen!«
Er hatte den Braunen an Blubb herangedrängt. Doch der Gelehrte ahnte wohl, dass Felsenherz ihn wieder gewaltsam in den Sattel befördern wollte. Er sprang auf. Die Büchse hatte er umgehängt, den Karabiner aber in der Hand.
»Lasst mich in Ruhe!«, fauchte er. »Oder ich beweise Euch, dass ich zuschlagen kann!«
Kaum war das letzte Wort ihm über die Zunge, als des Trappers Faust von der Seite seine Schläfe traf.
Dann lag er bewusstlos quer über dem Sattel. Felsenherz hob schnell den Karabiner auf, schnalzte leise und jagte über das Plateau hinweg weiter nach Norden zu.




