Xaver Stielers Tod – Kapitel 13
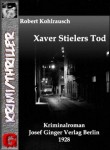 Robert Kohlrausch
Robert Kohlrausch
Xaver Stielers Tod
Kriminalroman
Erschienen 1928 im Josef Ginger Verlag Berlin
Dreizehntes Kapitel
Der alte Graf Hersberg ging in seinem Hotelzimmer unruhig auf und ab. Mit modernen, weißlackierten Möbeln, weißen Biedermeiervorhängen und einem Jagdstück in weißem Rahmen war es ein sehr sauberes, elegantes und helles, aber ungemütlich kühles Gemach. Das einzig Weiche, Behagliche darin war eine dunkelblau bezogene Chaiselongue, die Graf Stefan für den leidenden Vater mit Mühe vom Wirt erkämpft hatte. Was in den letzten Tagen Schlag auf Schlag über ihn und seinen Vater hereingebrochen war, hatte dessen Widerstandskraft gebrochen. Der Tod seines ältesten Sohnes, die persönliche Vernehmung durch den Untersuchungsrichter über seine Familienverhältnisse, vor allem der immer schwerer auf Stefan lastende Verdacht hatten seinen Stolz und sein Vatergefühl in gleicher Weise verletzt.
Er wartete in brennender Unruhe darauf, dass der Sohn von einer neuen Vernehmung, zu der er geladen worden war, heimkehrte. Wenn er überhaupt wiederkam! Ein ganzer Stoß von Morgenzeitungen lag auf einem kleinen Tisch neben der Couch, unordentlich, nicht gefaltet hingeworfen. Alle waren voll vom Verdacht gegen seinen Sohn, ein paar von den radikalsten Blättern forderten direkt seine Verhaftung, mahnten das Gericht, nicht vor dem Grafentitel haltzumachen.
Längst war das Versprechen vergessen, dass er dem Sohn gegeben hatte, sich zu schonen, ruhig liegen zu bleiben, bis die Vernehmung vorüber war. Die warme Reisedecke, die Stefan vor seinem Fortgehen sorgsam über ihn gebreitet hatte, war sehr bald von ihm beiseite geworfen worden, und nun bewegte sich seine hohe, dunkle Gestalt rastlos hin und her, hin und her zwischen den weißen Möbeln des hellen Zimmers.
Neben Angst und Sorge waren es gute, nützliche Gefühle, die in dieser einsamen Stunde bangen Wartens kraftvoll in ihm arbeiteten. Er hielt ein strenges über sich selbst Gericht ab. Seinem ältesten Sohne war in Leidenschaft und Heftigkeit Unrecht von ihm geschehen, und er war nahe daran gewesen, ein gleiches Unrecht an Stefan zu begehen. Wenn es anders gekommen war, sein eigener Verdienst war es nicht gewesen. Aber die Genugtuung über glücklich Verhütetes, der Schmerz über den schrecklichen Tod seines ältesten Sohnes, das mächtig in ihm erwachte Vatergefühl in der Nähe von Stefans liebenswürdiger Persönlichkeit, gepaart mit schwerer Angst um sein Geschick, – das alles hatte die Liebe zu diesem Sohn zu warmer, leuchtender Flamme werden lassen.
»Beschütze meinen Jungen, Gott!«, murmelte der alte Mann mit bleichen, zuckenden Lippen, »beschütze meinen guten, lieben Stefan.«
Endlich öffnete sich die Tür, und in ihrem Rahmen erschien der junge Graf. Rasch wandte sein Vater sich um und ging auf ihn mit ausgestreckten Händen zu. »Du bist es, mein Junge, – wie schön. dass du wieder da bist.«
Der Sohn lachte leicht auf. Es war nicht ganz das gewohnte weiche Lachen, ein wenig von ihm fremder Bitterkeit wohnte darin. »Ja, sie haben mich wahrhaftig noch einmal wieder laufen lassen müssen. Sehr gegen ihren Willen allerdings. Die Kerle haben sich die Menschen mögliche Mühe gegeben, mir einen Strick zu drehen, womit sie mich zur Erbauung aller moralischen Gemüter an einen weithin sichtbaren Galgen hängen wollten. Aber die Sache ging vorbei, der Strick riss durch, ehe sie mich hinaufziehen konnten.«
»Komm, komm, erzähle!«
»Nur, wenn du dich wieder ruhig hinlegst, Vater. Du bist ein ungehorsames Kind gewesen.«
»Wer kann denn bei solcher Aufregung liegen? Nun du wieder da bist, sieh her, setzen will ich mich wenigstens.«
Er setzte sich wirklich auf das Sofa, wehrte dem Sohn jedoch, als er ihm die Decke sorgsam wieder überbreiten wollte. »Nein, nein, lass mich, das engt mich zu sehr ein. Und nun sprich, erzähle.«
»Man muss ja gerecht sein«, sagte Stefan mit langsam wiederkehrendem heiterem Gleichmut, »irgendein kleiner Teufel hat bei dieser Geschichte wirklich seine Hand im Spiel. Wenn sie nur nicht so grässlich geschmacklos wäre. Mich, ausgesucht, mich als Brudermörder zu frisieren, das geht wahrhaftig über den Spaß …«
»Ach, unerhört ist es, unerhört infam!«
»Nein, Vater, der kleine Teufel zieht auch die hochwürdigen Herren vom Gericht an der Nase herum. Er hat ihnen so wunderhübsche Bausteine für das Gebäude meiner Schuld in die Hände gespielt Sie konnten eigentlich wirklich nicht anders, als an meine Höllenschwärze glauben.«
»Das ist doch Unsinn.«
»Unsinn ist es natürlich, aber auch die größte Verrücktheit kann einmal glaublich scheinen. Da war Nummer eins: Niemand als ich konnte nach menschlichem Ermessen durch Bothos Tod gewinnen. Verzeih, wenn ich davon spreche …«
»Sprich nur, sprich immerzu. Du kannst mir nichts weiter sagen, als was ich mir hundertmal selbst gesagt habe, während ich hier allein war. Ich habe reuevoll im Geist an meine Brust geschlagen und habe gerufen: ›Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa!‹ Denn alles wäre nicht so gekommen, wenn dein alter, eigensinniger, heftiger Vater – jawohl, das war ich, will es aber nicht mehr sein, – dir nicht mit Kürzung deines Erbes gedroht hätte. Dann würde niemand behaupten können, dass du von unseres armen Botho Tod Vorteil hättest. Aber ich habe mich, wie damals bei ihm, auch dir gegenüber durch mein leider noch immer jugendliches Temperament fortreißen lassen. Und nun hat sich unser Herrgott als ungeheuer nützliche Lektion für mich diese Prüfung ausgedacht. Nur du solltest nicht mit unter ihr leiden müssen.«
»Ach, mir kann solch eine Lektion auch nicht schaden, Vater. Also das war Nummer eins. Nummer zwei war eine Weinflasche.«
»Ja, ja, die vergiftete. Davon kann ich schon gar nicht mehr hören.«
»Ausnahmsweise war diese nicht vergiftet. Um sich mir verständlich zu machen, hat mir der Herr Untersuchungsrichter etwas von den Gedanken und Vermutungen der hohen Behörde verraten müssen. Da Botho scheinbar wirklich im Pavillon der Villa Rainer vergiftet worden ist, in der dort gefundenen Flasche jedoch kein Gift hat festgestellt werden können, so nimmt man an, dass der Mörder die vergiftete Flasche mit einer anderen von harmlosem Inhalt vertauscht hat. Und ich allein konnte dieser schlaue Mörder sein. Ich war im Garten der Villa Rainer gewesen, als Hanna Rainer die Flasche dort in den Pavillon gestellt hatte, selbst aber nicht anwesend war. Das war die beste Gelegenheit für die Giftmischung. Ich war hinterher – um acht Uhr – noch einmal dort gewesen und hatte so den Flaschentausch wundervoll besorgen können, wobei die vergiftete Flasche mir leider aus dem Fenster fiel. Von den durch Doktor Glaritz gefundenen Scherben geben ja die Zeitungen heute schon die schönsten Beschreibungen. Ein Wunder, dass man sie nicht auch noch fotografiert hat.«
»Ja, ja, da liegen die Zeitungen. Ich habe die Tollheiten alle gelesen, die darin stehen.«
»Dann ist Nummer drei dir vermutlich auch bereits bekannt. Ein alter Briefumschlag, den der Mörder als Gläsertuch benutzt haben soll. Auch wieder so fürchterlich geschmacklos. Man hat mir das rot gefleckte Papier sogar gezeigt, und ich habe nur sagen können, dass ich dieses Ding meines Wissens vorher nie zu Gesicht bekommen habe. Die Adresse ist an mich und von Hanna Rainers Hand geschrieben, aber der zugehörige Brief ist offenbar niemals abgeschickt worden. Sie hatte nämlich keine Marke darauf geklebt. Wie der Umschlag dann in des Mörders Hände gekommen ist, wissen die Götter, ist mir übrigens auch ziemlich gleichgültig.«
Eine plötzliche Heiterkeit machte mit ihrem Lachen sein Gesicht hell. »Ach, ich habe mich im Grunde sehr darüber amüsiert, wie der Herr Germelmann die drei Steine seines verhängnisvollen Baukastens immer wieder hin- und herschob und schließlich selber auf seinem Stuhl hin- und herzurutschen anfing. Die Steine wollten absolut nicht aneinander passen. Wie mir nach und nach klar wurde, musste nämlich um halb acht Uhr des Mordabends irgendetwas passiert sein, was nicht zu meinem Verbrechertum stimmen wollte. Ich habe für diese Zeit ein so völlig unanfechtbares Alibi, dass dagegen kein Teufel und keiner von seiner Verwandtschaft – will sagen Untersuchungsrichter – aufkommt.«
»Aber du bist an dem Abend doch dort im Pavillon gewesen.«
»Freilich. Nur nicht um halb acht. Lass mich dir sagen, es ist wirklich noch ganz etwas Neues passiert, wovon sogar den allwissenden Zeitungen bisher nichts bekannt ist. Als der Herr Germelmann schließlich einsah, dass es mit Strick und Galgen für mich absolut nichts war, wurde der edle Herr ganz gemütlich und erzählte mir allerlei. Dass auch um halb acht Uhr ein Lichtschein im Pavillon gesehen worden ist, wusste man ja schon. Aber nun hat ein funkelnagelneuer Detektiv – ein früherer Offizier nebenbei, den ich ganz gut kenne, – glücklich noch feststellen können, dass gleich nach halb acht ein Mann dem Rainerschen Garten gegenüber einen ganz einsamen Weg zum Fluss hinuntergegangen ist und etwas ins Wasser geworfen hat, was wie Glas geklirrt haben soll. Dieser Dunkelmann scheint nun dem Gericht denn doch in allernächster Beziehung zu der vergifteten Flasche zu stehen. Weil ich aber zum Glück dienstlich verhindert war, um halb acht Uhr am Fluss herumzulaufen, bin ich dir wiedergegeben, frei von Ketten und Banden, wenn auch vielleicht noch nicht ganz von meinem bekannten Leichtsinn.«
»Gott sei Dank, dass ich dich wiederhabe. Nun wollen wir alles Vergangene vergangen sein lassen und sehen, dass wir ein recht, recht schönes Glück für dich miteinander aufbauen.«
»Mein Glück – das kann ich dir zeigen und nennen. Es heißt …«
»Hanna Rainer, nicht wahr?«
Stefan sprang auf, beugte sich über den Vater und küsste liebevoll die Stirn des Alten. »Wie du klug bist, – wie du mich gut verstehst.«
»Ach, ich bin so begierig, diese Hanna Rainer endlich zu sehen. Du weißt ja, dass ich eigentlich andere Wünsche für dich hatte …«
»Jawohl, jawohl. Adel zu Adel, feudal zu feudal, Grafenkrone zur Grafenkrone. Sehr stilvoll an sich, nur nicht verwendbar in diesem Fall. Mein Herz hat sich fürs Bürgertum entschieden.«
»Ich will auch nichts mehr dagegen sagen, will nicht in meinen alten Fehler verfallen und für meinen Sohn Geschick spielen. Aber ich möchte diese Hanna Rainer sehen. Ich hätte ja doch ohne mein dummes Unwohlsein ihr und ihren Vater schon längst meinen Besuch gemacht. Aber …«
»Du wirst sie sehen.«
»Wann?«
»Heute.«
»Wahrhaftig?«
»Jawohl, sie wird hierher kommen. Sie telefonierte mir heute früh, scheinbar in großer Aufregung über den Scherbenträger Glaritz, und bat mich, in der Villa vorzusprechen, wenn meine Vernehmung vorüber sei. Ich habe sie dabei telefonisch gebeten, lieber um zwölf Uhr hierher zu kommen, damit ich sie dir vorstellen kann.«
»Es ist gleich zwölf …«
»Und eben klopft es, pünktlich auf die Minute.«
Stefan ging mit elastisch eiliger Bewegung zur Tür und nahm eine Meldung des draußen stehenden Dieners entgegen. Dann trat er auf den Korridor hinaus, und ein paar warme Begrüßungsworte seiner weichen Stimme klangen von dort herein. Gleich darauf erschien Hanna Rainer in der Tür, die Stefan hinter der Eintretenden schloss. Er legte den Arm liebevoll um ihre Schultern und sagte zu dem alten Grafen, der von seinem Sitz hastig aufgestanden war: »Sieh her, Vater, so sieht mein Glück aus.«
»Willkommen, willkommen!«
Der Alte streckte die Hand ihr entgegen, sie beugte sich darauf nieder und küsste sie, leise sagend: »Endlich darf ich Sie sehen.«
»Lassen Sie mich Sie anschauen. Stefan hat mir so viel Schönes und Gutes von Ihnen erzählt, – aber es ist eine schwere, schwere Zeit, in der wir uns kennenlernen, und Ihr blasses Gesicht sagt mir, wie sehr auch Sie darunter leiden.«
Sie hatte sich wieder aufgerichtet und stand ihm einen Augenblick stumm gegenüber. Ihre düstere Schönheit wirkte durch die gelbliche Blässe des Gesichtes doppelt stark, das unter dem dunklen Haar die Färbung alten, edlen Marmors trug.
»Eine schwere Zeit!«, murmelte sie kaum verständlich, indem sie die Hand wie zur Kühlung auf die Stirn legte. Zugleich durchlief ein Beben und Schwanken ihren Körper, und sie wäre niedergesunken, wenn Stefan ihr nicht, sie stützend, eilig beigesprungen wäre.
»Um Gotteswillen, Hanna! Was ist, was ist?«
Sie hatte sich auf einen von Stefan herangezogenen Stuhl sinken lassen und machte noch einmal die hilflose Handbewegung zur Stirn. »Verzeih, – einen Augenblick, – ich habe keine Minute geschlafen, – es war eine furchtbare Nacht.«
»Erhole dich, schone dich, halte dich ganz ruhig.«
Nun hatte sie die gewohnte Haltung wieder zurückerlangt und richtete sich fest auf. »Es ist jetzt vorüber. Ich bin ja nicht von so schwacher Art. Aber es war einen Augenblick stärker als ich.«
Sie fasste Stefans Hand und erhob sich mit einer energischen Bewegung, als ob von ihm neue Kraft in sie hinüberströmte.
»Wie töricht ich bin. Ich sehe dich wieder, halte dich wieder, – ach, Stefan, ich habe solche Todesangst um dich gehabt. Aber nun ist alles gut. Sie haben dir nichts anhaben können, haben dich nicht verhaftet …«
»Nein, mit allerbestem Willen haben sie es nicht fertigbringen können. Ich bin vorläufig frei wie der Vogel in der Luft. Aber dass du dich darum so geängstigt hast? Solche Sachen können einen eigentlich doch nicht berühren, wenn man unschuldig ist.«
»Wenn man unschuldig ist.« Sie wiederholte die Worte leise, scheinbar mechanisch, ohne zu denken. Ihre Blicke flanierten über ihn hin, über sein Gesicht, seine Gestalt. Sogar seines Vaters Anwesenheit schien sie vergessen zu haben.
»Du hast mir gestern schon telefoniert, hast mich sprechen wollen, wie meine Wirtin mir sagt, …«
Sie nickte. »Leider war es vergeblich. Ich hatte bis gegen Abend noch keine Ahnung, dass etwas Neues geschehen war. Mein Vater sagt, er hätte über den Fund meines Vetters in unserem Garten nicht sprechen wollen, bis das Gericht von ihm gewusst hätte. Spät am Nachmittag erst hat er mir davon erzählt, hat mir gesagt, welche Folgerungen gegen dich man wahrscheinlich daraus ziehen würde. Da hat mich die Todesangst um dich überfallen. Ich habe versucht, ob ich dich nicht am Abend noch sprechen könnte, habe telefoniert, – einmal, – zweimal, – dreimal, – immer vergeblich.«
»Leider bin ich gestern spät nach Hause gekommen.«
»Und nun heute deine neue Vernehmung, – und sitzen müssen, warten, warten und nichts tun können, – es war furchtbar.«
»Ich habe das erfahren wie Sie, liebe Hanna«, sagte der alte Graf. »Ich habe hier in Todesängsten gesessen, wie Sie zu Hause, – in gleicher Weise haben wir beide um unseren großen, lieben Schlingel hier gebangt.«
»Gott sei Dank, das ist jetzt vorüber!« Sie fasste nach Stefans Hand und sprach weiter, sie fest in der ihren haltend. »Es war mir, als wenn ich nicht mehr denken könnte, so tobte das Blut in meinem Gehirn. Angst und Verzweiflung war alles, was ich fühlte. Nun ist mir es, als ob ein Schleier fortgezogen würde, sodass ich wieder sehen kann, was ist. Aber du, Stefan, – ist wirklich keine Gefahr mehr für dich?«
»Nach menschlichem Ermessen keine.«
»Dann ist alles gut. Und ich bringe noch etwas Neues mit, was auch vielleicht gut ist, – ich hatte nur kein Gefühl dafür in der Todesangst.«
»Was ist es?«, fragte der alte Graf. Stefan hatte nur Blick und Gedanken für Hanna, wie sie für ihn.
»Ach, wenn man von all diesen Hässlichkeiten doch nicht mehr zu hören und nicht mehr zu sprechen brauchte. Von Gift und Mord und, – aber Sie wollen wissen, was ich Neues bringe. Um unseren Diener handelt sich es und um die Flaschen, die nach des Gerichts Glauben im Pavillon vertauscht worden sein sollten. Es gab ein endloses Fragen, wie viel Flaschen von der Weinhandlung geliefert worden waren und wie viele fehlten. Hundert hatten wir bekommen, das war sicher. Ich selbst hatte nur eine davon genommen, aber beim Nachzählen waren nur achtundneunzig vorhanden, es fehlten also zwei. Die Vertauschung der Flaschen schien sicher. Da nahm ich unseren Diener noch einmal ganz für mich energisch ins Gebet.
Es ist ein junger, naschhafter Bursche, – nun, er hat mir endlich eingestanden, dass er die zweite Flasche heimlich ausgetrunken hat.«
»Bravo, bravo!«, rief Stefan. »Für dieses Geständnis bekommt er von mir noch eine dazu.«
»Dafür ist er von mir schon fürstlich belohnt worden.«
»Ja, das ist für euer ganzes Haus ungeheuer angenehm. So kann doch der Teufel, der im Pavillon sein Wesen getrieben hat, seine Ware nicht aus eurem Keller bezogen haben.«
»Ich habe nicht an uns gedacht bei dem allen, Stefan, – immer nur an dich! – Immer nur an dich! Ach, ich habe ja keinen anderen Gedanken mehr. Du hast eine Gewalt über mich, der ich willenlos gehorchen muss. Ich tue für dich, was ich sonst nie tun würde. Ich schreibe fremden Menschen, gehe zu fremden Menschen, ohne nur zu fragen, ob es klug und schicklich ist. Wenn es dein Wohl erforderte, Stefan, ich würde Heldentaten und Verbrechen für dich begehen und würde nicht einmal wissen, ob es Heldentat oder Verbrechen ist. Mit Leib und Seele bin ich dir verfallen. Du bist mein ganzes, einziges Glück, und ich fühle, sehe, denke nichts anderes, als dich allein.«
Liebevoll sich an ihn schmiegend stand sie, vom Gefühl überwältigt, einen Augenblick wortlos da. Dann wandte sie sich mit einem demütigen Lächeln, das ihrem ernsten Gesicht eine bittende Kindlichkeit gab, an Stefans Vater.
»Seien Sie nicht böse, Graf, dass ich immer nur mit ihm, von ihm, über ihn spreche. Sonst bin ich auch vernünftiger und ruhiger, aber die letzte Nacht mit ihrer Todesangst hatte mir jeden Halt genommen.«
»Sprechen Sie nur, sprechen Sie nur, wie Sie es getan haben. Sie gewinnen damit mein Herz, haben es bereits gewonnen. Ich habe ja doch nur noch diesen einen Jungen, – all meine Liebe gilt jetzt ihm allein. Und wer ihn auch lieb hat, – sehen Sie, das ist ein festes Band zwischen Ihnen und mir, liebe Hanna.«
»Dank, Dank, – Sie machen mich sehr glücklich …«
»Und nun wollen wir gemeinsam unseren Stefan glücklich zu machen suchen. Er lässt es sich nicht anmerken, aber gelitten hat er auch unter dem hässlichen, schändlichen Verdacht. Wir wollen …«
Er kam nicht weiter. Ein kurzes, hartes Klopfen, fast einem Hammerschlag ähnlich, erklang an der Tür, und sie wurde schon geöffnet, bevor noch Graf Hersberg »Herein!« hatte rufen können. Kriminalkommissar Bauer trat über die Schwelle, hinter ihm blieb ein Schutzmann im Halblicht des Korridors stehen.
Hanna fuhr zusammen bei diesem Anblick und klammerte sich fester an Stefan. Der alte Graf aber fragte mit einem nervösen Zucken seiner Lippen: »Was wünschen Sie? Weshalb dringen Sie hier ein?«
»Ich bitte dafür um Entschuldigung, aber ich wusste, dass diese Dame hier war, und ich durfte sie nicht aus den Augen lassen.«
»Warum, weshalb?« Es war Stefan, der die Frage rief. Bleich, mit krampfhaft geschlossenen Händen stand er da.
»Fräulein Hanna Rainer, ich habe den Auftrag, Sie zu verhaften wegen dringenden Verdachtes, den Giftmord an Xaver Stieler begangen zu haben.«
»Mich, mich verhaften?« Leise, fast unverständlich stammelte sie die Worte.
»Das muss ein Irrtum sein, – das ist ja Wahnsinn«, rief Stefan. »Sie haben sich mit Ihrem Verdacht auf mich getäuscht, Sie täuschen sich auch jetzt.«
»Auf Erörterungen irgendwelcher Art kann ich mich nicht einlassen. Ich muss meinen Auftrag ausführen und Fräulein Rainer bitten, mir zu folgen.«
»Aber Herr Kommissar, Sie sind ja doch ein vernünftiger, verständiger Mann. Sagen Sie mir wenigstens, wie dies kommt, wie dieses möglich ist. Sie selbst haben Fräulein Rainer schon ein paar Mal vernommen und haben keinen Verdacht auf sie gehabt …«
»Näheres kann und darf ich darüber nicht sagen. Das eine nur mögen Sie wissen, dass diese Verhaftung die Folge von einer persönlich erstatteten Anzeige der Frau des ermordeten Xaver Stieler, der Kinoschauspielerin Afra Baratta, bei dem Herrn Untersuchungsrichter ist. Und nun muss ich bitten, Fräulein Rainer.«
Eine steinerne Ruhe war über Hanna gekommen. Sie nahm des alten Grafen Hand und küsste sie, dann wandte sie sich zu Stefan. »Ich muss gehen, leb’ wohl. Dass es mich trifft, ist gut. Kommen Sie, Herr Kommissar.«
»Du sollst nicht gehen, ich will es nicht leiden, dass man dich misshandelt«, rief Stefan verzweifelt hinter der Hinausgehenden her. Der alte Graf legte beruhigend seine Hand auf Stefans Arm, die Tür fiel zu. Gebeugt, mit herabhängenden Händen, auf der Unterlippe nagenden Zähnen und rasch auf- und nieder bewegten Augenlidern stand Stefan ein paar Sekunden, in stummes Grübeln versunken. Dann sich hoch aufrichtend rief er aus: »Von der Baratta kommt uns das Unheil, – dieses Weib soll mir Rede stehen.«




