Xaver Stielers Tod – Kapitel 12
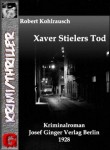 Robert Kohlrausch
Robert Kohlrausch
Xaver Stielers Tod
Kriminalroman
Erschienen 1928 im Josef Ginger Verlag Berlin
Zwölftes Kapitel
»Ach, das ist ja doch alles Unsinn, Onkel Kommerzienrat. Lachhaft ist es geradezu, dass Graf Stefan seinen leiblichen Bruder gemeuchelt haben soll. Ich bin ganz unparteiisch in der Sache. Der Graf hat sich niemals viel aus mir gemacht. Aber eben darum. Ich sehe mit unbefangenen Augen und lasse mich durch diese sogenannten gravierenden Beweise nicht blind machen, vor denen ihr klugen Männer solch einen heiligen Respekt habt. Im Grunde sind wir Frauenzimmer doch viel klüger als ihr. Wir lassen auch bei Verstandesangelegenheiten das Herz mitsprechen.«
Es war die kleine Liselotte Hell, die, ganz rot im Gesicht von heißem Eifer, ihrem Adoptivonkel Rainer im warm beleuchteten Speisezimmer seiner Villa diese Gardinenpredigt hielt. Sie war mit ihm allein. Hanna war nicht anwesend.
»Und mein Herz fühlt und weiß, dass der Graf solch eine Sache nicht gemacht haben kann. Absolut ausgeschlossen, sagt mein Herz. Vornehme, wirklich, wirklich vornehme Leute tun solche Dinge nicht. Und solch ein wirklich, wirklich vornehmer Mensch ist Graf Stefan. Auf den ganzen Menschen muss man sehen, Onkel, damit kommt man viel weiter als mit allen zerbrochenen und vergifteten Weinflaschen der Welt. Ich gebe zu, das Verbrechen scheint wirklich hier im Pavillon begangen worden zu sein. Seit unser bleicher Hans Heiling vorhin hier war, wissen wir ja, dass sich wirklich Gift an der Flaschenscherbe und auch an dem unglücklichen Briefumschlag befunden hat. Aber deshalb ist Graf Hersfeld noch lange nicht schuldig. Und ich will dir sagen, was ich tun werde. Beweisen will ich das, Onkel Kommerzienrat – ich, ich selber werde die Sache in die Hand nehmen. Da sollt ihr vor der kleinen Liselotte einmal Respekt kriegen. Sag Hanna, dass ich ihr furchtbar böse bin, weil sie sich nicht einmal von mir hat sprechen lassen, aber dass ich feurige Kohlen auf ihr Haupt sammeln will und ihr den geliebten Grafen in funkelnagelneuem, schneeweißem Unschuldsgewand zurückbringe. So, jetzt geht es los, Onkel Kommerzienrat.«
Sie war draußen, bevor er noch ein Wort hatte sprechen können. Gleich einem Wassersturz war Liselottens Redeschwall über ihn hinweg geströmt. Er blies den Atem von sich, als ob er selber seine Lungen sehr bemüht hätte, doch war ein leichtes Lächeln wiederkehrenden Behagens auf seinem roten Gesicht.
Im Geschwindschritt eilte die kleine Verteidigerin des Grafen über den Hausflur und in den Garten hinaus. Doch war es schon viel zu dunkel, um irgendetwas genauer unterscheiden zu können. Als eine schwere Schattenmasse stand unter den mehr und mehr sich entlaubenden Bäumen und Sträuchern der Pavillon da. Kein Lichtschein kam von ihm herüber. Der Todeshauch sterbender Blätter hing schwermütig in der stillen Herbstluft.
Liselotte verlangsamte die Schritte. Ja, was wollte sie nun eigentlich? Sie fragte sich’s und lächelte leise vor sich hin. Der Drang ihres guten Herzens hatte sie hinaus getrieben. Sie begann zu überlegen, was ihr zu tun in Wahrheit möglich war. Sie wollte Dinge vollbringen, an denen Gericht und Polizei sich mit all ihrem Personal, ihren Hilfsmitteln, ihrer Übung und Erfahrung bisher vergeblich abgemüht hatten, sie, die kleine Liselotte Hell, ganz allein. Wie konnte sie das machen?
Immer langsamer war sie gegangen und blieb stehen, als sich die Gitterpforte des Gartens zur Heidingerstraße hinter ihr geschlossen hatte. Einsam, still, matt beleuchtet lag die Straße vor ihr, nur wenige Lichter brannten in den Häusern gegenüber. Das eine helle Fenster im ersten Stockwerk dort gehörte zur Wohnung des Doktors Glaritz, das wusste sie. Doch kam ihr von ihm keine Hilfe. Der Doktor hasste den Grafen, das war auch eine von den Wissenschaften des Herzens, die Licht auf ihren Weg warfen.
Sie suchte mit forschenden Blicken an den Häuserfronten umher. Gab es hinter den dunklen Mauern dort gegenüber nicht vielleicht Menschen, die durch mehr zufällige Zeugenschaft von den Vorgängen des verhängnisvollen Mordabends wussten als andere? Menschen, die dem Forschen der Polizei bisher entgangen waren oder ihr gegenüber in weitverbreiteter Scheu geschwiegen hatten? Nach solchen Leuten suchen, das war es, was ihr zu tun blieb.
Mit bestimmter Absicht äugte sie noch einmal hinüber, und nun kam das Lächeln von vorhin wieder auf ihr Gesicht, wurde sogar zum leisen Lachen. Da war ja das Häuschen der Knusperhexe, wie sie die brave Krämersfrau drüben getauft hatte, deren wirklicher Name fast ebenso schlimm war; denn sie hieß Kübelmorgen. Wie das Häuschen des Märchens, eine Hütte mehr als ein Haus, lag das altmodisch ländliche Bauwerk als Überbleibsel einer vergangenen Zeit unter – im wahrsten Sinne des Wortes – unter den hoch ihm über den Kopf gewachsenen Häusern der Villenvorstadt. Über seinem einzigen Geschoss ging das dunkle Schindeldach steil in die Höhe. Von rechts und links breiteten die Bäume des großen dazugehörigen Gartens ihre Zweige freundlich darüber. Dieser nach hinten bis an den dort vorüberströmenden Fluss reichende Garten war als Baugrund ein unschätzbarer Besitz der alten Krämerin. Es war ihr dafür noch immer nicht genug geboten worden, um sie zur Trennung vom ererbten Besitz ihrer Eltern und Großeltern zu bewegen.
Liselotte war da drüben gut bekannt und wohlgelitten. Sie hatte der Frau Kübelmorgen aus Vorliebe für das kleine, komische Lädchen schon so viele Malz- und andere Bonbons abgekauft und hatte sich immer dabei so freundlich Zeit für einen lustigen Schwatz genommen, dass ihr ein günstiger Empfang dort gewiss war. Voll Eifer ging sie rasch über die Straße hinüber, wo neben der Ladentür ein einziges, von weiß grüner Gasflamme schwach erhelltes Fenster die verkäuflichen Schätze der alten Krämerin zeigte, deren Schaustellerkünste der lustigen Liselotte schon oft ein Lachen abgewonnen hatten. Esswaren, Papierwaren, Garne, Stoffe gab es in buntem Gemisch mit anderen nicht zusammengehörigen Dingen. In einer aufrecht stehenden Rolle Klosettpapier steckten fünf Kämme – der eine davon wundervoll hoffnungsgrün leuchtend – wie Strahlen eines großen Sterns. Auf diesem Papiergestell aber thronte die Stoffpuppe von einem kleinen Krieger in blau-roter Uniform. Ein Madonnenbild lehnte sich an ein Glas mit Malzbonbons, und ein Teddybär hielt ein Paket mit Sicherheitsnadeln in den Pfoten.
Liselotte hatte zurzeit nur einen flüchtigen Blick für alle diese Herrlichkeiten. Mit blechernem Klang der altmodischen Schelle tat sich die Tür des Ladens unter ihrer Hand auf, und sie sah mit Genugtuung, dass Frau Kübelmorgen drinnen allein war. Der Beiname der Knusperhexe war für sie nicht übel gewählt. Ihre niemals große Figur war von der Last des Alters noch stark in sich zusammengedrückt worden, graues Haar hing ihr wirr um den Kopf und eine große, gelbe Hornbrille sorgte für die hexenhaften Eulenaugen.
»Guten Abend, Frau Kübelmorgen. Die Sehnsucht nach Ihren köstlichen Malzbonbons treibt mich so spät noch zu Ihnen.«
»Ja, das gnädige Fräuleinchen! Das ist heute wirklich ein später Besuch, aber je später der Abend, umso schöner die Gäste.«
»Danke fürs Kompliment. Geben Sie mir nur gleich ein Pfund von Ihren Bonbons. An denen kann ich mich tot essen.«
»Na, das wollen wir nicht hoffen. Aber sie sind auch gut, sind wirklich ausgezeichnet«, sagte die Krämerin und griff nach einem hohen, braun gefüllten Deckelglas.
»Und heute muss ich mir notwendig noch etwas Angenehmes antun«, sagte Liselotte mit freundlichem Lachen. »Bei meinen Freunden da drüben, bei Rainers, hängt augenblicklich der Himmel voller Wolken. Es ist ja freilich auch scheußlich, in solch eine gräuliche Mordgeschichte so hineingezogen zu werden. Dass die Sache drüben im Pavillon passiert ist, scheint ja jetzt so ziemlich sicher …«
»Wirklich, wirklich?«, fragte Frau Kübelmorgen und funkelte Liselotte neugierig mit ihren großen Brillengläsern an.
»Man behauptet es wenigstens. Sie wohnen ja hier dem Rainerschen Garten gerade gegenüber. Haben Sie an dem fraglichen Abend denn gar nichts gesehen? Hat Sie die Polizei noch nicht befragt?«
Ein lautloses Lachen erschütterte den zusammen gebogenen Körper der Alten in unheimlicher Weise. »Die Polizei, jawohl! Die kann viel fragen und hat es auch schon getan, aber Antwort kriegt sie nicht von mir. Sollen sich nur die Nasen wund stoßen, die Schnüffelmajore.«
»Wenn ich Sie nun aber fragte, meine liebe Frau Kübelmorgen. Ich bin wahrhaftig keine Schnüffelmajorin, ich bin eine so gute Freundin von Hanna Rainer …«
»Jawohl, Ihnen will ich auch gerne sagen, was ich weiß, mein gnädiges Fräuleinchen.«
»Also, Sie wissen etwas?«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber …« Ein Lächeln teilte die Lippen der Alten und machte dadurch ihr, Gesicht noch runzeliger als vorher. »Komisch ist es doch …«
»Was ist komisch?«
»Dass gerade heute Mittag schon ein junger Herr hier war, der mich auch wegen dieser Geschichte ausgefragt hat.«
»War er von der Polizei?«
»Gott soll mich bewahren! Dafür war er viel zu liebenswürdig und viel zu hübsch. Oh nein, es war ein wirklich netter, feiner, junger Herr. Und er hatte so ’ne Manier. Er hat wirklich aus mir heraus gefragt, was ich nur irgend wusste.«
»Reden Sie, reden Sie, was wissen Sie denn?«
»Ja, versprechen Sie sich nur nicht gar zu viel, mein liebes, gnädiges Fräuleinchen. Ob das, was ich gesehen habe, auf die Mordgeschichte Bezug hat, kann ich nämlich wirklich nicht sagen. Vielleicht, vielleicht auch nicht – muss ich immer wiederholen. Also zunächst: An dem Abend – es war so zwischen sieben und halb acht – ist ein junger Herr hier in den Laden gekommen.«
»Derselbe wie heute?«
»Nein, oh nein, er hat ganz anders ausgesehen. So fremdländisch, mit ganz dunklen Augen und brauner Gesichtsfarbe.«
»Was hat er denn gewollt?«
»Gar nichts Besonderes. Er hat sich ein Paket von meinen besten Zigaretten gekauft, von denen, die das gnädige Fräuleinchen auch so gerne rauchen.«
»Ja, ja. Hat er etwas gefragt, gesprochen?«
»Nur das, was nötig war. Aber ich habe so viel doch hören können, dass er das Deutsche gesprochen hat, wie die Ausländer es tun. Ich hätte ja gar nicht wieder an den Herrn gedacht, wenn mir sein Gesicht nicht so merkwürdig nachgegangen wäre. Das hat man ja wohl, nicht wahr? Mir war es immer, als wenn ich ihn schon einmal gesehen hätte, wusste nur partout nicht, wo das gewesen sein konnte, bis ich dann las, dass der Herr Stieler ermordet worden war. Da hab ich’s auf einmal gewusst.«
»Wieso denn das?«
»Ich bin doch auch im Theater gewesen, um den Herrn Stieler zu sehen, von dem die ganze Stadt sprach, und natürlich vom Anfang an die ganze Vorstellung durch. Im ersten Teil ist ein indischer Zauberkünstler aufgetreten, der seine Sache ja soweit auch sehr gut gemacht hat. Ich wusste nun auf einmal: Der war an dem Abend hier bei mir im Laden gewesen.«
»Dieser Inder, der Amaru?«
»Jawohl, Amaru, so hat er geheißen. Der Name hat mir immer noch nicht wieder einfallen wollen. Und auch der junge Herr heute Mittag hat ihn scheinbar nicht gewusst. Aber Amaru, so hieß er. Und es war mir hinterher auffallend, weil er an dem Abend gerade hier war, an dem der Herr Stieler im Pavillon von der Villa Rainer gewesen ist.«
»Sahen Sie nichts weiter von ihm?«
»Ja, mein gnädigstes Fräuleinchen, da muss ich wieder sagen: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Sie müssen wissen, ich mache den Laden hier immer um halb acht Uhr zu. Dann wird noch aller Dreck und Abfall, der sich im Laufe des Tages angesammelt hat, auf den Komposthaufen hinten im Garten getragen. Das tat ich auch damals an dem bewussten Abend. Nun führt dicht neben dem Garten an der Hecke hin ein schmaler Fußweg zum Fluss hinunter. Dort ist ein alter Anlegeplatz für eine Fähre, die jetzt eingegangen ist, seit man die Stefansbrücke gebaut hat. Nur der morsche Landesteg steht noch im Wasser. Der Weg da hinunter ist auf beiden Seiten von Hecken umzäunt und ganz einsam, es hat ja da heute niemand mehr was zu suchen. An dem Abend aber …«
»Was war an dem Abend?« «
»Damals ist ein Mensch den Weg hinuntergegangen. Ich hatte meinen Staubkübel ausgeleert und wollte gerade wieder ins Haus, da klangen Schritte vom Weg her. Der ist nämlich gepflastert, und abends hört man hier jedes Geräusch. Ich war neugierig und blieb ruhig einen Augenblick stehen.«
»War es denn hell genug, um etwas unterscheiden zu können?«
»Auf den Weg fiel von der Straße her ein ganz, ganz matter Laternenschein, im Garten bei mir war es aber stockfinster. Mich hat sicher keiner bemerken können.«
»Und was wollte der Mann? Was tat er?«
»Ich sagte ja schon, dass der Komposthaufen hinten im Garten am Fluss liegt. Und ich konnte deshalb sehen, dass der Mann ganz nahe ans Wasser heranging und was hineinwarf. Es klatschte schwer auf, aber etwas muss ihm aus der Hand und auf den Kies am Ufer gefallen sein. Das klirrte wie Glas.«
»Wie Glas?«
»Ich kann es nicht anders sagen. Er bückte sich rasch und hob es wieder auf und warf es auch noch ins Wasser hinein.«
»Mein Gott, Frau Kübelmorgen, das ist ja fabelhaft interessant. Und vielleicht ungeheuer wichtig. Haben Sie den Menschen denn erkannt, meinen Sie, dass es der Inder gewesen wäre?«
»Da fragen Sie mich wahrhaftigen Gottes zu viel. So hell war es ja auch da draußen auf dem Weg nicht, um das Gesicht erkennen zu können, und an den Sträuchern war noch eine ganze Menge Laub. Der Figur nach kann er’s gewesen sein, vielleicht, vielleicht auch nicht, muss ich immer wieder sagen.«
»So recht glauben kann ich es eigentlich nicht vom Amaru. Sein Gesicht ist so nett und sympathisch. Aber wer kann es wissen? Jedenfalls bin ich Ihnen riesig dankbar für Ihr Vertrauen. Und jetzt will ich rasch meine Schulden bezahlen, dann muss ich gehen.«
»Die Schulden sind nicht so groß. Nur der Polizei nichts von dem sagen, was ich geschwatzt habe, gnädiges Fräuleinchen.«
»Wenn sich’s irgend machen lässt, sollen Sie Ruhe vor den Schnüffelmajoren behalten.«
»Ja, ja, das müssen Sie machen. Die kann ich nun mal in den Tod nicht leiden …«
Liselottens Rechnung war schnell berichtigt, und sie ging mit freundlichem Abschiedswort hinaus. Was die Knusperhexe berichtet hatte, klang aufregend in ihr nach. Der Inder hier an dem Abend, an dem Xaver Stieler vergiftet worden war! Und hinterher auf dem einsamen Weg der einsame Mann, der etwas in den Fluss geworfen hatte, das wie Glas geklirrt hatte! Vielleicht war es die vergiftete, mit einer anderen vertauschte Flasche gewesen, die der Mörder ins Wasser versenkt hatte, das nichts verriet. Und um halb acht Uhr hatte die Frau den Laden geschlossen. Erst um acht Uhr war Graf Stefan hier gesehen worden. Es war ein Unschuldsbeweis für ihn, was die Frau beobachtet und gesagt hatte.
Liselotte durchlebte das freudige Gefühl eines gutherzigen Triumphs. In ungeheurer Eile jagten sich die Gedanken in ihrem Kopf. Sie stand noch vor der Tür des kleinen Ladens und hatte schon alle Folgerungen und Schlüsse gezogen. Nun noch auch den Weg sehen, wo der Unbekannte damals gegangen war. Dort, – nein, dort auf der anderen Seite des Gartens bog er von der Straße zum Fluss hinunter ab. Und schon hatte Liselotte diese Stelle mit eiligen Schritten erreicht. Ein mattes Licht von einer schräg jenseits der Straße stehenden Laterne fiel wirklich auf den Anfang des in leichter Senkung abwärts führenden Weges. Dann verlor er sich, von schwarzen Hecken fest eingeschlossen, in der Dunkelheit. Nur hinten, geradeaus kam wieder ein wenig Helle von der Wasserfläche her. Und vor dieser wenigen Helle, ja, war das wirklich ein Mensch, der dort sich bewegte?
Das Herz der Suchenden, Forschenden schlug so stark, dass ihr der Atem verging. Ja, das dort hinten war wirklich die langsam sich vorwärts zum Fluss zu bewegende Gestalt eines Menschen. Gleich einem aufrechten Schattenstreifen schwebte sie der matt leuchtenden Wasserfläche zu. Liselotte presste die Hand auf das Ungestüm klopfende Herz. Wenn dies derselbe Mann wäre, den die Krämerin hier gesehen hatte. Wenn es der Mörder wäre, den irgendein Grund noch einmal an die Stelle trieb, wo hin er den Beweis seiner Tat getragen hatte!
Sie wagte nicht den Weg hinunterzugehen, um sich durch kein Geräusch zu verraten. Sie bohrte nur die Blicke in das dichte Gewebe von bewegtem und unbewegtem Schatten dort hinten hinein. Plötzlich gab es ihr einen Stoß, – die Gestalt war verschwunden. Wo war sie geblieben? Gab es dort am Wasser entlang einen Pfad, auf dem sie weitergegangen war? Liselotte hielt sich nicht länger. Alles, was an Keckheit und Mut in ihrem kleinen, zierlichen Körper wohnte, zusammenfassend, ging sie mit vorsichtigen, hastenden Schritten den Weg hinunter, das Licht hinter sich lassend, fest eingeschlossen von den schwarzen Heckenwänden. Leise schlich sie sich vorwärts. Die feuchte Kühle des Wassers kam ihr entgegen. Die von der Dunkelheit geweiteten Augen vermochten hier ein wenig schärfer zu sehen. Geradeaus, ins Wasser hinein, erstreckte sich ein schmales, dunkles Bauwerk, wahrscheinlich die Landebrücke der einstigen Fähre. Rechts ging die Hecke des Gartens von Frau Kübelmorgen bis unmittelbar an den Fluss hinunter. Dorthin konnte die Nachtgestalt nicht verschwunden sein. Aber links, da ließ das Nachbargrundstück einen schmalen Streifen am Wasser her frei. Mit ganz mattem Leuchten zeichnete sich der schmale Kiespfad ab, und auf ihm, – ja, wahrhaftig, da war sie wieder, die gesuchte Gestalt!
Etwas deutlicher zeichnete sie sich hier im Freien ab. Es war ein Mann, das konnte Liselotte deutlich erkennen. Er ging mit gebeugtem Kopf suchend oder nachdenklich langsam dahin. Dort hinten machte der Fluss eine Biegung und mit ihm der Pfad, auf dem der Mann sich bewegte. Gleich musste der ebenfalls umbiegende Gartenzaun ihn verdecken. Unwillkürlich trat Liselotte weiter vor ans Wasser heran, um die Gestalt nicht aus den Augen zu verlieren. Ihr Mut reichte nicht aus, dem verdächtigen Mann weiter nachzulaufen, sie hätte gar zu gerne gesehen, wohin er ging. Jetzt war sie schon so weit vorwärts getreten auf dem kiesigen Ufer, dass unmittelbar vor ihren Füßen die nächtlich dunkle Flut vorüber glitt. Sie schaute suchend umher. War es nicht möglich, – ja, dort auf der Spitze der alten Landebrücke konnte sie vielleicht sehen, wo der Mann geblieben war. Schnell betrat sie den hölzernen, ins Wasser hineingebauten Steg, schritt weiter und weiter vorwärts auf ihm, spähte zu gleich zu der Seite hin, wo die Gestalt auf dem gebogenen Pfade verschwunden war. Da plötzlich ein Krachen, ein Stürzen, ein Aufschrei, und …
»Hilfe! Hilfe!«, klang es durch den Abend. Gleich fand auch der Hilferuf ein Echo. Der Klang von raschen, laufenden Füßen auf dem Kies tönte herüber, die Gestalt eines Mannes bog um die Wendung des Pfades und kam eilig näher.
»Was ist? Was gibt es?«, rief er schon von Weitem.
»Hierher, hierher – ach, Hilfe, Hilfe«, jammerte Liselotte.
Schon war er neben ihr und streckte die Hand nach ihr aus. Ein morsches Brett war unter ihr eingebrochen. Im Fallen hatte sie sich an das Holzwerk geklammert, aber allein konnte sie sich nicht wieder aus dem Wasser herausarbeiten, das kalt und gierig an ihren Kleidern zerrte.
»So … halten Sie sich an mir fest … die Hand nicht loslassen … so … so … jetzt geht es.«
Er hatte sie ziehend und hebend wieder aufs Trockene gebracht.
Sie stammelte, noch von Schrecken und Nässe zitternd: »Ach, danke … danke … um Gotteswillen, sind Sie es, der mich gerettet hat?«
Er lachte fröhlich auf. »Ich bin es. Daran ist kein Zweifel. Aber wen Sie mit Ihrem ›Sie‹ meinen, das dürfen Sie mir noch anvertrauen.«
»Ja, sind Sie nicht eben hier am Wasser hinuntergegangen?«
»Das tat ich. Und es war gut. Sie hatten hier nämlich um diese Stunde wenig Auswahl an Lebensrettern.«
»Also, Sie sind es wirklich. Ach, bitte, bitte, lassen Sie mich gehen, dort hinauf zur Straße, dorthin, wo Licht ist.«
»Mit Vergnügen. Ich bin selbst gespannt, bei Beleuchtung zu sehen, was ich denn eigentlich aus dem Wasser gezogen habe. Sagen Sie mir nur erst einmal, was in aller Welt Sie veranlasst hat, hier in der Finsternis auf dem alten Bauwerk herumzuturnen?«
»Ach, das kann ich Ihnen … Ihnen am allerwenigsten sagen.«
»Ich glaube wirklich, wir müssen ans Licht gehen. Vielleicht werden dann auch Ihre Worte ein wenig heller.«
»Ich kann ganz gut allein gehen«, sagte sie, noch immer vor der Nähe des vermutlichen Mörders bebend.
»Oh nein. Das Vergnügen muss ich zur Belohnung wenigstens haben, Sie mir anschauen zu dürfen. Denn Ihre Stimme, – mir ist es wahrhaftig, als ob ich die schon einmal gehört hätte.«
»Ich weiß nicht, fragen Sie mich nicht. Gott sei Dank, da sind wir auf der Straße.«
Sie waren sprechend auf dem engen Pfad emporgestiegen, und jetzt kam das Laternenlicht freundlich auf sie zu. Liselotte blieb stehen und sah sich ihren Retter mit halb ängstlichen, halb forschenden Blicken an, um dann lebhaft auszurufen. »Mein Gott, Sie sind es ja gar nicht!«
Er lachte laut auf. »Erst rufen Sie, dass ich es bin, – dann rufen Sie, dass ich es nicht bin. Sie machen mich wahrhaftig noch zweifelhaft über mich selbst. Aber jetzt, seit ich Sie sehen kann, ist an mir die Reihe zu rufen: Ihre Stimme hat mich nicht getäuscht, mein gnädiges Fräulein, Sie sind Fräulein Liselotte Hell. Es gibt nämlich Stimmen, die man in einer ganz besonderen Abteilung seiner Seele bewahrt. Aber dass ich Sie hier aus dem Wasser habe ziehen müssen, das ist mir wie der abenteuerliche Traum, den ich jemals geträumt habe.«
»Herr Leutnant, – mein Gott, Herr Leutnant!«
»Mit meinem Leutnantsrang ist’s vorüber. Hugo Grabert bin ich doch darum immer noch, und ich denke mit Wonne daran, wie häufig und wie vergnügt wir vorigen Winter zusammen getanzt haben.«
»Ja, ja, – Walzer links herum, das war himmlisch mit Ihnen. Aber Sie sind ja jetzt bei der Polizei. Da sind Sie gewiss der hübsche junge Herr.«
»Ich fürchte, nein. Kommen Sie, wir müssen vor allen Dingen sehen, ein Auto für Sie zu bekommen, damit Ihnen das kalte Bad nicht schadet. Wir können im Gehen ja plaudern. So leicht werden Sie mich nicht los. Und ein klein wenig Aufklärung, was Ihr nächtliches Abenteuer hier bedeutet hat, könnten Sie mir wohl geben.«
»Ja, ja, – wissen Sie, für wen ich Sie gehalten habe?«
»Keinen Schimmer.«
»Für den indischen Zauberkünstler Amaru.«
Grabert blieb für einen Augenblick stehen, von Überraschung an die Stelle gebannt. »Alle Wetter! Das ist aber wirklich die tollste Sache, die mir je vorgekommen ist. Ihnen will ich es anvertrauen: Ich selbst bin hierhergekommen, um diesem indischen Zauberkünstler nachzuspüren, und Sie halten mich für ihn, den ich verfolge.«
Liselotte lachte fröhlich auf. Sie fühlte neben diesem hübschen jungen Herrn – sie fand ihn wirklich sehr hübsch – nicht einmal die schwere Nässe von ihren Kleidern. »Oh, jetzt kann ich mir alles ganz gut zusammenreimen. Sie sind heute Mittag bei der braven Frau Kübelmorgen gewesen, sie hat Ihnen ebenso gut wie mir von dem Inder in ihrem Laden und von dem schwarzen Mann auf dem einsamen Weg erzählt, und Sie haben sich bei der passenden abendlichen Beleuchtung den Schauplatz dieses Ereignisses angesehen.«
»Ganz recht, ganz recht. Und ich habe dabei nur in meinem Beruf gearbeitet. Bin ich doch jetzt wohlbestallter Detektiv in Amt und Würden, wenn auch möglichst inkognito, – wegen der Herren Spitzbuben. Aber weshalb Sie den abendlichen Streifzug hier unternommen haben, …«
»Ich habe gern auch einmal Detektiv spielen wollen.«
»Fräulein Detektiv, das ist reizend! Wir müssten eigentlich ein Teilhabergeschäft gründen.«
»Ja, das wäre furchtbar nett!«
Sie waren für einen Moment stehen geblieben und sahen einander lachend an. In ihren Augen war ein merkwürdig warmes Leuchten – Frühling im Herbstabend.
Nach einem kleinen Schweigen wurde Liselottens Gesicht ernsthaft. »Ich bin nicht zum Spaß hier herumgelaufen. Dass man dem Grafen Stefan Hersberg die Schuld am Tod Xaver Stielers geben will, das hat mich ganz wild gemacht, – nicht meinetwegen, Herr Leut…, Herr Detektiv. Aber wegen meiner Freundin Hanna Rainer. Und ich fühle ganz bestimmt, er ist unschuldig.«
Bei ihren Worten war sein Gesicht noch ernsthafter geworden als ihres. »Der Graf ist unschuldig, – das ist auch mein Glauben.«
»Und Sie halten den Inder für den Mörder, nicht wahr?«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht.«
»Wie Frau Kübelmorgen sagt. Ich sehe, Sie sind nicht nur Detektiv, Sie sind auch Diplomat geworden.«
»Das hängt wohl ein wenig zusammen. Dort steht ein Auto, jetzt müssen Sie rasch nach Hause fahren …«
»Schade!«
»Schade?«
»Jawohl, ich hätte gerne noch ein wenig mit Ihnen geplaudert.«
»Hoffentlich sehen wir uns bald einmal wieder, in trockenen Kleidern.«
»Ja, das müssen Sie mir versprechen. Und jetzt noch einmal meinen allerherzlichen Dank für das Aus dem Wasser ziehen. Vorhin, als ich Sie noch für den mörderischen Inder hielt, ist mein Dank wohl etwas kühl ausgefallen.«
»Ich bin glücklich, dass der Zufall – wenn es nicht eine besondere Fügung war – mich hierher geführt hat. Und nun steigen Sie ein …«
Er hatte den Wagen herangewinkt. »… und gute Nacht, Fräulein Detektiv.«
»Gute Nacht, Herr Detektiv. Auf baldiges Wiedersehen.«
»Auf recht baldiges.«
Er half ihr beim Einsteigen, das aufgrund der nassen Kleider ein wenig schwierig war. Bevor er die Wagentür hinter ihr schloss, rief er noch in den Wagen hinein: »Vergessen Sie das Teilhabergeschäft nicht.«




