Der Schwur – Erster Teil – Kapitel 5
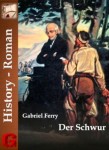 Der Schwur
Der Schwur
Historischer Roman aus dem mexikanischen Unabhängigkeitskrieg
Erster Teil
Der Dragoner der Königin
Kapitel 5
Die Hazienda las Palmas
Bei der Wahl des zum Bau der Hazienda bestimmten Örtlichkeit war die jährlich eintretende Überschwemmung mit in Betracht gezogen worden. Die Ebene, in der sie errichtet war, dehnte sich von Osten nach Westen unabsehbar aus, ebenso wie nach Süden. An der Nordseite war sie von einer ziemlich hohen Hügelkette eingeschlossen, an deren Fuß sich wieder andere Hügel erhoben und sich unmerklich bis zum Niveau der Ebene verflachten.
Die Hazienda las Palmas war an den Hügeln, deren flache Terrassen fast die Höhe derselben erreichten und deren viereckiger Glockenturm den Gipfel überragte, auf dem einen äußeren Ende dieses Amphitheaters erbaut.
Am entgegengesetzten Ende befanden sich große Stallungen und umfassende Räumlichkeiten für die Arbeiter der Hazienda, worunter auch die Viehhirten und die Dienerschaft, die für den ausschließlichen Dienst des Gebieters bestimmt war, zu verstehen sind. Eine hohe und starke Mauer, von mächtigen Gegenpfeilern gestützt, verband die Hazienda mit dem Teil, in dem sich das Gesinde aufhielt, und zog sich die ganze Länge der Hügel hin. Ein starkes und massives Tor, in der Mitte der schützenden Mauer angebracht, gestattete den Eintritt.
Bei dieser Lage bildete die Hazienda las Palmas, so genannt wegen der mächtigen Palmen, mit denen die Ebene ringsherum bestanden war, eine Zufluchtsstätte bei eintretenden Überschwemmungen und auch zugleich eine fast uneinnehmbare Festung.
Wir sind hier genötigt, uns noch einmal bis eine Stunde vor Sonnenuntergang desselben Tages zurückzuversetzen, zu der Zeit, als der Dragoner und der Student sich auf ihrem Weg trennten, und als der Schwarze Clara sich auf so unangenehme Weise in Gesellschaft des Indianers Costal zum Tigerjäger umgewandelt sah.
Die Glocke der Hazienda läutete zum Abendgebet und bezeichnete zugleich das Ende des Tagwerks.
Mit fast übertriebener Pünktlichkeit stellten sich bei dem ersten Schlag die indianischen Arbeiter ein, die Viehhirten sprengten auf ihren Pferden herbei und eilten in die Ställe oder zu ihren Nachtlagern, während andere ihre dampfenden Pferde absattelten. Die entfernter beschäftigten Arbeiter strömten ebenfalls von allen Seiten herbei. Das Feld wurde öde, dagegen füllten sich die gemeinschaftlichen Aufenthaltsorte und die Viehställe. Alle aber murmelten beim Ton der Glocke mechanisch ihre Gebete.
In der Hazienda selbst befanden sich in einem fast orientalisch vergitterten Zimmer des ersten Stockwerks drei Frauen. Zwei von ihnen waren, wie leicht aus der großen Ähnlichkeit zu erkennen war, Schwestern. Es waren die Töchter Don Marianos, die Dritte war eine bevorzugte Dienerin.
Die beiden Töchter Don Marianos boten in diesem Augenblick in verschiedenen Facetten das Bild jener prallen Sorglosigkeit dar, die aus dem Harem des Orients entlehnt zu sein schien, welche aber durch die Keuschheit gehoben und geadelt wird.
Die eine von ihnen saß nach orientalischer Sitte mit gekreuzten Beinen auf einer chinesischen Matte. Lange schwarze, eben erst geflochtene Haare fielen nachlässig über ihre Schultern. Das junge Mädchen schien sich den Händen ihrer Kammerfrau anvertraut zu haben.
Das sanfte Gesicht des jungen Mädchens vereinigte alle Reize, welche die Schönheit einer Kreolin kennzeichnen, ohne verunstalte Mängel zu haben. Der stolze und ruhige Ausdruck ihres Gesichts zeigte einen glühenden Enthusiasmus an.
Die elegante Feinheit der spanischen Rasse dokumentierte sich in den weißen Händen von fast idealer Form, und in einem kleinen Fuß, wie ihn die Frauen Mexikos und Südamerikas ausschließlich zu besitzen scheinen. Ein leichter Atlasschuh bedeckte diesen reizenden nackten Fuß.
Dieses junge Mädchen war Doña Gertrudis, die Älteste der beiden Schwestern. Obwohl ihre jüngere Schwester ihr in nichts nachstand, war ihre Schönheit doch von einer ganz anderen Art – feurig und spöttisch. Ihre lebhaften und glänzenden Augen bildeten einen auffallenden Gegensatz zu den festen und ruhigen ihrer älteren Schwester. Die Eindrücke gingen so leicht über diese bewegliche Oberfläche hin, wie sie in die strengere ihrer Schwester tief einschnitten. Letztere glich einem Vulkan ihres Landes, der immer mit einem Schneemantel verhüllt ist.
Obgleich die Älteste nur erst siebzehn Jahre alt war, und die Jüngere nicht mehr als sechzehn zählte, hatten beide doch schon jene Entwicklung weiblicher Reize erlangt, der die Zeit keine Schönheit rauben kann, indem sie die Harmonie der Formen verändert.
Während Gertrudis ihr reiches Haar den Händen ihrer Kammerfrau überließ, ordnete Marianita auf ihren seidenen Strümpfen die an den Schuhen befestigten Atlasbänder, die ihren reizend kleinen Fuß umgaben.
Die politischen Ereignisse hatten auch im Schoß dieser Familie wie in so vielen anderen ihre Spur hinterlassen. Vor der mexikanischen Revolution war es der glühende Wunsch einer Kreolin, irgendeinen Neuangekömmling aus dem Mutterland zu heiraten. Demzufolge war auch eine Heirat zwischen Doña Marianita und einem jungen Spanier der Umgegend beabsichtigt. Gertrudis hatte diese Ehre ausgeschlagen, und so war denn das Vorhaben zwischen Marianita und dem Spanier zustande gekommen. Warum Gertrudis eine Ausnahme von der oben angeführten allgemeinen Regel machte, wird der Verlauf dieser Erzählung zeigen.
Die erwähnten Vorbereitungen fanden in Erwartung zweier Gäste statt, von denen der eine der spanische Verlobte, der andere der Hauptmann der Königin-Dragoner, Don Rafael Tres-Villas, war. Der Erstere hatte nur einen Weg von kaum zwei Meilen zu Pferd zurückzulegen, und er konnte jeden Augenblick ankommen. Der andere hatte einen Weg von mehr als zweihundert Meilen zu machen. Obgleich er auf das Bestimmte seine Ankunft auf diesen Tag festgesetzt hatte, war es doch gerechtfertigt, anzunehmen, dass bei einer so langen Reise irgendein unvorhergesehener Zufall seine Rechnung vereitelt und seine Ankunft um einen Tag verzögert haben konnte. War dies der Grund, warum Gertrudis ihre Toilette noch nicht angefangen hatte, als Marianita die ihre schon beendigte. War Don Rafael der einzige Mann, in dessen Augen sie im Glanz ihrer Schönheit erscheinen wollte?
Nachdem die Dienerin entlassen worden war, eilte Doña Marianita an das Fenster.
Ihre Augen schweiften am Horizont der Ebene umher, während ihre Schwester sich in einen Ledersessel lehnte und dort, mit einer heftigen Bewegung des Kopfes und der Hand ihre Haare zurückwerfend, unbeweglich und träumerisch sitzen blieb.
»So viel ich mich auch umsehe«, rief Marianita, »die Ebene ist und bleibt leer. Ich bekomme weder Don Fernando noch Don Rafael zu sehen. Meine arme Gertrudis, ich fürchte, umsonst Toilette gemacht zu haben. In einer halben Stunde ist die Sonne untergegangen.«
»Don Fernando wird kommen«, erwiderte Gertrudis mit ruhiger und sanfter Stimme.
»Man erkennt gleich an dem ruhigen Ton deiner Stimme, dass du deinen Verlobten nicht erwartest wie ich, und zwar, warum soll ich es nicht sagen, ich erwarte mit Ungeduld seine Ankunft. Du kennst das Gefühl nicht, Gertrudis!«
»An deiner Stelle würde ich mehr Traurigkeit als Ungeduld empfinden.«
»Traurigkeit, oh nein! Wenn Don Fernando diesen Abend nicht kommt, so wird er dabei im Verlust sein. Er wird dann nicht das Vergnügen haben, mich in diesem weißen Kleid, das er so gern sieht, zu erblicken. Auch diese Granatblumen in meinen Haaren nicht, die ich nur genommen habe, um ihm zu gefallen, denn ich ziehe meinerseits die weißen Blumen des Majoran vor. Ich habe aber gehört, dass eine Frau nur ihrem Mann zu gefallen, leben soll.«
Bei diesen Worten ließ Marianita ihre Finger wie Kastagnetten aneinander schlagen, ohne den geringsten Anschein von Traurigkeit, sondern im Gegenteil, mit der Zufriedenheit, die ein ruhiges Gewissen gewährt.
Gertrudis antwortete nicht, sie erstickte einen Seufzer, während der Abendwind ihre Haarwellen in Bewegung setzte und ihr kleiner nackter Fuß einen Schuh aus schwarzem Atlas hin und her schaukelte.
»Dies Landleben ist doch ungeheuer langweilig«, erwiderte Marianita. »Der Tag, das ist wahr, ist nicht zu lang, um sich zu schmücken und um Siesta zu halten. Aber die Abende! Weiter nichts, als den Nachtwind brausen hören und allein im Garten zu promenieren, das ist traurig, höchst traurig, anstatt zu singen und in Gesellschaft zu tanzen. Wir leben hier wie die gefangenen Prinzessinnen in dem Ritterroman, den ich im vorigen Jahr angefangen, aber noch nicht beendet habe … Ah! Ich bemerke ganz tief am Horizont eine kleine Staubwolke endlich … Ich sehe einen Reiter!«
»Einen Reiter?«, rief Gertrudis lebhaft, »welche Farbe hat sein Pferd?«
»Sein Pferd ist ein Maultier. Leider! Es ist kein irrender Ritter. Ich glaube, man sagt, es gäbe dergleichen nicht mehr.«
Gertrudis seufzte von Neuem.
»Jetzt kann ich ihn erkennen, es ist ein Priester«, fuhr Marianita fort. »Das ist doch etwas, besonders wenn er singt und ebenso gut auf der Mandoline spielt, wie der letzte, der sich zwei Tage in der Hazienda aufgehalten hat. Er nähert sich im Galopp. Das ist ein gutes Zeichen, doch nein, er sieht traurig und ernst aus. Ah! Er hat mich gesehen, denn er macht ein Zeichen mit der Hand! Ich werde gehen, sie ihm zu küssen … Ich habe Zeit!«
Bei diesen Worten spitzte die junge und schöne Kreolin, der es ihre Erziehung als Gesetz vorgeschrieben hatte, die Hand jedes Priesters zu küssen, mit sauertöpfischer Miene ihre beiden frischen und wie Granatblüten roten Lippen.
»Aber so komm doch und sieh ihn dir an, Gertrudis, er ist soeben am Tor der Hazienda angelangt.«
»Ich habe Zeit damit, Marianita, sage mir aber, siehst du keinen andern Reiter? Don Fernando …?«, fragte Gertrudis, gleichsam um sich selbst zu täuschen, indem sie ihre Schwester täuschte.
»Ach ja! Don Fernando …? Wenn er durch irgendeinen Zauber in einen Maultiertreiber, der seine Herde Lasttiere vor sich hertreibt, als ob er um einen Preis im Wettlauf konkurriere, verwandelt ist. Das ist alles, was ich sehe. Jetzt kommt der Priester. Warum beeilt sich heute alles so sonderbar?«
Das Öffnen und Zuschlagen der Türen in der Hazienda und der Lärm, der vom Hof aus zu den jungen Mädchen drang, zeigte, dass nicht allein der Priester, sondern auch der Maultierhüter gegen allen Gebrauch die Gastfreundschaft des Don Mariano Silva in Anspruch genommen hatten.
Noch wussten die beiden Mädchen nichts von der Gefahr, die den Reisenden in der Ebene drohte.
Der Lärm in der Hazienda wuchs fortwährend. Die Treppen hallten von den Tritten der Diener wider, die eilig kamen und gingen.
»Jesses Maria! Was passiert?«, schrie Marianita laut auf, ein Kreuz schlagend. »Soll die Hazienda eine Belagerung aushalten? Kommen die rebellischen Räuber aus dem Westen heran, um uns anzugreifen.«
»Warum nennst du die Männer, die für ihre Freiheit kämpfen und deren Anführer Priester sind, Räuber?«, entgegnete Gertrudis mit ihrer harmonischen und ruhigen Stimme.
»Warum? Weil sie Feinde der Spanier sind, deren Blut in unseren Adern rinnt, weil ich endlich einen Spanier liebe!«, rief Marianita mit leidenschaftlicher Erregung aus.
»Du glaubst zu lieben, Marianita«, erwiderte Gertrudis sanft. »Nach meiner Idee bringt die Liebe Symptome hervor, die ich nicht bei dir finde.«
»Und wenn das wirklich der Fall wäre, was schadet es? Wenn er mich nur liebt! Bin ich nicht der Schatz, den er bald sein eigen nennen wird? Soll ich an etwas anderes denken als an ihn?«, fügte das junge Mädchen mit der Stimme leidenschaftlicher Ergebenheit, welche die Frauen dieses Landes an den, welchen sie lieben, verschwenden, hinzu, und die grenzenlos ist, wenn sie wahrhaft lieben.
Das plötzliche und hastige Läuten im Turm der Hazienda erschreckte die beiden Schwestern und machte ihrer Unterhaltung ein Ende, die einen Gegenstand betraf, der unter ihnen ebenso den Keim der Zwietracht auszustreuen drohte, wie er die Bürgerkriege erzeugt, und auch die engsten Bande des Blutes und der Freundschaft zerbricht.
Als Marianita sich anschickte, über die Ursache des Tumults Erkundigungen einzuziehen, öffnete die Kammerfrau die Tür und rief, ohne eine Frage abzuwarten: »Ave Maria, Señoritas! Die Überschwemmung bricht herein. Ein Viehhirte ist soeben mit der Nachricht gekommen, dass die Flut nur noch drei oder vier Stunden entfernt ist.«
»Die Überschwemmung!«, riefen die beiden Schwestern, Marianita sich von Neuem bekreuzigend, und Gertrudis, indem sie sich schnell erhob und ihre Haare zitternd zusammenfasste.
»Jesses, Señorita«, sagte die Kammerfrau sich an die Letztere wendend. »Es scheint ja fast, als wolltet Ihr Euch in die Ebene stürzen, um zu helfen!«
»Don Rafael! Habe Mitleid mit ihm, mein Gott!«, schrie Gertrudis außer sich.
»Don Fernando!«, rief Marianita ihrerseits schaudernd.
»Die ganze Ebene wird bald nur noch ein ungeheurer See sein«, sagte die Kammerfrau. »Unglücklich der, den die Überschwemmung überrascht! Ihr aber, Doña Marianita, könnt Euch beruhigen. Der Hirtenjunge, der uns die unangenehme Nachricht brachte, ist von Don Fernando geschickt worden, um seinen Herrn, Don Mariano, zu benachrichtigen, dass er morgen in seinem Kanu ankommen werde.«
Nach Abstatten dieses Berichts ging die Kammerfrau hinaus.
»In einem Kanu!«, rief Marianita, mit gleicher Schnelligkeit von der Betrübnis zur Freude überspringend. »Das ist prächtig, Gertrudis, wir werden in einem Kanu auf der Ebene spazieren fahren und uns mit Blumen schmücken.«
Marianita machte sich aber sogleich einen Vorwurf über diese Anwandlung frivolen Egoismus beim Anblick ihrer Schwester, die, in ihre langen Haare gehüllt, die ihr wild in das Gesicht hingen, niedergekniet war und zu den Füßen der Madonna um die Rettung Don Rafaels flehte.
Jetzt begriff Marianita, was ihr bisher unbekannt gewesen war, nämlich das, dass eine Frau nur für den mit solcher Inbrunst beten kann, den sie liebt. Sie kniete neben ihrer Schwester nieder und vereinigte ihre Gebete mit den ihren, während das Glockenläuten unausgesetzt ihre traurigen Klänge in alle vier Himmelsrichtungen sandte.
»Ach! Meine arme Gertrudis!«, heulte Marianita, ihre Schwester in ihre Arme drückend und sie zärtlich umschlingend. »Verzeihe mir, dass ich es nicht erraten habe, dass dein Herz brach, während das meine aufjauchzte. Du liebst also Don Rafael!«
»Wenn er stirbt, sterbe ich auch! Das ist alles, was ich weiß!«, entgegnete Gertrudis.
»Gott wird ihn beschützen, beruhige dich. Vielleicht schickt er ihm einen seiner Boten, um ihn zu retten«, setzte Marianita im Aufschwung ihres einfachen Glaubens hinzu.
»Geh hin ans Fenster, während ich hier beten will!«, sagte Gertrudis. »Forsche du auf der Ebene, denn die Tränen trüben meinen Blick.«
Marianita gehorchte und Gertrudis kniete abermals vor dem Heiligenbild nieder.
»Das Pferd, das er reitet, muss dunkelbraun sein!«, stieß Gertrudis plötzlich hervor, ihre inbrünstigen Gebete unterbrechend. »Don Rafael weiß, wie sehr ich dieses edle Tier liebe. Es ist sein Schlachtross, das er während der indianischen Kriege geritten hat. Und dies sollte ihn auch hierher tragen, denn er weiß, dass ich sehr häufig die Blumen aus meinen Haaren genommen habe, um sie an seinem Stirnriemen zu befestigen. O, heilige Jungfrau! O, Jesses! Mein milder Gebieter! Don Rafael, wer wird dich zu mir geleiten?«, setzte das junge Mädchen hinzu, von der Erregbarkeit der Leidenschaften in die ihrer Gebete überspringend.
Die Ebene nahm eine immer trübere Färbung an. Gertrudis fuhr im Gebet fort. Bald darauf beleuchtete der Vollmond mit seinem blassen Licht die Savanne, ohne dass ein einziges lebendes Wesen seinen Schatten über die bleiche Fläche warf.
»Er wird noch bei Zeiten von der Gefahr benachrichtigt worden sein und auf seinem Weg innegehalten haben«, sagte Marianita.
»Du irrst dich, du irrst dich!«, erwiderte Gertrudis, ihre gefalteten Hände vor Angst ringend. Ich kenne ihn, ich beurteile sein Herz nach dem meinen. Einen Tag länger unterwegs zu sein, wäre ihm unmöglich gewesen, er wird daher der Gefahr getrotzt haben, um mich einige Stunden eher zu sehen.«
Während die Glocke fortfuhr, mit Macht zu läuten, und sich der Donner der heranwogenden Gewässer mit der traurigen Stimme der Bronze vermischte, wurde plötzlich ein rötlicher, anfangs zwar noch schwacher Schein am Horizont sichtbar.
Bald darauf schien dieser Glanz zu erlöschen. Ein Prasseln, ähnlich dem der glimmenden Weinrebe, drang zu den Ohren der aufmerksam lauschenden Schwestern. Der Schein der Flamme hatte plötzlich die Oberhand gewonnen und verbreitete seine Helle bis in die Gipfel der Palmen.
Auf den Spitzen der benachbarten Hügel der Hazienda wurden auf Befehl Don Marianos große Feuer angezündet, die wie Leuchttürme dem Wanderer in der Ebene bis zum Rettungshafen seiner gastfreundlichen Wohnung geleiten sollten.
So wurde Auge und Ohr zugleich von der Gefahr benachrichtigt und das Mittel zur Rettung geboten. Gigantische Schatten der Männer, die beauftragt waren, das Feuer zu unterhalten, zeichneten sich weithin auf der Ebene ab. Diese ungeheuren Schattenbilder, der purpurfarbene Schein, in dem sie auf- und niedertauchten, das Tosen der Gewässer, das die Warnstimme der Glocke ersticken zu wollen schien, umfingen die Sinne der beiden Mädchen mit einem lähmenden Schrecken.
Noch einige wenige Augenblicke, und das entfesselte Element brach sich schäumend am Fuß der benachbarten Hügel der Hazienda. Gertrudis unterbrach ihr Gebet.
»O, Marianita«, sagte sie, »siehst du noch nichts? Die Sturzsee nähert sich und gewinnt von Minute zu Minute mehr Boden.«
Marianita erwiderte nichts, aber ihre Blicke irrten unstet am Horizont umher. Ein Schrei entschlüpfte ihren Lippen.
»O, Unglück, Unglück!«, schrie sie, »ich bemerke zwei Reiter! Heilige Jungfrau, gib, dass es nur Schatten sein mögen! Aber nein, die Schatten gewinnen an Umfang – Mutter Gottes! Es sind wahrhaftig zwei Reiter – sie fliegen wie der Wind – aber, so schnell sie auch reiten, sie werden zu spät kommen.«
Beim Anblick der Reiter erhob sich auf der Terrasse der Hazienda, wohin sich der Besitzer und seine Diener begeben hatte, unwillkürlich ein allgemeiner Angstgeschrei. Und in der Tat war dies ein furchtbares Schauspiel, die beiden Männer im verzweifelten Kampf gegen die ungeheuren Wasserwogen ansprengen zu sehen, deren schäumend, vom Schein der Feuerbrände mit Purpur verbrämten Häupter deutlich zu erkennen waren.
Schleunigst warfen die Diener von der Mauer lange Seile hinab, um damit den Verunglückten nach Möglichkeit zu Hilfe zu eilen.
Die beiden, an das Fenster ihres Zimmers gebannten Schwestern konnten die Vorbereitungen zur Rettung nicht sehen.
Marianita, von einer unbezwingbaren Neugier getrieben, die uns oft gegen unsere bessere Überzeugung und namentlich die Frauen, hinreißt, ein herzzerreißendes Schauspiel mit anzusehen, lehnte sich mit einer Art hingebungsvollen Schrecken an das Gitterwerk des Fensters.
»Komm, Gertrudis«, sagte sie, ohne die Augen abzuwenden, ungeachtet der heftigen Schläge ihres Herzens, »komm und sieh sie dir an. Wenn einer von beiden Don Rafael ist, den ich nicht kenne, werden deine Augen ihn erkennen und deine Stimme ihn anfeuern.«
»Ach, nein, nein, ich werde es nicht imstande sein!«, entgegnete das junge Mädchen, deren geneigte Stirn den Boden zu den Füßen des Madonnenbildes berührte. »Ich würde dieses schreckliche Schauspiel nicht mit ansehen können, ohne in Ohnmacht zu sinken. Und wer würde dann für meinen Rafael beten? Nur ich kann es, mein Herz sagt es mir nur zu laut.«
»Die beiden Kavaliere reiten Pferde, schwarz wie die Nacht«, setzte nach einigen Minuten Marianita hinzu. »Der eine sitzt im Sattel wie ein Zentaur, aber er ist klein – ach! Sein Anzug ist der eines Maultiertreibers. Du siehst, dass der nicht Don Rafael ist.«
»Der andere! Erkennst du den anderen?«, fragte Gertrudis mit so schwacher Stimme, dass man sie kaum noch vernahm.
Marianita blieb eine Minute regungslos. »Der andere«, erwiderte sie dann, »ist größer, als der Erstere. Er hat sich auf den Hals seines Pferdes niedergebeugt, ich kann sein Gesicht nicht sehen. Ah! Jetzt erhebt er den Kopf, er ist ebenso fest im Sattel, wie der Erstere. Er hat ein stolzes Gesicht, einen dichten Schnurrbart, sein Auge scheint unter der goldenen Borte seines Hutes hervorzublitzen. Die Gefahr schreckt ihn nicht. Ah, es ist ein edler und schöner Kavalier.«
»Er ist es!«, stieß Gertrudis mit einem durchdringenden Geschrei hervor, das selbst das Brüllen des Wassers für einen Augenblick übertönte.
Sie erhob sich lebhaft, einem unwiderstehlichen Antrieb gehorchend, um sich an das Fenster zu begeben und den noch einmal zu sehen, der seinem Tod entgegenging. Aber ihre Kräfte versagten ihrem Willen den Dienst, sie fiel wieder auf die Knie in ihre hilfeflehende Stellung nieder.
»Jesses!«, hob Marianita starr vor Schrecken an, »noch eine letzte Anstrengung ihrer Pferde, und sie sind gerettet! Ach, vorbei!«, fügte sie mit Angst hinzu. »Die Fluten! Himmlische Jungfrau! Wie schrecklich sie sind, mit roten Schaumgipfeln und ihrem Tosen! Jetzt schlagen sie an die Mauer! Mutter Gottes! Beschütze diese beiden unerschrockenen Männer! Sie reichen sich die Hand! – Sie stoßen ihren Pferden die Sporen in die Flanken – Sie sehen dem Tod kühn ins Gesicht. – Sie stürzen sich auf die Gewässer mit erhobener Stirn, wie Reiter, die den Feind angreifen – Hörst du, Gertrudis? Der eine von ihnen, der kleinere, stimmt einen Gesang an, wie die ersten Christen vor den Löwen im Zirkus zu Rom.«
Die beiden Schwestern vernahmen wirklich eine männliche Stimme, welche das Getöse des Wassers übertönte.
Sie sang: In manos tuas domini, commendo spititum meum (In deine Hände, o Herr, empfehle ich meinen Geist).
»Ich sehe sie nicht mehr«, fuhr Marianita atemlos fort, »die Wogen haben Reiter und Pferd verschlungen.«
Einen Augenblick lang war ein beklemmendes Schweigen im Zimmer, das die Gewässer mit ihrem Tosen ausfüllten.
Immer zwar noch in kniender Stellung, aber ohne Kraft, ihre Gebete fortzusetzen, erhob das arme Mädchen bei der Stimme ihrer Schwester nicht mehr das Haupt, die fortfuhr: »Ah, ich sehe sie noch, da tauchen sie wieder auf. Jesses, Gottes Sohn! Es ist nur noch einer im Sattel und zwar der Größere. Gott im Himmel! Was für starke Arme hast du ihm verliehen! Er neigt sich über seinen Sattel, er hält den kleineren an seinen Kleidern fest – er hebt ihn wie ein Kind in die Höhe – er wirft ihn quer über sein Pferd – was für ein seltsames Schnaufen dessen Nüstern entströmt! Es scheint aber ebenso stark und mutig wie sein Herr. Die doppelte Last, die es nun trägt, verhindert es nicht, das Wasser zu durchschneiden. Gertrudis! Gertrudis! Die Gewalt des Wassers, welche die Waldbäume entwurzeln könnte, ist an diesem Mann gescheitert! Heilige Jungfrau! Kannst du zugeben, dass dieser starke und mutige Kavalier untergeht?«
»O ja! Er allein kann dieses Übermaß von Kraft und Mut besitzen!«, rief Gertrudis, die ihre Kräfte in einem Aufschwung leidenschaftlichen Stolzes wiederfand, den ihr die enthusiastischen Worte ihrer Schwester eingeflößt hatten.
Ihr Herz brach von Neuem, als diese mit ängstlicher Stimme fortfuhr: »Wehe! Wehe! Ein riesiger Baum wird gerade auf sie zugetrieben. Er wird das Pferd und die Männer zerschmettern!«
»Erzengel, der du seinen Namen trägst, beschütze ihn!«, murmelte Gertrudis. »Jungfrau Maria, besänftige den Zorn des Wassers. Ich weihe dir mein Haupthaar für sein Leben!«
Dies war das größte Gelöbnis, das sie ablegen konnte. Sie war keinen Augenblick unschlüssig, dieses Opfer zu bringen, als sie glaubte, damit den Zorn des Himmels beschwichtigen zu können.
Gleichsam als ob der Himmel ihr Gelübde angenommen hätte, fuhr Marianita, die den Schwur zitternd mit angehört hatte, nach einer kurzen Pause fort: »Gelobt sei Gott! Gertrudis, gesegnet sei er, der ein Werkzeug des Verderben in ein Werkzeug des Heiles umzuschalten weiß! Zehn Lassos haben sich um Zweige und Wurzeln des Baumes geschlungen. Die Wut des Wassers vermag nichts mehr über ihn. Er ist wie ein schwimmendes Floß. Der schöne Kavalier könnte sich auf seinen Stamm schwingen, aber er will weder das edle Tier, dessen Ausdauer sein Leben gerettet hat, noch den Mann, den er in seinen Armen hält, von sich lassen. Die Ströme umtosen ihn, ihre Wogen bedecken sein Haupt – er ermüdet nicht …«
»Vollende, Marianita, oder ich sterbe!«, murmelte Gertrudis.
»Ein Nebel hat sich vor meine Augen gelegt«, entgegnete diese. »Das Wasser scheint Feuerwellen zu treiben. – Sei stolz auf den, den du liebst, Gertrudis. Der edle Kavalier hat nichts mehr zu fürchten. Höre das Triumphgeschrei! Alle sind sie gerettet, die Reiter und das Pferd, auf dem sie saßen.«
Ein Freudengeschrei, in der Hazienda widerhallend, bestätigte die Worte Marianitas.
Beide Schwestern hielten sich einen Augenblick umarmt, dann ergriff Marianita eine Strähne der seidenen Haare Gertrudis’ und sagte, indem sie jene zärtlich an ihre Lippen drückte und zugleich einen Seufzer des Bedauern ausstieß: »Oh, deine armen, schönen Haare, die ein Königreich wert wären!«
»Begreifst du nicht«, erwiderte Gertrudis mit bezauberndem Lächeln, »nur er wird sie mir vom Haupt schneiden.«




