Der Schwur – Erster Teil – Kapitel 3
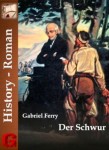 Der Schwur
Der Schwur
Historischer Roman aus dem mexikanischen Unabhängigkeitskrieg
Erster Teil
Der Dragoner der Königin
Kapitel 3
Der Geist der Kaskade
Das kleine Fahrzeug, welches den Schwarzen und den Indianer trug, setzte geräuschlos seine Fahrt flussabwärts fort. Während der Erstere sich Glück wünschte, den Klauen der Tiger entgangen zu sein, war der Letztere in Gedanken vertieft.
Ein Rest von Besorgnis mischte sich doch noch der jetzigen Zufriedenheit Claras bei. Die Jaguare hatten die Flucht ergriffen, das stand fest. In welche Richtung liefen sie? Er unterbrach daher das Schweigen und richtete diese Frage an Costal.
»Du willst wissen, welche Richtung sie genommen haben«, erwiderte der Indianer, »eine sehr einfache Erwägung wird dir das klar machen. Einen toten Büffel trifft man nicht alle Tage an. Sei daher überzeugt, dass der Tiger seine Beute nur mit Bedauern verlassen hat. Er weiß, von seinem Instinkt geleitet, an welche Stelle der Fluss den Kadaver hinführt, er wird ihn daher stromabwärts erwarten, unterhalb des Wasserfalls, den du von hier aus rauschen hörst.«
In der Tat wurde das beeindruckende Tosen der Gewässer, das Clara schon vernommen hatte, immer deutlicher, je mehr das Fahrzeug stromabwärts gelangte.
Nachdem die Schiffer wieder an ihren Ausgangspunkt gelangt waren, stiegen sie aus. Das Fahrzeug war wieder an den Wurzeln der Weide befestigt, von der es vor Kurzem gelöst worden war.
»Also«, begann der Schwarze, »Ihr glaubt, dass der Jaguar …«
»Ich bin dessen fast sicher, was ich gesagt habe, und wahrscheinlich wird keine halbe Stunde vergehen, ohne dass Ihr ihre Stimmen im Grund der Schlucht, wohin uns jetzt unsere Angelegenheit führt, vernehmen werdet.«
»Fürchtet Ihr nicht, dass sie von Euch Vergeltung fordern werden?«
»Ich kümmere mich darum gerade so viel, wie um einen Halm Maisstroh. Wir haben uns schon zu lange mit diesen Bestien abgegeben, glücklicherweise aber noch keine Zeit versäumt. Jetzt wollen wir aber an uns denken. Der Vollmond muss jeden Augenblick sichtbar werden. Lass mich nun den Gott der Gewässer, Tlaloc, anrufen, damit er dem Sohn der Kaziken von Tehuantepec Reichtümer sende.«
Bei diesen Worten entfernte sich der Indianer einige Schritte von Clara.
»Geht nicht zu weit!«, schrie dieser, an die fürchterlichen Nachbarn, die in der Nähe herum streiften, denkend.
»Ich lasse dir meinen Karabiner.«
»Ein schöner Vorteil! Caramba! Ein einziger Schuss und vier Tiger«, murmelte der Afrikaner.
Der Zapoteke ging langsam an das Flussufer, stieg auf einen Weidenstamm, der über das Wasser geneigt war, und fing nun an, hoch aufgerichtet, die Arme vorwärts gestreckt, nach einer bizarren Melodie eine Art indianischen Gebetes zu singen, dessen Worte zwar auch zu dem Schwarzen drangen, dessen Sinn demselben entging.
Clara hörte mit einem Schrecken anderer Art, als der war, den er vorhin empfand, die Anrufung der Götter des zapotekischen Heidentums, und derselbe verdoppelte sich, als ein zwar kaum hörbares Krakeelen an sein Ohr schlug, das, wie es der Indianer vorausgesagt hatte, aus der Richtung des Wasserfalls kam. Die Zunahme der Dunkelheit, welche die Annäherung der Nacht schon zu verbreiten anfing, das Zusammentreffen der wunderlichen Fürbitten des Heiden und das unheildrohende Toben des Tigers, das dazu gleichsam die Begleitung oder die Antwort des Geistes für seinen Bewunderer bildete. Dies alles konnte wohl für einen Menschen von der unwissenden und abergläubischen Spezies Claras furchterregend sein. Er glaubte feurige Augen vor sich im Dickicht glänzen zu sehen. Der zweifelhafte Schatten des Wassergeistes schien sich langsam vor ihm über dem Wasser zu erheben, und geisterhafte Stimmen mischten sich in das ferne Rauschen der Stromschnellen.
»Seid Ihr bereit?«, erscholl plötzlich die Stimme Costals.
»Wozu?«
»Mich zum Wasserfall zu begleiten und dort die Gottheit anzuflehen, die sich, wie ich Euch gesagt habe, dort zeigen wird.«
»Dort unten, beim Katarakt, wo die Tiger schreien?«, fragte der erschreckte Schwarze.
»Das Gold ist nur für diesen Preis zu haben«, erwiderte Costal.
»Vorwärts!«, rief der Schwarze nach einem Augenblick des Schweigens, durch die Aussicht auf Gold aufgeregt.
Der Indianer ergriff seinen Karabiner und seinen Hut, Clara hüllte sich in ein Stück grober Leinwand, die ihm als Mantel diente, und heftete sich, von Furcht und Begierde gleich mächtig ergriffen, an Costals Ferse.
Beide folgten dem Lauf des Flusses, der sie zu dem dröhnenden Wasserfall führte.
Je weiter sie vorwärts schritten, desto steiler und zerklüfteter wurden die Uferränder, desto geringer ihre Entfernung voneinander. Die auf beiden Ufern stehenden Bäume bildeten, ihre Wipfel sich zusammenneigend, eine dichte und finstere Wölbung. Das Wasser, in ein enges, mit Felsen besetztes Bett gezwängt, dessen Strömung mit jedem Augenblick reißender wurde, spritzte hoch auf. Das Sonnenlicht fand durch dieses dichte Dach wenig Zutritt, der Strom stürzte mit betäubendem Schall, gegen das das Gischten eines wild aufgeregten Meeres, das sich an den Felsgestaden bricht, nur ein schwaches Murmeln scheint, aus einer Höhe von einhundertfünfzig Fuß in eine tiefe Schlucht.
Weiß wie eine Schneelawine fiel das zerstäubte Wasser durch die Wölbung, welche zwei ineinander verschlungene Zedern bildeten.
An diesem schauerlichen Ort machten die beiden Gefährten halt. Der Schwarze war ruhiger als vorher, denn sowohl die Furcht vor den Jaguaren als auch die vor dem Wassergeist waren von der Begierde nach Gold erstickt worden.
»Jetzt«, sagte Costal, »höre aufmerksam auf die Unterweisungen, die ich dir geben will. Vor allem erinnere dich, dass, wenn der Geist dir erscheint und wenn du einen wirklichen Schrecken dem ersten Schauder folgen fühlst, dessen sich auch der tapferste Mann nicht erwehren kann, da es ihm eiskalt beim Anblick eines Geistes durch den Körper läuft, so bist du verloren.«
»Gut!«, versetzte der Dunkelhäutige, »die Kenntnis einer Goldmine ist es schon wert, dass man sich der Gefahr aussetzt, sich den Hals umdrehen zu lassen. Sprecht, ich höre.«
Indem der Schwarze diese Worte aussprach, war seine Haltung, wenigstens dem Anschein nach, ebenso entschlossen wie die Costals.
Der Indianer und der Schwarze setzten sich auf den Rand der tiefen Schlucht, in welcher der Fluss alsbald seinen ruhigen Lauf wieder annahm, von dicht belaubten Bäumen beschattet, die der Sonne kaum den Zutritt gewährten.
Wenn die beiden Abenteuerjäger nicht so vollständig von ihrer Unterweisung in Anspruch genommen worden wären, hätten sie trotz der Üppigkeit der Baumvegetation und der Lianen, welche die Schlucht bedeckten und in derselben schummerige Dunkelheit verbreiteten, dennoch bemerken können, was sich dort zutrug.
Ein Mann setzte sich fast zu ihren Füßen an der Stelle nieder, wo die noch vor Kurzem so empörten, jetzt ruhigen Wasser nachlässig die langen Stiele der Wasserpflanzen, welche die Ufer einrahmten und deren breite und glänzende Blätter sich zu den zierlichen Formen kleiner Sonnenschirme zusammen drehten, bespülten.
Dieser Mann, der aufmerksam das imposante Schauspiel des Wasserfalls zu betrachten schien, war kein anderer als der uns schon bekannte Hauptmann der Königin-Dragoner, den ein sonderbarer Zufall an diesen wilden Ort geführt zu haben schien.
Als einer unserer Protagonisten, die der junge Offizier im Verlauf unserer Erzählung einnehmen wird, scheint es gerechtfertigt, mit einigen Worten anzudeuten, wie er hierher gelangt war.
Als der Hauptmann der Dragoner, Don Rafael Tres-Villas, sich von dem Studiosus, der ihn einen Augenblick für einen Menschenfresser gehalten, getrennt hatte, verbrachte er keineswegs die Zeit damit, seinen Gedanken über die Sonderbarkeit, die ihn auf dem ganzen Weg beschäftigt hatten, freien Lauf zu lassen.
Er trieb sein Pferd zur Eile an, um möglichst bald seinen Bestimmungsort zu erreichen.
Der Offizier, obgleich ein Kreole, war doch niemals in diesen Teil des Landes, das ihn hatte geboren werden sehen, gekommen, und er war unschlüssig, als er an einen Ort gelangte, wo der Weg, dem er bisher folgte, sich in zwei verzweigte, welchen von beiden er einschlagen sollte, und von allem, was ihm hätte zur Unterweisung dienen können, entblößt, überließ er seinem Ross die Wahl. Das edle Tier hatte ohne Zweifel mehr Durst als Hunger. Es schlug, nachdem es in der Luft geschnuppert und die feuchten Ausdünstungen eines entfernten Flusses eingesogen hatte, den Zügel auf dem Hals, die Abzweigung des Pfades nach rechts ein.
Diese Wahl war für den Studiosus der Gottesgelehrtheit, der in seiner Hängematte ruhte, besonders glücklich, wie wir bald sehen werden, den Offizier führte sie vom Weg ab.
Der Kreuzweg zur Linken würde ihn dahin geführt haben, eine Biegung des Flusses zu umgehen, ohne genötigt zu sein, ihn zu überschreiten und geradewegs in die Hazienda las Palmas zu kommen, wohin er aus mehr als einem Grund große Eile hatte zu gelangen.
Schon schlug seit einigen Minuten das dumpfe Geräusch eines Wasserfalls an sein Ohr, als nach einer halben Stunde eines äußerst scharfen Ritts der Pfad plötzlich vor einem undurchdringlichen Buschholz abbrach, hinter welchem das Wasser mit Donnergetöse brüllte.
Obgleich dieser Ort kaum einige Sekunden von der Stelle entfernt war, an der Costal dem Schwarzen die Spuren der Jaguarfamilie gezeigt hatte, so war doch das Gehölz so dicht, dass er den Fluss nicht so nahe vermutete.
Der Offizier, aufgehalten durch das dichte Gebüsch, stieg vom Pferd, befestigte die Zügel an den Zweigen eines Baums und erreichte mit Anstrengung den Kamm der Schlucht.
Der Reisende wusste nicht, von welcher Seite er sich diesem dunklen Labyrinth nähern sollte, den eine dichte Laublage, die sich seit undenklichen Jahren hier aufgehäuft hatten und in er bei jedem Schritt bis an die Knie ein sank, bedeckte. Ermüdet von seinen vergeblichen Anstrengungen wollte er sich wieder zurückbegeben, als er eine Art Fußsteig, der durch das herabfallende Regenwasser oder vielleicht auch durch wilde Tiere gebahnt war, erblickte. Vorsichtig kletterte er auf demselben weiter, von der Hoffnung getrieben, für sich und sein Pferd irgendeinen Ausweg zu entdecken.
Der Abhang war schroff, der Boden aber fest, und der Offizier schickte sich an, ihn hinabzuklettern. Lianen, die sich von Baum zu Baum hinschlängelten, wie Seile, die manchen Treppen statt der Geländer dienen, sicherten sein Vorankommen. Endlich gelangte er in den Grund der Schlucht.
Der Offizier teilte das vor ihm stehende Gebüsch leicht auseinander und entlockte ihm der Anblick dieses herrlichen Wasserfalls, einen malerischen und beeindruckenden, den man in Amerika antreffen kann, einen Ausruf des Staunen und der Bewunderung.
Er setzte sich auf eines der Felsenbruchstücke, welche das Wasser lustig umplätscherte, um einen Augenblick mit Muße die schaumige Masse, die sich vor ihm ausbreitete, betrachten zu können. Aber Wolken blutdurstiger Moskitos störten ihn in seiner Betrachtung.
Der Offizier stand auf, um so schnell wie möglich ihren grausamen Stichen zu entfliehen, als ein unvorhergesehenes Schauspiel seine Aufmerksamkeit fesselte und ihn an seinem Platz festhielt.
Mitten in den schimmernden Wogen des Wasserfalls sah er in unbestimmten Umrissen die Wipfel zweier Zedern. Auf dem etwas gebeugten Stamm einer derselben glaubte er eine indianische Gestalt wie eine Maske aus Bronze zu unterscheiden.
Dieser Wahrnehmung folgte alsbald eine zweite. In einer gabelförmigen Verzweigung der anderen Zeder zeigte sich ein zweites Gesicht. Dieses Letztere war schwarz wie die Nacht. Er konnte bald nicht mehr daran zweifeln, einen Schwarzen und einen Indianer vor sich zu sehen.
Die Verwegenheit dieser beiden Männer war erstaunlich. Beide schritten, bald getrennt, bald vereinigt, über den brausenden Wasserfall fort, bald sich mit den Händen an die Zweige der Zedern hängend, während ihre Füße sich im Schaum badeten, bald über dem Wasserfall mit einer Tollkühnheit schwebend, die dem Offizier eine Art Schwindel verursachte.
Die Augen fest auf den tosenden Wasserfall gerichtet, bemerkten die beiden sonderbaren Personen Don Rafael kaum. Er glaubte, dass ein ihm unsichtbarer Gegenstand ihre Blicke gefesselt hatte, und war versucht, anzunehmen, dass dies irgendeine Wassergottheit sei, deren Eroberung der Schwarze sich vorgenommen habe, wie er aus seinen anmaßenden Gebärden schließen zu können glaubte. Sein breiter, bis zu den Ohren geöffneter Mund ließ eine Reihe von Zähnen sehen, deren Weiße im grellen Widerspruch mit der Ebenholzfarbe seines Gesichtes stand.
Der Indianer machte, nur mit mehr Würde und Anstand, dieselben Gebärden und Stellungen, wie der Schwarze, augenscheinlich zu einem ähnlichen Zweck.
Bald darauf machte Costal, mit einer Hand sich an einem Zweig festhaltend und frei über dem Abgrund schwebend, seinem Gefährten ein Zeichen, seine Grimassen einzustellen, und der Schwarze zeigte jetzt nur noch sein schwarzes, unbewegliches und ernstes Gesicht. Der Indianer streckte den Arm aus und begann eine Art Beschwörung, von einem Gesang begleitet, den das Toben des Wasserfalls verschlang. Der Offizier erkannte deutlich an dem Muskelspiel des Mundes des Indianers, dass er aus voller Brust sang.
So schwer es auch Don Rafael bei seiner gespannten Neugierde wurde, die sonderbare Handlung zu unterbrechen, veranlasste ihn doch der Wunsch, endlich zu erfahren, wo er sich befände und welchen Weg er einzuschlagen habe, seine Stimme zu erheben und aus allen Kräften zu rufen, um die Aufmerksamkeit der beiden Abenteurer auf sich zu ziehen.
So stark auch seine Lunge sein mochte, der betäubende Lärm des Wasserfalls machte es unmöglich, dass seine Stimme bis zu jenen drang.
Nun beschloss er, den Ort zu erreichen, wo ihm Schwarze und Indianer erschienen waren. Deshalb kehrte er auf demselben Weg zurück, den er vorhin gekommen war.
Don Rafael stieg vorsichtig bis zu dem Gewölbe hinauf, das die beiden Zedern oberhalb des Wasserfalls bildeten. Die beiden anderen Personen waren aber verschwunden.
Er kletterte mit möglichster Vorsicht auf einen der beiden Bäume und betrachtete von hier aus den Wasserfall mit erneuter Aufmerksamkeit, in der Hoffnung, hier einige Gegenstände zu entdecken, die das wunderbare Benehmen des Schwarzen und des Indianers rechtfertigen könnten. Er bemerkte weiter nichts, als was er schon vorher gesehen hatte – den schäumenden Wasserfall und lange Wasserfäden, die sich an den Felsspalten hinschlängelten und sich zuletzt wieder mit dem Hauptstrom vereinigten.
Die Sonne sank merklich, ihre letzten Strahlen erloschen in dem Tosen. Ungeachtet der Dämmerung, die sich plötzlich über dem Fluss gelagert hatte, erkannte der Dragoner leicht in den beiden Männern, die auf einen Augenblick aus der Waldung hervortraten, den Schwarze und seinen Gefährten.
Die Mienen beider waren ernst, ja fast feierlich. Die des Schwarzen schien sogar ein geheimer Schauder beigemischt zu sein.
»Hol’ der Teufel diese Narren, die zu fliehen scheinen, sobald ich mich nähere!«, rief der Offizier.
Auf einen Wink seines Gefährten legte der Schwarze auf die Plattform eines in das Bett des Flusses gerollten Felsen einen Vorrat trockener Zweige, die er am Ufer ausgesucht hatte, und schickte sich an, ein Feuer anzuzünden.
Bald färbte ein heller Schein das Wasser, welches den Felsen umfloss, purpurrot. Selbst der weiße Schaum des Wassers, alles erhielt von den Reflexen eine rötliche Färbung.
Während der Schwarze unbeweglich in den Glanz der glühenden Kräuter starrte, die sich im Wasser abspiegelten, nahm der Indianer seinen Binsenhut ab, löste seine Haarflechten und warf eine Art Mantel, der Brust und Schultern bedeckte, von sich. Seine Haarlocken, schwarz wie das Gefieder des Raben, dessen hohes Alter er zu erreichen behauptete, umflatterten seinen muskulösen und bronzenen Körper, teilweise noch sein Gesicht verschleiernd.
Der Offizier bemerkte jetzt zum ersten Mal, dass der Indianer in ein Horn stieß, dessen raue und Stakkato hervorgebrachten Töne mit denen, die der Jaguar, wenn ihn Hunger oder Durst quält, hören lässt, Ähnlichkeit hatten.
Als Costal nun glaubte, den Geist des Gewässers genugsam erweckt zu haben, der seine Antwort den Stimmen des Echos, das diese traurige und lärmende Harmonie wiedergab, übertragen zu haben schien, hing er seine Seemuschel über den Rücken und begann nun um den Felsen herum, auf dem das Gestrüpp noch fortglühte, im Flussbett einen wilden, seltsamen Tanz.
In dem Maß, wie die Dunkelheit zunahm, wurde auch die Szene wilder.
Der Indianer fing an, sich immer unsinniger zu gebärden, während der Schwarze unbeweglich wie eine Statue blieb. Der Glanz der Feuerstätte warf auf beide sonderbare Farben zurück. Der Wasserfall schien feurige Wolken zu treiben. Es war eine archaische und imposante Szene zugleich.
»Beim Leben Gottes!«, murmelte der Offizier, »ich wäre wohl begierig, zu wissen, welcher heidnischen Gottheit zu Ehren diese beiden Wilden sich solchen Torheiten hingeben. Aber ich habe ein noch lebhafteres Verlangen, sie zu ersuchen, mich auf den richtigen Weg zurückzuführen.«
Um seine Stimme, die der Lärm des Wasserfalls nun übertönte, zu unterstützen, ergriff Don Rafael eine Hand voll kleiner Steine und schleuderte sie in die Richtung der beiden Gefährten. Dieses Mittel tat ohne Zweifel seine Wirkung, denn der Indianer warf plötzlich mit einem Schlag das brennende Kraut von der Feuerstätte, das sogleich im Wasser erlosch. Alles wurde dunkel, der Schwarze und der Indianer verschwanden in der Finsternis.




