Der Schwur – Erster Teil – Kapitel 1
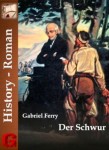 Der Schwur
Der Schwur
Historischer Roman aus dem mexikanischen Unabhängigkeitskrieg
Erster Teil
Der Dragoner der Königin
Kapitel 1
Die Wunder der Savanne
Die revolutionären Ideen, die Frankreich im Jahr 1789 über ganz Europa verbreitet hatte, drangen auch über das Meer und fanden ihren Nachhall im ganzen spanischen Amerika, wenn diese Kolonien nicht schon bei dem früher gegebenen Befreiungsbeispiel der nordamerikanischen Freistaaten den Impuls geliefert und daran gedacht hatten, auch ihrerseits ihre Unabhängigkeit vom Mutterland auszusprechen.
In der Tat hatte auch schon zu Anfang dieses Jahrhunderts das ganze südliche Amerika das Joch des Madrider Hofes abgeworfen, der in diesem Teil der Neuen Welt, wenigstens nicht ohne Kampf, weiter nichts mehr besaß als Mittelamerika und damit auch Mexiko.
Um allen Versuchen zu einem Aufstand vorzubeugen, hatte der Vizekönig von Neuspanien, Don José Iturrigaray, es klugerweise für nötig erachtet, den Mexikanern umfassende politische Konzessionen zu machen und die mexikanischen Kreolen an den Rechten teilnehmen zu lassen, die ihnen bis jetzt vorenthalten worden waren.
Unglücklicherweise hatten die in Mexiko angesiedelten Spanier diese Zugeständnisse als den Untergang ihrer alten Privilegien betrachtet und sich gegen den Vizekönig aufgelehnt, sich seiner Person bemächtigt und ihn nach Spanien geschickt, um dort seine Handlungsweise zu verteidigen. Alle durch ihn bewilligten Freiheiten wurden aufgehoben und Mexiko in die alte Ordnung der Dinge zurückversetzt.
Diese Ereignisse hatten im Jahr 1808 stattgefunden, und obgleich es von einem Tag zum anderen zu erwarten stand, dass die Kolonien den Versuch machen würden, ihre Rechte, um die man sie gebracht hatte, wieder zu erobern, so waren doch zwei Jahre einer scheinbaren Ruhe die Gemüter so vollständig eingeschlafen, dass die Verschwörung Hidalgos und der Aufstand, den er im September 1810 hervorrief, sie in eine vollständige Betäubung versetzte.
Seit ungefähr dreihundert Jahren hatten die Priester Mexiko beherrscht, und Priester waren es auch, die nach einer gerechten Ausgleichung aller irdischen Dinge nun Mexiko vom spanischen Joch befreien sollte. Im Anfang des darauf folgenden Oktobers hatte der Pfarrer Hidalgo schon nahe an hunderttausend Kämpfer um sich versammelt, die zwar schlecht bewaffnet, aber immer furchtbar genug in ihrer Anzahl waren.
Diese Aufständler, die sich überall wie ein reißender Strom verbreiteten und sich immer noch zu vermehren drohten, brachten den Regierungssitz in Mexiko in Bestürzung und verwirrte die Meinung der Kreolen selbst.
Die eingeborenen Spanier hatten sich in zwei Lager geteilt. Die einen glaubten sich in Rücksicht auf die Blutsbande, den Aufstand zu bekämpfen. Die anderen, nur an die Befreiung des Landes, in welchem sie geboren waren, hielten es für ihre Pflicht, mit Rat und Tat für dieses einzustehen. Dieser Meinungsverschiedenheit begegnete man in allen Ständen, und weder mächtige und reiche Kreolen noch Weiße, Mestizen oder Indianer nahmen Anstand, sich unter die Fahnen Hidalgos zu scharen.
Namentlich hofften die Indianer, die noch mehr geknechtet als die Kreolen waren, dass sich eine neue Ära für sie öffnen würde. Einige erträumten schon die Rückkehr ihres alten Glanzes.
So ungefähr war die politische und moralische Lage Neu-Spaniens in dem Zeitraum, mit dem wir unsere Erzählung beginnen, im Anfang des Oktobers 1810.
***
Eines Morgens gegen 9 Uhr, die Tageshitze folgte überraschend schnell der Nachtkühle, ritt ein einsamer Reisender über die endlose Ebene, die sich zwischen den Grenzen der Städten Vera Cruz und Oajaca ausdehnt.
Unser Reisender war für ein Land, das vom Bürgerkrieg zerfleischt wird, und welches Landstreicher von Gewerbe, die immer bereit sind, den Vorüberziehenden ohne Ansehen der Partei auszuplündern, ziemlich dürftig bewaffnet und noch schlechter beritten.
Ein gekrümmter Säbel in einer so rostigen eisernen Scheide, als ob sie lange Zeit aus dem Boden irgendeines Flusses gelegen hätte, war zwischen Bein und Sattel hindurch gesteckt, um auf diese Weise dem Ungemach zu entgehen, welches das Gewicht einer so gewaltigen Waffe den Hüften des Reiters hätte verursachen können. Dieser Säbel war das einzige Verteidigungsmittel, dessen er sich bedienen zu können schien, vorausgesetzt, dass der Rost noch das Ziehen der Klinge zuließ.
Das Pferd, auf dem unser Reisender, der Sporenstöße ungeachtet, mit denen er nicht geizig war, nur mühsam weiterkam, hatte ohne Zweifel, wie man aus den zahlreichen Narben, womit Weichen und Brust bedeckt waren, schließen konnte, irgendeinem berittenen Stierkämpfer gehört. Jedenfalls war es ein ausrangiertes, mageres und doch stabiles Tier, und wer es für fünf Piaster kaufte, hätte den doppelten Preis seines Wertes bezahlt.
Der Reiter trug eine Jacke aus einem weißlichen Stoff, Beinkleider aus olivenfarbenem, baumwollenen Samt und Halbstiefel aus Ziegenfell. Er war klein, mager und armselig gekleidet, höchstens zweiundzwanzig Jahre alt. Sein Hut aus Palmblättern beschattete mit seiner breiten Krempe ein sanftes einnehmendes Gesicht von vielleicht zu großer Naivität, wenn zwei lebhafte und geistreiche Augen, die in tiefen Augenhöhlen glänzten, nicht jenen Ausdruck wieder paralysiert hätten. Ein feiner, manchmal spöttisch verzogener Mund zeigte in vollständiger Übereinstimmung mit der Lebhaftigkeit des Blickes an, dass der junge Reisende mit einer satirischen Gabe eine große Feinheit der Beobachtung verband.
Obgleich er sein Pferd auf die möglichst eindringliche Weise anspornte, war das Tier doch nur höchstens auf Minuten, in denen es einen kurzen Trab annahm, aus seinem Gang zu bringen.
Die Anstrengungen des Reiters dienten nur dazu, seine Stirn mit Schweiß zu überdecken, den er jeden Augenblick mit seinem Taschentuch zu trocknen gezwungen war.
»Verdammte Mähre!«, rief er einige Male voller Wut.
Das Tier blieb ebenso bei den Flüchen seines Herrn, wie bei dessen eindringlichen Bitten mit den Sporen unempfindlich. Nun verglich dieser traurig den Raum, welchen er hinter sich hatte, mit dem, welchen er in diesen trostlosen Savannen noch zu durchreiten hatte. Dann überließ er sich mit einer Art Verzweiflung dem friedlichen Gang seines Pferdes.
So ritt der junge Herr noch eine Zeitlang in diesem Zustand wechselweiser Erbitterung und Geistesbeklemmung bis zu dem Augenblick, wo die fast scheitelrecht über ihm stehende Sonne die Mittagsstunde anzeigte. Die Hitze wuchs in dem Maß, wie die Sonne stieg, und um das Maß des Unglücks vollzumachen, legte sich auch der gelinde Wind, der bisher den Staub verstreut hatte. Die ausgedorrten Stängel der Gräser blieben in einer vollkommenen Unbeweglichkeit, und der erschöpfte Gaul drohte stehen zu bleiben, wie sie.
Von glühendem Durst gequält, von Müdigkeit erschöpft, stieg der Reiter ab und begab sich, nachdem er seinem Pferd, das unfähig war, das Vertrauen seines Herrn durch die Flucht zu missbrauchen, den Zaum über den Hals geworfen hatte, zu einem Nopalgehölz in der Hoffnung, dort einige Früchte zu finden, um seinen Durst zu löschen.
Seine Hoffnung wurde nicht getäuscht. Nachdem er ein Dutzend wilder Feigen gepflückt und von ihrer stachligen Umhüllung befreit hatte, stieg er wieder zu Pferd und setzte seinen Weg fort.
Es war fast drei Uhr, als der Reisende endlich ein kleines, am Saum der ungeheuren Ebene, die er soeben durchritten hatte, liegendes Dorf erreichte. Aber auch hier waren die Hütten, wie alle übrigen, bei denen er in diesen Tagen vorübergekommen war, leer und verlassen. Er durfte seinen Weg fortsetzen, ohne sich das Motiv dieser allgemeinen Flucht erklären zu können.
Wunderbar! Weit entfernt von jedem Fluss oder jedem anderen Gewässer fand er von Zeit zu Zeit zu seinem größten Erstaunen Boote und Kähne auf die Wipfel der Bäume hinaufgezogen oder an den stärksten Ästen derselben aufgehängt.
Endlich störte zu seiner großen Freude das Getrappel von Pferdehufen das traurige Schweigen dieser Einöden. Der ausgedörrte Boden dröhnte hinter ihm, das war ein Zeichen, dass ein durch die Biegung eines Pfades noch unsichtbarer Reisender ihn in Kürze erreichen musste.
Nach Verlauf einiger Minuten zeigte sich in der Tat ein Reiter, der ihn bald darauf einholte.
»Santos dias!«, sagte der Ankömmling, die Hand an seinen Hut legend.
»Santos dias!«, erwiderte der Zweite höflich, seinerseits den Hut lüftend.
Das Zusammentreffen zweier Reisender mitten in einer Einöde ist immer ein Ereignis, und beide betrachteten sich mit stummer Neugier.
Der zuletzt angekommene Reiter war ein junger Mann, der etwa fünfundzwanzig Jahre alt zu sein schien. Diese Gleichheit des Alters war auch das Einzige, was die Reisenden gemeinsam hatten. Die Figur des zuletzt Gekommenen war groß und stark, aber dennoch elegant. Seine regelmäßigen und stark markierten Züge, das Feuer seiner schwarzen Augen, sein dichter Schnurrbart und sein dunkelbrauner Teint zeigten heftige Leidenschaften an und trugen das energische Gepräge des arabischen Blutes, aus dem so viele spanische Familien entsprossen sind.
Er ritt ein dunkelbraunes Pferd, dessen feine und doch kräftige Formen dieselbe orientalische Abkunft verrieten, wie die seines Herrn. Dieser handhabte es mit vollkommener Leichtigkeit und schien unerschütterlich im Sattel zu sitzen, an dessen Knopf eine Muskete hing. Ein zweischneidiger Degen in einer Lederscheide war mittelst eines Hakens an seinem Gürtel befestigt.
Gewaltige spanische Stiefel mit ungeheuren Sporen und weite Beinkleider aus violettem Samt bedeckten Füße und Beine. Ein Battistkamisol und ein mit Goldtressen verzierter Hut vervollständigten das halb bürgerliche, halb militärische Kostüm.
»Habt Ihr einen weiten Ritt auf diesem Pferd zu machen?«, fragte er, einen Seitenblick auf die erbärmliche Mähre des Reisenden werfend, den er erreicht hatte, und die Hitze des seinen zügelnd.
»Gott sei Dank, nein!«, erwiderte dieser, »denn, wenn ich mich nicht täusche, kann ich nur noch höchstens sechs Stunden von der Hazienda San Salvador entfernt sein. Das ist das Ziel meiner Reise.«
»Liegt sie nicht in der Nachbarschaft der von Las Palmas?«
»Sie ist kaum zwei Stunden davon entfernt.«
»Dann haben wir denselben Weg«, erwiderte der Neuangekommene, »nur fürchte ich, dass wir demselben nur in Zwischenräumen folgen können, denn Euer Pferd scheint keine große Eile zu haben«, fügte er lachend hinzu.
»Das ist wahr«, entgegnete der junge Mann gleichfalls lachend, »und ich habe während der Reise mehr als einmal die Sparsamkeit verwünscht, mit der mein Herr Vater es für gut gehalten hat, mich mit einem Pferd zu versehen, das den Hörnern der Stiere im Zirkus zu Valladolid entgangen ist, weshalb auch das arme Tier nicht einmal eine Kuh am Horizont auftauchen sehen kann, ohne die Flucht zu ergreifen.«
»Ihr kommt von Valladolid auf dieser abscheulichen Mähre?«
»Geradewegs, Señor, bin aber schon zwei Monate unterwegs.«
In diesem Augenblick schien das Pferd des jungen Reisenden, durch die Gegenwart eines Gefährten angefeuert, ehrgeizig zu werden und machte eine Anstrengung, die unterstützt durch die Gefälligkeit des Kavaliers mit dem schwarzen Schnurrbart, ihm gestattete, mit demselben Schritt zu halten. Die beiden Reisenden hatten somit das Vergnügen, ihre begonnene Unterhaltung fortsetzen zu können.
»Vertrauen fordert Vertrauen«, nahm der Neuangekommene das Wort wieder auf. »Ihr habt mir gesagt, dass Ihr von Valladolid kommt. Ich meinerseits komme aus Mexiko, und mein Name ist Don Rafael Tres-Villas, Hauptmann bei den Dragonern der Königin.«
»Und der meine ist Cornelio Lantejas, Student der Universität zu Valladolid.«
»Nun, Señor Studiosus, könnt Ihr mir die Lösung eines Rätsels geben, um die ich niemand habe fragen können, da ich seit zwei Tagen in diesem verwünschten Land keiner lebenden Seele begegnet bin. Wie erklärt Ihr diese vollständige Einöde, diese Dörfer ohne Einwohner und diese an den Zweigen der Bäume aufgehängten Boote in einer Gegend, in der man zehn Stunden weit reiten kann, ohne einen Tropfen Wasser zu finden?«
»Ich befinde mich in derselben Unkenntnis, Señor Don Rafael, und begnüge mich, entsetzliche Furcht vor dieser unerklärbaren Sonderbarkeit zu haben«, erwiderte ernst der Student.
»Furcht«, schrie der Dragoner, »und wovor?«
»Ich habe die üble Angewohnheit, vor Gefahren, die ich nicht kenne, fast mehr erschreckt zu sein, als vor solchen, die ich kenne. Ich fürchte, dass die Revolution sich auch dieser Provinz bemächtigt hat, obwohl man es mir versicherte, dass sie in tiefster Ruhe sei und das die erschreckten Einwohner ihre Wohnungen verlassen hätten, um irgendeiner Aufstandspartei zu entgehen, die im Land herumstreifen.«
»Arme Teufel sind nicht gewohnt, vor Marodeuren zu fliehen«, erwiderte der Hauptmann, »dann haben auch die Landleute diejenigen gar nicht zu fürchten, die dem Banner der Revolution folgen. So viel aber ist gewiss, dass diese Kähne und Boote nicht an den Zweigen befestigt sind, um mitten in dieser Sandebene herumzuschiffen. Es muss daher eine andere Ursache zu diesem allgemeinen panischen Schrecken vorliegen, den ein unsauberer Geist in dieses Land gebracht zu haben scheint. Ich gestehe nochmals, dass mir das ganz unbegreiflich ist.«
Die beiden Reisenden setzten für einen Augenblick ihre Reise schweigend fort, mit dem sonderbaren Geheimnis fortwährend beschäftigt, welches sie zu umgeben schien und wofür sich in ihrem Geist keine Lösung bot.
Der Dragoner nahm wieder zuerst das Wort auf.
»Señor Don Cornelio, da Ihr doch von Valladolid kommt, könntet Ihr mir einige neuere Nachrichten, als die meinen sind, über den Marsch und die Fortschritte Hidalgos und seiner Armee geben?«
»Keine«, erwiderte Lantejas. »Ihr vergesst, dass ich, dank der Langsamkeit meines Pferdes, schon seit zwei Monaten unterwegs bin. Bei meiner Abreise von Valladolid dachte man an keine Revolution mehr, als an die Sintflut und ich weiß weiter nichts davon, als ich aus dem öffentlichen Gerede erfuhr. Dies ist so wenig, dass man es ohne Furcht vor der sehr heiligen Inquisition unter die Leute bringen darf.
Kann man den Anweisungen des Herrn Erzbischofs von Oajaca Glauben schenken, so soll der Aufstand nicht viele Anhänger finden.«
»Und warum das?«, fragte der Dragoner mit einem Anflug von Hochmut, welcher bewies, dass die Sache der Befreiung des Landes in seiner Person keinen Feind finden sollte, ohne dass er seine politische Meinung ausgesprochen hatte.
»Warum das?«, wiederholte der Student unbefangen. »Weil der ehrwürdige Señor Bergosa y Jordan sie exkommuniziert und behauptet, dass binnen Kurzem jeder Aufständler an den Hörnern und den gespaltenen Klauen erkennbar sein würde, die ihm ohne Zweifel wachsen müssten.«
Weit davon entfernt, über die einfältige Leichtgläubigkeit des jungen Mannes zu lachen, senkte der Hauptmann mit unzufriedener Miene das Haupt.
»Ja«, sagte er, wie mit sich selbst redend, »das ist die Art und Weise, wie unsere Priester zu kämpfen verstehen, durch Verleumdung und Lüge und dadurch, dass sie die Gemüter der Kreolen durch Fanatismus und Aberglauben umstricken.«
Dann fügte er laut hinzu: »Ihr werdet Euch also hüten, Señor Lantejas, Euch in die Scharen der Revoluzzer einreihen zu lassen, damit Euch nicht auch der teuflische Schmuck wachse?«
»Davor bewahre mich Gott!«, rief der Student. »Übrigens bin ich auch viel zu friedlicher Natur und bereite mich vor, in einen heiligen Orden zu treten. Die Kirche verabscheut Blutvergießen.«
»Ihr geht nach Oajaca, um Euer Studium zu vollenden?«, fragte der Dragoner.
»Das eben nicht«, erwiderte Lantejas. »Wenn ich überhaupt die Hazienda von San Salvador besuche, erfülle ich damit nur einen Teil des väterlichen Willens. Dieses reiche Gut gehört meinem Oheim, einem Bruder meines Herrn Vaters, der mich zu ihm schickt, um ihm wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass er Witwer, reich und ohne Kinder ist, im Ersatz dafür aber ein halbes Dutzend Neffen zu versorgen hat. Was soll ich dazu tun? Mein verehrter Herr Papa hat die Schwäche, mehr an den Gütern dieser Welt zu hängen, als vielleicht gut ist. Übrigens wird sich wohl nie ein hungrigerer Neffe seinem Onkel vorgestellt haben, denn dank dieser unerklärlichen Verödung der Dörfer, durch welche ich gekommen bin, und der Mühe, die sich die Einwohner genommen haben, alles, selbst bis auf das armseligste Hühnchen mitzunehmen, gibt es in diesen Gegenden wenige Schakale, welche nüchterner sind, als ich.«
Der Dragoner befand sich in derselben Lage wie der Student. Auch er hatte seit zwei Tagen sich nur von den wilden Früchten dieser verlassenen Ebene nähren können, während sein Pferd sich wenigstens an den spärlichen Gräsern, den jungen Maistrieben oder, wenn auch diese mangelten, an Baumblättern schadlos hielt.
Im Verlauf des weiteren Gesprächs erfuhr der Student noch von dem Dragoner, dass seit der Gefangennahme des Vizekönigs Iturrigaray sein Vater, ein spanischer Edelmann, sich auf sein Landgut del Valle zurückgezogen habe. Der Hauptmann verschwieg hartnäckig den eigentlichen Zweck seiner Reise.
Unterdessen hatte sich das momentane Feuer des Pferdes Don Cornelios nach und nach gelegt, und durch die Sorge, welche der Student darauf verwenden musste, mit Peitsche und Sporen es wieder zu ermuntern, schlief die Unterhaltung ein, mit deren Hilfe man die Langweiligkeit der Reise gemildert hatte.
Der Durst, bekanntlich ein quälenderes Gefühl als der Hunger, verdoppelte die Unbehaglichkeit der beiden Reisenden. Von Zeit zu Zeit warf der Dragoner einen Blick der Ungeduld auf das Pferd des Studenten, bemerkte aber auch jedes Mal, dass das arme Tier, durch den Mangel an Wasser erschöpft, immer weniger imstande war, mit dem seinen Schritt zu halten.
»Señor Studiosus«, sagte endlich der Hauptmann, »habt Ihr manchmal in den Erzählungen von Schiffbrüchigen gelesen, dass die armen Teufel, vom Hunger gequält, unter sich das Los geworfen haben, um zu entscheiden, wer der sei, den die Übrigen verspeisen sollten?«
»O ja!«, erwiderte Lantejas mit einem gewissen Schauder. »Aber ich glaube nicht, dass wir schon bis zu diesem schrecklichen Extrem gekommen sind.«
»Caramba!«, antwortete Tres-Villas sehr ernst. »Ich fühle mich so hungrig, dass ich einen nahen, sehr reichen Verwandten verspeisen könnte, überhaupt wenn ich ihn beerbte, wie Ihr Euren Oheim in der Hazienda San Salvador.«
»Wir befinden uns aber nicht auf dem Meer, Señor Capitano, und auch in keinem Kanu, aus dem wir nicht heraus könnten.«
Der Hauptmann hatte geglaubt, sich einen Augenblick auf Kosten des jungen, ziemlich leichtgläubigen Mannes, der sogar den vom Erzbischof Bergosa y Jordan in einem allgemein bekannt gemachten Hirtenbrief ausgesprochenen Drohungen Glauben beimaß, belustigen zu können. Aber er war weit davon entfernt, zu erwarten, dass sein Reisegefährte einen Scherz, dessen einziger Endzweck der war, ihm die gebieterische Notwendigkeit einer gegenseitigen Trennung selbst im Interesse desjenigen, der zurückblieb, vorzuführen, so ernst auffassen würde. Die Absicht des Dragoners war in der Tat, vorauszureiten und dem Studenten von der nächsten Hazienda aus ein besseres Pferd, einigen Mundvorrat und Wasser zu schicken.
Don Cornelio warf einen ängstlichen Blick um sich und rief beim Anblick der ungeheuren Einöde, welche ihn umgab, und beim Vergleich des Missverhältnisses seiner Kräfte und der des kräftigen Hauptmanns, ohne dabei ein nervöses Zittern verheimlichen zu können.
»Ich hoffe, Señor Capitano, dass Ihr noch nicht auf diesen Punkt der Verderbtheit gelangt seid. Was mich betrifft, ich würde, wenn ich so gut beritten wäre, wie Ihr, meinem Pferd die Sporen geben und, ohne mich weiter auszuhalten, zur Hazienda Las Palmas oder San Salvador sprengen und von dort aus meinem Reisegefährten, den ich hinter mir ließ, Hilfe schicken.«
»Ist das Eure Ansicht?«
»Ich würde es so machen.«
»Nun«, sagte der Dragoner, »ich werde Euren Rat befolgen, denn im vollen Ernst, ich machte mir Vorwürfe, so bald Eure Gesellschaft wieder aufzugeben.«
Don Rafael reichte dem jungen Studenten seine Hand.
»Señor Lantejas«, fuhr er fort, »wir scheiden als Freunde, möchten wir uns nie als Feinde begegnen! Wer kann den Schleier der Zukunft lüften? Ihr scheint geneigt, die Gleichstellungsversuche eines seit dreihundert Jahren geknechteten Landes mit scheelen Blicken zu betrachten. Ich werde ihm aber vielleicht einst meine Kräfte und, wenn es sein muss, mein Leben widmen, um ihm seine Freiheit wieder erobern zu helfen. Lebt wohl! Ich werde nicht vergessen, Euch Hilfe zu schicken.«
Bei diesen Worten drückte der Offizier die zerbrechlichen Finger des Studenten der Theologie mit aller Kraft, gab dann seinem Pferd einen leichten Schlag mit der Hand und verschwand, ohne nötig zu haben, ihm auch die Sporen zu geben, mit Blitzesschnelle in einer gewaltigen Staubwolke.
»Schütz mich Gott!«, sprach Lantejas zu sich mit einem Seufzer der Erleichterung. »Dieser hungrige Wüstenfuchs wäre fähig gewesen, mich zu verschlingen. Was aber das Gegenüberstehen auf dem Schlachtfeld betrifft, so fordere ich den Teufel und seine Hörner heraus, denn das müsste ein feiner Kopf sein, der mich zum Soldaten machte, sei es für oder gegen die Revolution.«
Rote Wolken färbten den Horizont schon im Westen, als der Reisende plötzlich in einer beträchtlichen Entfernung einen Indianer erblickte. Er versuchte nun in der Hoffnung, von ihm einige Lebensmittel erhalten zu können, oder wenigstens eine Belehrung über die Sonderbarkeiten, die er sich nicht hatte erklären können, sein Pferd kräftiger anzutreiben. Der Indianer trieb zwei schöne Milchkühe vor sich her.
»Holla, José!«, rief Don Cornelio aus Leibeskräften.
Bei dem Namen José, auf welchen ein Indianer immer antwortet, wie der Irländer auf den Namen Paddy, drehte sich der Indianer erstaunt um.
Unglücklicherweise, und der Fall war leicht vorauszusehen nach dem, was der Student vorher erzählte, setzte sich das Pferd die Kühe erblickend in Trab und schlug schnurstracks eine Richtung ein, die der entgegengesetzt war, wohin es getrieben wurde.
Dennoch hörte Don Cornelio nicht auf, den Indianer mit allen Kräften herbeizurufen. Dieser ergriff beim Anblick des Reiters, der ihm statt näher zu kommen, doch dabei immer mehr entfernte, gefolgt von seinen beiden Kühen die Flucht. Lantejas verlor sie bald aus den Augen und nun erst konnte er sein Pferd auf den rechten Weg zurückbringen.
Gegen Abend erreichte er endlich eine Gruppe von drei verlassenen Hütten. Von Hunger erschöpft, wie sein Pferd, beschloss der Reisende an diesem Ort haltzumachen, um dort die Hilfe zu erwarten, die der Offizier ihm zu schicken versprochen hatte.
Eine breite Hängematte schien für ihn etwa sieben bis acht Fuß über dem Boden zwischen zwei Tamarindenbäumen aufgehängt zu sein.
Da die Hitze noch erstickend war, ging Lantejas in keine der Hütten hinein, sondern stieg, nachdem er sein Pferd abgezäumt hatte, damit es nach Wohlgefallen weiden konnte, an einem der Tamarindenbäume in die Höhe kletternd, in seine Hängematte, wo er sich so gut wie möglich einrichtete.
Unter diesen Vorbereitungen war die Nacht hereingebrochen. Der Student lauschte mit knurrendem Magen gespannt auf irgendein Geräusch, das ihm die Ankunft der Hilfe, auf die er hoffte, anzeigen könnte.
Aber alles war still, denn die Natur schlummerte rings um ihn. Statt des Pferdegetrappels, welches er zu hören wünschte, vernahm sein aufmerksam lauschendes Ohr ein fernes Donnern, wie bei einem sich nähernden Gewitter. Mit diesem mischte sich anderes Geräusch, ähnlich dem rollenden Meer in einem Sturm.
Manchmal glaubte der Reisende auch, obgleich die Luft ruhig war, entfesselte Winde heulen und sich mit diesem seltsamen Konzert vereinigen zu hören. Von einem namenlosen Schrecken ergriffen, vernahm er das Pfeifen des Windes, diese düsteren Stimmen und diese Gewitterstürme.
Endlich siegte die Ermüdung über die Unruhe und er verfiel in einen tiefen Schlummer.




