Fritz Wildaus Abenteuer zu Wasser und zu Lande 20
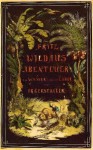 Friedrich Gerstäcker
Friedrich Gerstäcker
Fritz Wildaus Abenteuer zu Wasser und zu Lande
Kapitel 20
Die Malaien führen einen Kriegstanz auf und beenden ihn passend
Die Landung
Zwei der javanischen Malaien waren vortreffliche Tänzer und fesselten die Aufmerksamkeit ihrer neuen Gebieter bald der Art, dass sich diese in dichtem Kreis um sie herum drängten und durch laute Ausrufe ihren Beifall zu erkennen gaben.
Der eine von den meinen, ein junger Bursche von kaum mehr als sechzehn Jahren, hatte sich mit Hilfe seines Sarongs und Kopftuch als Mädchen verkleidet, der andere, ein baumstarker muskulöser Geselle, von den Tausend Inseln, der eigentlich den Steuermann an Bord ihrer Prahu gemacht und einen gewissen Rang bekleidete, unterstützte ihn mit solch wilder Grazie und Kraft darin, dass der Jubel der Zuschauer kein Ende nehmen wollte. Sein Name war Pulo-Pulo, ebenfalls nach seinem Geburtsland, dem malaiischen Wort Pulo, Insel, so genannt.
Der Kapitän der Prahu verlangte endlich einen ihrer leichten Kriegstänze zu sehen, die, in den friedlichen Beschäftigungen Javas mehr und mehr in Vergessenheit gerieten. Der letzte Tänzer, dem Wunsch gern entsprechend, wählte sich nun drei andere, die stärksten seiner Gefährten aus, ihr Vaterland, wie er sagte, in den Augen der Bewohner von Sumatra würdig zu vertreten.
Hierzu aber größeren Raum beanspruchend, bildeten sie einen Kreis, soweit es das Deck erlaubte, und trennten durch dieses Manöver ihre Gefangenenwärter vollkommen, die auch nur Augen für den eben beginnenden Tanz hatten.
Paarweise traten sich die Malaien einander gegenüber. Zuerst, zu den Tönen einer kleinen, wunderlich geformten Trommel, die dem Koch der Prahu gehörte, führten sie das Vorspiel auf, das mit einem freundlichen Tanz begann, in dem dann anscheinend ein Zank ausbrach und zu einem förmlichen Kampfspiel ausarten sollte. Der junge, als Mädchen verkleidete Malaie bildete dazu den Mittelpunkt der tanzenden Gruppe, einer Art Pantomimen, in dem sich die vier Tänzer als ebenso viele Liebhaber um sie bewarben, und endlich, während die wilde Schöne ihnen unter den Händen entschlüpfte, in wilder Eifersucht zwei gegen zwei den Kampf begannen.
Der Anfang wurde mit jener wohl kecken, aber doch natürlichen Grazie ausgeführt, die alle solche Nationaltänze, mögen ihre Bewegungen auch noch so wunderlich und anscheinend widernatürlich sein wie sie wollen, bezeichnet und charakteristisch macht. Die Tänzerin, jetzt als Bajadere gekleidet, mit blitzendem Goldschmuck in ihrem Haar, (ein Beutestück wahrscheinlich irgendeines glücklich ausgeführten Raubzuges, den ihm der Kapitän geborgt hatte) tanzte inmitten der vier Männer, bald mit diesem, bald mit jenem. Als sie den einen zu begünstigen schien, fuhren die anderen in drohenden Gebärden auf, als ob sie sich über ihn werfen wollten. Nie aber ließ es die verkleidete Maid dazu kommen, so rasch wechselte sie die flüchtig Begünstigten. Die Zuschauer jubelten in dem meisterhaft ausgeführten Übergang von Eifersucht zu Triumph und von Triumph zur getäuschten Hoffnung der Tanzenden.
Der Mond ging dabei auf und warf sein mildes Licht über die bunte, malerisch gruppierte Gruppe. Oben auf dem leichten Bambusdach der Hütte, die Strohzigarre im Mund, lag der Kapitän des kleinen Fahrzeugs, dem grad unter ihm wogenden Tanz zuschauend. Dicht vor ihm, dass er eben über ihre Köpfe wegsehen konnte, standen sechs oder sieben seiner Leute, während die übrigen, vielleicht zwölf oder sechzehn an der Zahl, den Ring der Tanzenden nach vorn zu einschlossen.
Fritz mit dem Letzten seiner Kameraden, befand sich unter den Zuschauern und nur der Steuernde war von dem Genuss des Schauspiels ausgeschlossen. Ihr Kurs lag wieder nach Nord zu Ost gerade am Land hinauf und so nahe zu demselben, als sie es, eines möglicherweise wieder einsetzenden Wetters wegen, wagen durften.
Nichtsdestoweniger konnten sie, selbst bei dem Mondlicht, die dunkle Küste in Lee deutlich erkennen, die sich wie ein langer dunkler Damm westlich von ihnen hinzog.
Der Tanz wurde wilder und lebendiger, Pulo-Pulo rief einem der Sumatra-Leute zu, ihnen jetzt zwei Handspeichen und zwei Lanzen zu geben, die verschiedenen Parteien vorzustellen. Fast alle beeilten sich, ihm zu willfahren. Wenige Minuten später standen sich die vier Malaien zum Kriegstanz gegenüber, den sie mit geschwungenen Waffen bald rechts, bald links hinüber neigend, als ob sie dem Feind eine Blässe abzugewinnen suchten, begannen. Noch stand das verkleidete Mädchen in ihrer Mitte und schien ängstlich, unter dem Beifallsruf der Umstehenden, den drohenden Waffen beider Teile auszuweichen. Immer wilder drängten sich die Paare, immer lebendiger, immer heftiger wurden ihre Gebärden, als Pulo-Pulo dicht an ihm vorüber strich und einige Worte in sein Ohr flüsterte.
Wie unter den Händen glitt sie ihm fort und zwischen die Zuschauer hinein, die ihr lachend Raum gaben. In demselben Moment aber riss der junge Bursche, sich plötzlich hoch empor richtend, einem der ihm nächst Stehenden den Kris aus dem Gürtel und stieß ihn dem laut Aufschreienden in die Seite, während der Kapitän selber durch einen Schlag Pulo-Pulos mit einer Handspeiche auf die Stirn getroffen, leblos zusammenbrach und den Kopf vorn über Deck herunterhängen ließ.
Der Augenblick war für die bisherigen Eigentümer der Prahu verderblich. Ehe sie nur recht begriffen, um was es sich hier handle und wie aus dem Spiel ihrer Sklaven so plötzlicher und furchtbarer Ernst geworden, schmetterten die schweren Handspeichen Pulo-Pulos und seines Gefährten auf ihre Schädel nieder und tranken die selbst gelieferten Lanzen ihr warmes Herzblut. Drei entkamen glücklich auf das Hinterdeck, wo sich ihnen der Steuermann anschloss, ein anderer Teil suchte sich nach vorn zu retten. Dort warf sich ihnen aber Tji-kandi und Xuning, die ebenfalls ein paar Lanzen gefunden hatten, entgegen und zerstreuten die von dem Angriff förmlich Betäubten, die gar nicht mehr zu wissen schienen, wie wenig Feinde ihnen eigentlich gegenüberstanden.
Fritz selber hatte tätigen Anteil an dem Kampf genommen, denn einem der zuerst Gefallenen den Kris entreißend, warf er sich keck gegen einen riesigen Sumatra-Krieger an, der eben einen sicher tödlich gewesenen Stoß nach Pulo-Pulo führen wollte. Seine Waffe fuhr ihm unter dem gehobenen Arm in die Brust und der Mann sank tot zu Boden. Dann aber, wohl wissend, wie nötig es sei, sich den Besitz der Kajüte, wo der ganze Waffenvorrat lag, zu sichern, sprang er die leichte Bambusleiter nieder und kam eben, in Zeit den Feind abzuhalten, durch die hinten angebrachten Fenster oder Luken von außen einzusteigen. Die drei Flüchtigen nämlich, denen sich der Steuernde anschloss, sahen kaum, wie die Sache an Deck stand, als ihr nächster Gedanke natürlich war, die Kajüte zu gewinnen und dort, mit den Feuerwaffen in ihrer Gewalt, den Sieg bald auf ihre Seite zu lenken, denn bis jetzt war noch nicht ein einziger Schuss gefallen. Kaum gewahrte aber Fritz, wie der Körper des Ersten die rechte Luke verdunkelte, als er eine der an die Wand angestellten Lanzen ergriff und den Gegner damit durchstieß. Ein Sturz ins Wasser kündete ihm gleich darauf seinen Sieg an. Aber nicht lange Zeit blieb ihm, sich dessen zu freuen, denn in demselben Moment warf sich ein anderer Sumatrane in die linke Luke und suchte dort den Eingang, wenn gleich vergeblich, gegen die wieder mit tödlicher Sicherheit geführte Lanze zu gewinnen, während eine andere dunkle Gestalt durch die rechte Luke sprang und dem jungen Mann jedenfalls verderblich geworden wäre, hätten nicht Tji-kandi und Xuning ebenso gut um die Wichtigkeit dieses Platzes gewusst, und den Ort gerade zu rechter Zeit erreicht, den jungen Europäer vor dem wütenden Sumatranen zu schützen und diesen unschädlich zu machen. Von den Lanzenstichen der beiden durchbohrt, wurden die letzten zwei Feinde zurückgeworfen. Die dort befestigten Gewehre von der Wand reißend, sprangen die drei wieder zurück an Deck, den jetzt dort tobenden Kampf zu entscheiden.
Sie waren kaum mehr nötig – die Überraschung schien so vollkommen gewesen zu sein, dass die Sumatraner, gleich mit dem ersten Schlag ihres Führers beraubt, schon gar nicht mehr an den Sieg, sondern nur noch daran dachten, ihr eigenes Leben zu retten.
Nur noch zwei von der Mannschaft hatten sich oben in den kleinen Mast oder die Stütze geflüchtet, an der das breite Mattensegel aufgehisst wurde, und verteidigten sich hier in Verzweiflung mit ihren Kris gegen die Feinde, die sie mit den Lanzen aus ihrer Höhe herunterzustoßen suchten.
Tji-kandi und Xuning liefen rasch mit ihren Gewehren auf sie zu. Fritz merkte aber kaum, was sie beabsichtigten, als er sich ihnen in den Weg warf und sie bat, das Leben der beiden Unglücklichen zu schonen.
»Lasst sie leben!«, rief er und drückte die Läufe der Waffen runter, die sie schon toddrohend auf ihre Opfer richteten, »sie können uns ja nichts mehr schaden.«
»Aber uns verraten!«, schrie der riesige Pulo-Pulo, der von Blut und Schweiß bedeckt in grimmiger Wut hinzu sprang und den jungen Mann beiseite warf.
»Nieder mit ihnen«, donnerte er zugleich den beiden Gewehrträgern zu. Die dritte Schusswaffe selber den Händen des Deutschen entreißend, krachten die drei Schüsse fast zu gleicher Zeit, von denen die Unglücklichen schwer getroffen aus ihrer Höhe niederstürzten und von den unten harrenden Malaien ohne Weiteres über Bord geworfen wurden.
Sie waren frei, wenn auch durch vieles, vieles Blut erkauft. So musste die Überraschung der sich vollkommen sicher fühlenden Sumatraner gewesen sein, dass von den Malaien nur zwei geblieben und drei leicht verwundet waren. Zu den Getöteten gehörte der junge Bursche, der die Rolle des Mädchens in dem Tanz übernommen und den ersten Stoß in das Herz eines Gegners geführt hatte. Er lag, mit einer breiten Wunde in der Brust und den Goldschmuck noch im Haar, an Deck. Die Freunde hatten sich um ihn geschart, um zu sehen, ob alles Leben in ihm entflohen sei, als plötzlich ein gewaltiger Stoß das ganze Fahrzeug bis in seinen Kiel hinab erschütterte und die Malaien jetzt, alles andere vergessend, ihre Aufmerksamkeit dem Fahrzeug selber zu lenkten.
Solange der Kampf währte, war dieses total vernachlässigt, mit nicht einmal einem Mann am Steuer, von der wieder frischer einsetzenden Brise mehr und mehr der in Lee liegenden Küste zugetrieben worden und nun auf irgendeine Korallen- oder Felsbank gestoßen, von der es übrigens nach wenigen Minuten heftigen Stampfens wieder frei und in tieferes Wasser kam. Die Malaien, so schwach sie sich an Mannschaft befanden, gingen nun ernstlich daran, ihr neugewonnenes Fahrzeug in guten Stand zu setzen und unter Segel zu bringen. Fritz trat ans Steuer und die übrigen brassten das große Mattensegel scharf an den Wind, von der Küste wegzukommen.
Sie wollten geradeaus in See halten, das Fahrwasser der zwischen Java und Singapur laufenden Schiffe zu erreichen, um nicht wieder in die Hände der Piraten zu fallen und vielleicht auch des Besitzes der Prahu halber noch zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Das schlanke Fahrzeug selber brachten sie auch bald über den andern Bug. Tji-kandi aber, dem das Auffahren nicht gefallen hatte, kletterte in den unteren Raum hinunter und fand dort bald seinen schlimmsten Verdacht bestätigt. Mehr als drei Fuß Wasser stand schon dort. Als er auch augenblicklich wieder nach oben sprang und die Mannschaft zum Ausschöpfen rief, sahen sie doch bald, dass sie nicht imstande sein würden, die stark beschädigte Prahu lange mehr über Wasser zu halten. Keineswegs durften sie es wagen, weiter damit in See hinaus zu gehen, wo das Auffinden eines Schiffes doch immer zu ungewiss blieb. Den Bug wieder dem Festland zukehrend, blieb jetzt nur noch ihre einzige Hoffnung dieses, zum zweiten Mal schiffbrüchig, zu erreichen, ehe die lecke Prahu unter ihnen sinken würde.
Der Wind war ihnen glücklicherweise günstig genug dazu. Vor einer scharfen Brise segelten sie die Küste rasch an. Trotz unausgesetztem Schöpfen wurde das Fahrzeug aber auch immer schwerfälliger und ging tiefer und tiefer im Wasser. Als sie endlich den dunklen Streifen Land so dicht vor sich sahen, dass sie die ausgezackten Umrisse des Waldes auf den nächsten Hängen schon erkennen konnten, war es zu ihrem Heil, dass der Bug der Prahu plötzlich scharf und voll auf eine Sandbank lief, breit vor dem Wind abschwenkte, dann nach Lee zu, überkippte und liegen blieb, während sowohl das leichte Material, aus dem ihr oberer Teil bestand, als auch die hier, wie es schien, ziemlich steil auflaufende Sandbarriere es verhinderten, dass sie vollständig sanken.
Ihre Entfernung zur Küste konnte nur unbedeutend sein. Vor Tag ließ sich aber dennoch nichts unternehmen. Sie brauchten auch nicht zu fürchten, dass sie wieder flott werden würden. Der Schiffsrumpf hatte sich nicht allein zu vollgesogen, sondern sie fanden auch bald, dass die Ebbe gegen Morgen eintrat, die sie ja noch mehr auf den festen Grund und Boden aufsetzen musste. Ihr Leben war ihnen also, was das Meer betraf, gesichert. Ihre einzige Sorge musste es jetzt sein, soviel wie möglich von den an Bord befindlichen Vorräten an Land zu retten, wo sie freilich nicht wussten, wie sie von den Bewohnern der Küste empfangen und aufgenommen werden würden.
So brach endlich langsam der Tag an, als sich die düsteren Nebelschleier, die besonders in der letzten Stunde vor Morgen auf dem Wasser gelegen hatten, allmählich lichteten. Es breitete sich nur wenige hundert Schritte von ihnen die dicht bewaldete, freundliche Küste aus und schien ihnen die Arme entgegen zu strecken, sie zu empfangen, denn gerade in eine kleine sandige Bucht waren sie eingetrieben, in der das Wasser nun so bedeutend fiel, dass sie mit Sonnenaufgang ans Ufer waten konnten.
Diese Zeit wurde denn auch rasch genug von ihnen benutzt. Nach kurzem Kriegsrat bewaffneten sich alle vollständig und traten, noch außerdem mit Mundvorrat beladen, so viel wie sie tragen konnten, den Weg zum Land an, dem sie sich jedoch noch immer vorsichtig näherten, da sie keineswegs wissen konnten, ob ihnen nicht irgendein Feind die Landung streitig machen werde, oder ein Hinterhalt ihr Leben bedrohte, sobald sie den Fuß auf festen Grund und Boden gesetzt hätten.
Dem schien aber nicht so zu sein. Kein Feind ließ sich sehen. Überhaupt war nirgends an der Küste selbst nur Rauch zu erkennen, da wahrscheinlich gerade an dieser Stelle die Versandung des Ufers die Eingeborenen abgehalten hatte, sich niederzulassen. Nicht angegriffen und belästigt betraten sie nach kurzem Marsch den Strand.
Dadurch kühn gemacht und als sie alles, was sie an das Ufer gebracht, in Sicherheit wussten, beschlossen sie noch einmal zu dem Wrack zurück zu kehren, eine zweite Ladung zu retten. Ihre Waffen versteckten sie in den Büschen und landeten so im Laufe des Vormittags fast alle Gewehre mit einer bedeutenden Menge an Munition und Reis, genug, um wenigstens einen Monat ihr Leben fristen zu können.
Die wieder eintretende Flut unterbrach erst ihre Arbeit, denn das Wasser wurde zu tief und an Bord befand sich kein Kanu, um damit die Verbindung zum Wrack zu unterhalten.
Was aber jetzt tun? Einen Stamm der Eingeborenen aufsuchen und sich ihm auf Gnade und Ungnade ergeben oder in bewaffnetem Zug die Küste hinauf oder hinab streifen, irgendeinen Hafenplatz zu erreichen und ein europäisches Schiff oder einen friedlichen arabischen Kauffahrer anzutreffen? Es blieb beides gleich gefahrvoll. Pulo-Pulo, der die Bewohner dieser Küste zu kennen schien, erklärte ihnen einfach, er wisse keinen besseren Rat als sich hier, gerade an dieser Stelle, die von den Eingeborenen nicht sehr besucht zu sein scheine, ein kleines festes Lager aufzubauen, das sie in kurzer Zeit herstellen könnten und dann daran zu gehen, ein kleines Boot oder Kanu auszuhauen, wozu sie ebenfalls keine Woche brauchen würden, da sie die Werkzeuge in der nächsten Ebbe noch von dem Wrack holen könnten. Dann aber blieb ihnen nichts anderes übrig, als so rasch wie möglich gerade in See hinaus zu halten, das Fahrwasser der europäischen Schiffe, von denen sie in diesem Monsun manche antreffen würden, zu erreichen oder wenigstens aus dem Bereich der Sumatraner zu kommen, von denen er sich bösen Empfang und noch schlimmere Behandlung zu versprechen schien.
Nach langem Hin- und Herdebattieren fand es sich endlich, dass Pulo-Pulos Rat allerdings der beste sei. Um die Zeit der Flut so gut wie möglich zu benutzen, gingen sie jetzt rasch daran, einen günstigen Platz für ihr Lager zu finden, in dessen Nähe aber auch ein paar passende Bäume stehen mussten, um ein Doppelkanu auszuarbeiten und ohne der Gefahr preisgegeben zu sein, bei ihrer Arbeit vielleicht von einem feindlichen Stamm überfallen und von ihrem Lager abgeschnitten zu werden.
Beides fanden sie übrigens gar nicht weit von dort entfernt an dem Ufer eines kleinen Bachs, der gerade da, wo sich das flache angeschwemmte Land an den nächsten schräg aufsteigenden Hügel anschloss, durch ein wildes Dickicht von herrlichen Fruchtbäumen und Palmen hervor rieselte. Hier standen auch mehrere für ihren Zweck geeignete Bäume, die sie fällen und selbst zu ihrem Lager benutzen konnten. Mit Ungeduld erwarteten sie jetzt die nächste Ebbe. Alles, was sie zu der Durchführung ihres Planes noch brauchten, herüber zu holen, dann ohne Weiteres ihre Arbeit zu beginnen.
Glücklicherweise blieb das Wetter ruhig und schon vor vollkommen niedrigem Wasserstand an Bord schwimmend, machten sie sich eifrig daran, ein kleines Floß aus dem oberen Teil des Bambuswerks zu bauen, auf das sie alles was sie noch mitnehmen wollten, zu gleicher Zeit schafften und es dann mit Leichtigkeit zum Ufer schieben konnten.
Hier entschied sich auch Fritz dafür, dass sie die kleine, vorn am Bug der Prahu befestigte Drehbasse mitführen sollten, die ihnen vielleicht noch gewaltig gute Dienste leisten könnte. Obgleich selbst Pulo-Pulo, der jetzt den Oberbefehl übernommen hatte, nicht recht Lust dazu zu haben schien, gab er es doch endlich zu und ließ sie mit der nötigen Munition auf das Floß schaffen, dem sie dann aber auch nicht das Geringste mehr aufladen konnten. Nichts desto weniger brachten sie dasselbe an Land und kehrten dann noch einmal an Bord zurück. Dabei war es aber schon so spät geworden, dass das Wasser wieder zu steigen begann, ehe sie nur das Wrack zum zweiten Male erreichten. Indessen konnten sie ihr kleines Floß ruhig beladen und es dann schwimmend zum Ufer treiben, was sie auch noch vor Abend ins Werk setzten.
Höchste Zeit war es gewesen, denn noch vor Mitternacht nahm der Wind wieder an Stärke zu. Über die See brauste es in wilder furchtbarer Gewalt, die aufgerüttelten Wogen stürmten heran in unwiderstehlicher Macht und schleuderten den spritzenden Schaum über den seichten Strand oft bis hoch in die Kronen der Kokospalmen hinein, dass die klare salzige Flut an den schlanken Stämmen hernieder rann.
Für die Schiffbrüchigen war es insofern ein Glück, als das Wrack draußen schon bei dem ersten Anprall des Wetters in Splitter zerschmetterte und diese in die Mangrove- und anderen Uferbüsche hinein gespült wurden. Ihre Entdeckung durch das Wrack war deshalb total unmöglich gemacht worden. Mit Waffen und Proviant in Sicherheit, begannen sie am anderen Morgen mit vereinten Kräften das Lager anzufangen und zu befestigen.
Zuerst fällten sie vor allen Dingen die beiden nur wenige Schritte voneinander entfernt stehenden Bäume, die sie zu ihren Kanus benutzen wollten und begannen dann um diese herum die Umzäunung des Lagers, wodurch sie die Stämme, an denen sie arbeiten mussten, in den inneren Raum der Einfriedigung bekamen. Dann lichteten sie den Wald soweit ihnen das möglich war, um nicht so leicht von irgendeinem feindlichen Angriff überrascht zu werden, und stellten aus den dadurch gewonnenen Stämmen eine Art von Palisadenzaun her, hinter dem sie vollkommen ruhig, selbst den Angriff einer ihnen an Zahl weit überlegenen Macht abwarten konnten. Der innere Raum war dabei absichtlich so beschränkt gelassen worden, wie nur irgend möglich, damit sie nicht eine zu weit gestreckte Umzäunung zu verteidigen hatten, der kleine Bach mit hineingezogen, um wenigstens keinen Wassermangel zu leiden, im Falle sie eingeschlossen werden sollten.
Nachdem für alles gesorgt und die Drehbasse auf einem roh zusammengenagelten Gestell zum augenblicklichen Gebrauch fertig war, gingen sie dann auch daran, eine kleine Hütte für sich zu bauen, die sie mit Bananen- und Pandanusblättern deckten und wandten den nächsten Tag dazu an, einen Vorrat von allen möglichen Früchten, die in der Nachbarschaft wuchsen, einzusammeln und zu speichern.




