Xaver Stielers Tod – Kapitel 5
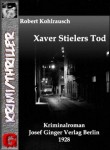 Robert Kohlrausch
Robert Kohlrausch
Xaver Stielers Tod
Kriminalroman
Erschienen 1928 im Josef Ginger Verlag Berlin
Fünftes Kapitel
Die Nachricht von der Feststellung des Giftes in Xaver Stielers Leiche hatte sichtlich stark auf den Untersuchungsrichter gewirkt. Sogar sein volles, jovial behagliches Gesicht verwandelte sich. Die Linien darin wurden straff, eine senkrechte Strichfalte schob sich zwischen die Augenbrauen, sein Blick wurde schärfer und kalter.
Sein ganzes Wesen drückte jetzt forschende Spannung aus.
»Ich muss gestehen, das hat mich überrascht. So hat unser Herr Sanitätsrat also doch keine Gespenster gesehen. Der Fall scheint interessant und verwickelt. Wir haben den Inder mit seinem Gift, wir haben die Frau Baratta mit ihrer Eifersucht, und wir haben den Herrn Stieler selbst. Ich meine nämlich, wir dürfen den Gedanken an einen Selbstmord nicht ganz von uns weisen. Es fällt mir auf, dass dieser Mann ohne jeden sichtbaren Grund, im Besitz von Ruhm und Einkünften, um die jeder Minister ihn hätte beneiden können, von seiner glänzenden Laufbahn gerade auf ihrer Höhe hat scheiden wollen. Man kann das auf eine seelische Depression deuten, die möglicherweise zum Selbstmord geführt haben könnte. Das ist bis jetzt freilich nur Vermutung ohne jeden Beweis, aber ich möchte doch vor allem etwas Näheres über den Toten selber hören. Stefan Graf Hersberg ist ja wohl draußen? Bitte, Herr Kommissar, seien Sie so gut, ihn hereinzurufen.«
Graf Stefan erschien mit leichter Verbeugung vor dem Untersuchungsrichter. Er war in Schwarz, aber wenn er am Abend vorher auf der Bühne Zeichen von Erschütterung und Ergriffenheit in seinem Gesicht gezeigt hatte, so waren sie nun verschwunden. In seiner ganzen Erscheinung lag wieder die ruhige, vornehme Lässigkeit wie gewöhnlich.
Germelmanns auf ihn gerichtete Blicke waren scharf, aber seine Stimme war freundlich, als er sagte: »Sie haben in dem so plötzlich gestorbenen Herrn Stieler einen ganz nahen Verwandten zu beklagen, wie man mir sagt, Graf Hersberg. Der Tote war Ihr Bruder, nicht wahr?«
»Ja, der arme Kerl war wirklich mein Bruder, wenn auch seit mehreren Jahren diese Verwandtschaft nur noch ganz inkognito vorhanden war. Fast ebenso lange haben wir einander überhaupt nicht mehr gesehen.«
»Ich wüsste gern etwas Näheres über ihn, über seine Geistesrichtung seine Neigungen, seinen Charakter. Bitte, setzen Sie sich und erzählen Sie mir etwas darüber.«
Germelmanns Aufforderung zum Sitzen war die Folge von einem Blick, den Stefan auf einen Stuhl ihm zur Seite geworfen hatte. Jetzt nahm er Platz darauf und sagte: »Bitte, fragen Sie, das wird am einfachsten sein. Ich habe noch kein besonderes Erzähltalent in mir entdeckt.«
»Gut, wie Sie wollen. Also zunächst: Wann und wo war der Verstorbene geboren?«
Ein leichtes Lächeln ging über Stefans Gesicht. »Ich muss erst einmal ein wenig rechnen. Botho – Xaver hieß er nur, seit er sich im Stillen umgetauft hatte, – war um zwei Jahre älter als ich selbst. Ich bin gegenwärtig zweiunddreißig alt, er hat es also nur zu vierunddreißig Jahren gebracht. So dürfte die schwierige Rechnung wohl stimmen.«
Ein leichter Überraschungsblitz flog aus Germelmanns Augen zu Stefan hinüber. War diese ruhige, fast heitere Nonchalance, womit Stefan von einem hoch tragischen Familienereignis, von ihm selbst sehr nahe betreffenden Verhältnissen sprach, nun Kunst oder Natur?
»Der Tote hieß in Wirklichkeit also Botho Graf Hersberg, nicht wahr?«
»Hersberg-Negenhofen, um ganz genau zu sein.«
»Ist Negenhofen eines Ihrer Familiengüter?«
»Leider das einzige.«
»So sind auch wohl Sie selber dort geboren worden?«
»Ebenso wie mein Bruder, jawohl.«
»Und Ihre sonstige Familie, – lebt Ihr Herr Vater noch?«
»Er lebt.« In diesen beiden Worten war ein ganz leiser Klang von Härte, der dem Richter auffiel.
»Hat er die traurige Nachricht vom Tod seines Sohnes bereits erhalten?«
»Ich habe gleich telegrafiert. Er kommt heute Mittag.«
»Nun sagen Sie mir, bitte, wie kam der Verstorbene darauf, zur Bühne zu gehen?«
»Das kann ich Ihnen in drei Worten sagen: cherchez la femme.«
»Ah! Hat ihn die Liebe für eine Bühnenkünstlerin dazu gebracht?«
»Indirekt ja. Doch hat mein Vater tüchtig nachgeholfen.«
»Wieso? Der Wunsch Ihres Herrn Vaters kann es doch kaum gewesen sein, den Sohn als Varietékünstler zu sehen.«
Wieder lächelte Stefan sein weiches, liebenswürdiges Lächeln, das etwas an das des verstorbenen Bruders erinnerte. »Nein, wünschen tat er es wahrhaftig nicht. Aber mein Bruder hatte sich verliebt in diese Kinoschauspielerin, die Baratta, so toll und widerstandslos, – na, sie hat ihn glücklich soweit getrieben, dass er sich heimlich mit ihr verheiratete. Dann erfolgte der große Krach. Unser alter Herr bekam Wind von der Geschichte, und nun wurde die Sache dramatisch – mit Vaterfluch und Enterbung. Er stammte noch aus einer Zeit, in der man solche Dinge für geschmackvoll hielt. Mein Bruder saß mittellos auf der Straße, war aber zu stolz, von seiner Frau sich durchfüttern zu lassen. In das Theatermilieu war er durch seine Heirat einmal hineingekommen, – körperlich außerordentlich gewandt war er immer gewesen, na, so verwandelte sich denn Botho Graf Hersberg in den bald gesuchten, schließlich in seiner Art berühmten Herrn Xaver Stieler.«
»Aber ist es denn richtig, dass er jetzt wirklich von der Bühne zurücktreten wollte?«
Stefan hatte bisher scheinbar offen und frei gesprochen, aber nun bekam sein Gesicht einen ablehnend verschlossenen Ausdruck. »Ich sagte schon, dass ich meinen Bruder lange Zeit nicht gesehen und gesprochen habe. Wir sind uns auch hier während seines Gastspiels nur ganz flüchtig begegnet.«
»Soll das heißen, dass Ihnen sein Gedanke, vom Theater wegzugehen, unbekannt war?«
»In den Zeitungen hat man ja davon gelesen.«
»Sie selbst aber, wussten Sie gar nichts Näheres darüber?«
»Näheres, nein.«
»Auch nicht über die Gründe für seinen Rücktritt?«
»Er hat mich nie zu seinem Vertrauten gemacht. Wir hatten uns eben auseinandergelebt, wie das bei der langen Trennung und bei der Verschiedenheit unserer Lebenskreise wohl einigermaßen begreiflich ist.«
Germelmann sah schweigend eine Weile vor sich nieder, indem er zwischen seinen Fingern einen Bleistift hin und her drehte. Dann sprach er wieder, langsam, jedes Wort betonend. »Wir haben vor Kurzem eine Mitteilung bekommen, die für Sie von gleichem Interesse wie für das Gericht ist. Ihr Bruder ist nachgewiesenermaßen an Gift gestorben.«
Bei den letzten Worten richtete der Untersuchungsrichter seine bis dahin auf die Tischplatte gehefteten Blicke voll und fest auf den Grafen. Stefan sprang empor. »An Gift? Wahrhaftig?«
»Man hat ein starkes Pflanzengift in seiner Leiche mit Sicherheit festgestellt.«
»So hätte der kluge Herr Doktor von gestern doch recht gehabt? Ja, wie soll denn das geschehen sein, wer soll es getan haben?«
»Einstweilen fragen wir das auch noch, ohne darauf antworten zu können. Sind Sie mit Ihrer Schwägerin, der Frau Baratta, näher bekannt?«
»Nein, ich habe sie nur ganz oberflächlich einmal kennengelernt. Vergiftet! Das ist ja doch eine tolle Geschichte!«
»Wissen Sie, wie das eheliche Leben der beiden war?«
»Wie schon gesagt, mein Bruder hat mich nicht zu seinem Vertrauten gemacht.«
Germelmann rieb sich das Kinn einen Augenblick schweigend und sagte dann mit einem klugen Lächeln: »Sie sind von Beruf Diplomat, Graf Hersberg, soviel ich weiß, und Sie drücken sich auch dem Gericht gegenüber sehr diplomatisch aus. Ich will Sie für heute nicht weiter bemühen. Bis wir uns einmal wieder sprechen, ist es Ihnen vielleicht klar geworden, dass Ihre diplomatischen Fähigkeiten besser auf anderen Gebieten verwertet werden?«
Stefan erwiderte mit einer tiefen, stummen Verbeugung. »Darf ich mich nun empfehlen?«
»Ich will Sie nicht länger aufhalten. Aber das Abschiedswort muss heißen: auf Wiedersehen.«
»Auf Wiedersehen denn, Herr Amtsgerichtsrat.«
Noch eine Verbeugung, diesmal gefällig und leicht, und Graf Hersberg verließ das amtliche Gemach. Germelmann wandte sich zum Kommissar. »Ein hübscher, liebenswürdiger Mensch, dieser Graf. Anscheinend aber ziemlich gerissen. Sicher weiß er über seines Bruders Ehe mehr, als er sagt. Und ich vermute doch, dass da die Lösung dieses Geheimnisses liegt.«
»Herr Amtsgerichtsrat glauben?«
»Ich glaube noch nichts. Denn ich glaube nur, was ich weiß. Aber wer so sein ganzes Leben einem schönen Weib zum Opfer gebracht hat, lässt sich auch weiter vom Weib regieren. Fragt sich nur, ob in beiden Fällen vom selben.«
***
Graf Stefan hatte sich vor dem Verlassen des Gerichtsgebäudes eine Zigarette hervorgeholt und angezündet und sah nun auf seiner Armbanduhr nach der Zeit. Es war noch zu früh für seine Verabredung, er konnte ganz langsam gehen und sich mit sich selber besprechen. So bog er bald von den menschenerfüllten Straßen ab und in den vom Herbst schon gelichteten, farbig aufgehellten Schatten der Anlagen hinein, die sich mit einem großen Kranz um das Innere der Stadt legten. Hier war es leer, der kräftige Sterbegeruch schon gefallenen Laubes lag in der Luft. Klar und blau stand der Himmel über der Erde.
Ganz gemächlich, mitunter ein leichtes Rauchwölkchen in die Höhe blasend, schritt Stefan dahin. Der Ausdruck seines Gesichtes war wechselnd, bald hell, bald wie von vorüberziehenden Wolken getrübt. Aber jedes Mal siegte das Licht. An einem Platz, wo dichte Sträucher jeden Blick der Neugier von ihm fernhielten, blieb er stehen und sprach mit sich selbst.
»Es ist scheußlich, aber ich bringe keine Tragödienstimmung auf. Da liegt mein Bruder, tot, vergiftet, ermordet, und ich fühle mein Herz dabei nicht viel rascher schlagen als gewöhnlich. Er tut mir leid, gewiss, der arme Kerl. Aber wenn ich sage ›Botho‹, sagt mein Herz im selben Augenblick ›Hanna‹. Das ist es, was mich regiert. Ich bin aus demselben Holz geschnitzt wie mein Bruder. Bei beiden erbliche Belastung – cherchez la femme!«
Er schlenderte weiter, lächelte, zündete sich eine neue Zigarette an und verfolgte den Anlagebogen um die halbe Stadt herum. Hier besiegten die Bäume völlig den Stein. Weit und still schloss ein Wald sich stadtauswärts an die parkartigen Anlagestreifen an. Dorthin schritt Stefan, ein wenig rascher nun nach einem neuen Blick auf die Uhr. Eine Viertelstunde weit ging er noch, schmale von den Hauptwegen abzweigende Pfade suchend, bis ein von dichtem Tannengrün umschlossenes Rund ihn aufnahm. Ein moosbewachsener Steinpfeiler mit einer Sonnenuhr stand in der Mitte, ringsum waren vier hölzerne, dunkelgrün gestrichene Bänke verteilt.
Von diesen Bänken waren drei leer. Die Mittagszeit war bereits nahe, die meisten Spaziergänger hatten den Wald verlassen. Auf der vierten Bank saß eine dunkel gekleidete Frauengestalt und stand hastig auf, sobald sie Stefan erblickte.
»Hanna, – schon hier?«
»Ich bin vor der Zeit gekommen, ich hielt es im Haus nicht aus vor Unruhe. Deine Nachricht heute Morgen, dass dein Bruder tot ist, hat mich furchtbar aufgeregt. Ist es denn wahr?«
»Ja, Hanna, das ist, wie du sagst. Aber lass mich dich erst einmal anschauen, dir Guten Tag sagen. Über all die hässlichen Dinge können wir später sprechen. Erst wollen wir uns einmal freuen, dass wir beisammen sind.«
Er hatte sie bei den Händen ergriffen, hielt sie so für ein paar Sekunden fest und sah mit lachenden, leuchtenden Augen in ihr Gesicht. Seine gewohnte Lässigkeit war verschwunden, die Spannung eines hohen Glücksgefühls war in seiner Gestalt, in jeder seiner Bewegungen.
»Stefan!«, sagte sie leise, seinen Blick trinkend mit ihren Augen. Ein leises Erschauern ging durch ihre Glieder, dann machte sie sich gewaltsam von ihm los.
»Nein, sag mir erst alles. Du hast mir so kurz geschrieben, die paar Worte nur, dass er tot ist, – und ich, – dass ich hierherkommen soll …«
»Dafür bin ich nun hier, und wir wollen das mündliche Verfahren an die Stelle vom schriftlichen setzen, wie die Herren vom Gericht sagen würden. Ja, wundere dich nicht über eine neue ›juristische Bildung bei mir‹ – ich komme direkt von einem hochnotpeinlichen Verhör.«
»Verhör, – du, – was will denn das Gericht von dir?«
»Ach, es ist ja sein Beruf, neugierig zu sein. Aber so ganz unbegründet ist sein Eifer diesmal nicht. Es hat nämlich herausbekommen, dass mein Bruder vergiftet worden ist.«
»Vergiftet!« Hanna taumelte zurück, als ob ein Stoß vor die Brust sie getroffen hätte. Dann wandte sie sich seitwärts und ging mit unsicheren Schritten zu der nächsten Bank, um schwer darauf niederzusinken.
»Ich habe dich erschreckt, – sei nicht böse, Schatz. Ich bin leider immer ungeschickt, wenn ich um Gotteswillen recht geschickt sein sollte.«
»Das, – das haben sie herausbekommen?«
»Jawohl. Der eine von den Ärzten auf der Bühne gestern Abend – es war aber nicht Glaritz, dein Vetter, der sprach nur von einem Schlaganfall, – der Gerichtsarzt redete schon von einer Vergiftung. Er spielte sich als erfahrener Sachverständiger auf in diesen angenehmen Dingen und redete von einem besonderen indischen Gift.«
»Von einem indischen Gift?« Vor sich hin starrend wiederholte Hanna leise die Worte. Dann wandte sie sich mit einer plötzlichen Bewegung zu Stefan, der sich neben sie gesetzt hatte, fasste mit einer Hand seinen Arm und fragte: »Hat man auf jemanden Verdacht?«
Stefan lachte leicht auf. »Ach, so vertrauensvoll war der Herr Amtsgerichtsrat nicht, mich in die Geheimnisse der hohen Behörde einzuweihen.«
»Was hat er denn von dir wissen wollen?«
»Über Botho, – weshalb er zum Theater gegangen ist, – ob er jetzt wirklich hat abgehen wollen, – wie das Glück seiner Ehe beschaffen gewesen ist, und so weiter. Sag’ mal, – da fällt mir ein, – du hast Botho doch gestern gesprochen?«
»Ja, ja.«
»Hat er irgendetwas gesagt, was dir aufgefallen ist?«
»Nein, kein Wort. Wir haben über eure Sache geredet, wir erwarteten ja jeden Augenblick, dass du noch kämst, …«
»Ach, es war scheußlich, dass mir das gerade gestern passieren musste. Vielleicht einmal im Jahr kommt es vor, dass mein Chef mich solange festhält, und nun hat es gerade gestern sein müssen.«
»Erzähle weiter, Stefan, – wie war es auf dem Gericht?«
»Ich habe mich möglichst in Schweigsamkeit gehüllt. Ich finde, diese Privatangelegenheiten gehen keinen was an. Dafür ist mir dann zum Schluss von dem gestrengen Herrn ein Privatissimum über allzu diplomatisches Verhalten gelesen worden.«
»Aber du, – hast auch du keinen Verdacht?«
»Absolut nicht. Was weiß ich denn von meines Bruders Theaterfreundschaften und – Feindschaften? Und Afra …«
»Du meinst? …«
»Ich will nichts gesagt haben. Sie soll fort sein, gestern Abend plötzlich abgereist. In der hübschen Zeugengalerie heute Morgen war sie jedenfalls nicht. Ein indischer Zauberkünstler saß dort …«
»Amaru?«
»Du kennst ihn?«
»Vom Theater – und …«
»Und was?«
»Ich habe dir schon davon erzählt. Er hat hier spiritistische Sitzungen gehalten. Dort bin ich ein paar Mal gewesen.«
»Ja, ja, ich weiß, das ist ein Spezialvergnügen von dir.«
»Kein leeres Vergnügen, Stefan, im Gegenteil, eine sehr ernste Sache. Seit meiner Mutter Tod beschäftigt mich die Frage nach dem Jenseits immer wieder.«
»Ich finde vorläufig unser hübsches Diesseits viel amüsanter. Solange wir beide noch auf dieser grünen Erde beisammen sind, kann mich das allerschönste Jenseits nicht locken. Ja, Hanna, ganz merkwürdig ist es, als ob ein elektrischer Strom von dir ausginge, der mich in Brand setzt, – als ob …«
Er verstummte, vom Gefühl überwältigt. Sie nahm seine Hand, und so saßen sie, jeder den anderen mit seinen Blicken umfassend, eine Weile schweigend in der sonnigen Stille des Mittags. Dann begann Hanna wieder zu sprechen. Sie tat es in einer vorsichtigen, tastenden Weise.
»Sag’ mir, Stefan, welchen Wechsel in deinen Aussichten, in deiner Stellung zum Vater kann Bothos Tod haben?«
»Das weiß ich nicht, Hanna. Mein alter Herr ist unberechenbar. Erst hat er Botho verflucht und enterbt, nun sollte der wieder zu Gnaden angenommen werden und ich mit Fluch und Enterbung an die Reihe kommen. Wegen fortgesetzten Lebenswandels, den ich allerdings nicht leugnen kann.«
»Bin ich wirklich nicht mit schuld am Zorn deines Vaters auf dich?«
»Keine Spur. Dass du keine Gräfin bist, bedeutet in seinen Augen natürlich einen sehr schmerzlichen Fehler. Aber übrigens, du bist aus einem angesehenen Haus, bist reich, wofür er auch nicht unempfänglich ist, während ich selber nicht so sehr damit einverstanden bin …«
»Ach, Stefan …«
»Jawohl. Es kann mich in den Verdacht bringen, dass ich dich nicht um deiner selbst willen lieb habe, während ich, – wahrhaftig, Hanna, wenn du so arm wärst wie die viel zitierten Kirchenmäuse, du wärst mir dann, glaub’, ich, noch lieber als in deiner blanken Vergoldung. Und wenn das wäre, hätte dein Vater auch wohl weniger gegen mich einzuwenden. Der steht unserem Glück im Wege, nicht mein alter Herr, der dich vielleicht gern als Lehrmeisterin auf meinem Weg zur Tugend engagierte.«
»Ja, meines Vaters Vorurteil gegen dich …«
»Ach Schatz, er hat sich nach mir erkundigt. Und wer das tut, erfährt meist nicht viel Gutes.«
»Aber ganz gewiss bekommt er dann kein richtiges Bild von dir. Du magst leichtsinnig sein …«
»Bin ich.«
»Magst Schulden gemacht haben …«
»Hab’ ich. Und viele, leider Gottes. Ja, Hanna, hier neben dir sitzt ein armer Sünder, und nur durch deine Gnade kann er selig werden. Auf die Waage der Gerechtigkeit, wo seine Fehler gewogen werden, kann er als einziges Gutes nur werfen. Dass er dich lieb hat, Hanna, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt.«
»Das wiegt schwerer als alles andere. Für mich wenigstens ist es der Inbegriff des Glücks. Ich lasse dich mir nicht nehmen, Stefan, durch nichts in der Welt. Kämpfen kann ich und will ich um dich, wenn es nötig ist, aus dem Wege räumen, was uns hindern will in unserem Glück. Bleib du mir gut, und ich frage nach keines Menschen Urteil sonst.«
»Wie schön du bist, wenn so die Leidenschaft aus dir spricht. Ich muss bei dir immer an ein stilles, tiefes und großes Wasser denken, das man erst kennenlernt in all seiner Pracht, wenn ein Sturm darüber hinführt. Von den anderen Menschen ahnen die wenigsten, was in dir schläft, ich aber weiß es und bin glücklich, wenn es einmal erwacht.«
Er schwieg einen Augenblick und sah vor sich nieder, lachte dann leicht auf.
»Du machst wahrhaftig einen Poeten aus mir. Aus dem nüchternen alltäglichen prosaischen Kerl, der ich bin.«
»Tu’ dir nicht unrecht. Auch in dir steckt vieles, was niemand ahnt. Niemand als ich. Das ist ja das Wunderschöne: Die Liebe lässt Menschen einander in die Seele sehen.«
»Wenn ich bei dir bin, kommt es mir manchmal vor, als wenn wirklich noch etwas aus mir werden könnte. … Dann bin ich nicht mehr so leichtsinnig, nicht mehr so träge, nicht mehr …«
Plötzlich brach er ab. Sein Blick war auf eine Männergestalt gefallen, die von der Stadtrichtung her in den grünen Kreis getreten war und quer durch das Rund an ihnen vorüberging. Es war eine geschmeidige, schlanke Gestalt mit einem dunkelfarbigen Gesicht und noch dunkleren Augen. In sie kam ein rasches Aufleuchten, als ihr Blick auf Hanna fiel. Gleichzeitig zog der Mann seinen Hut und grüßte mit einer Verbeugung von südlicher Anmut. Einen Augenblick später war er im Tannengrün verschwunden.
»Lupus in fabula«, sagte Stefan. »Das war ja wahrhaftig unser Inder.«
»Amaru, – ja.«
»Du kennst ihn also persönlich? Mir schien, er grüßte dich und nicht mich.«
»Von den Sitzungen her wird er mich kennen.«
Stefan wollte noch etwas erwidern, doch unterbrach er lebhaft sich selbst, auf das Uhrarmband schauend. »Mein Gott, ich muss ja gehen. Es ist höchste Zeit. Ich muss Vater an der Bahn abholen, – ich gehe gleich links hier durch den Wald.«
Sie war ebenfalls aufgestanden und gab ihm zum Abschied eilig die Hand. »Auch für mich wird es Zeit. Lebe wohl, gib mir Nachricht, wie dein Vater sich zu dir stellt, welchen Eindruck Bothos Tod auf ihn macht, und vor allem, behalte mich lieb.«
»Das ist überflüssige Mahnung, Schatz, geschieht ohne dies. Lebe wohl, auf baldiges Wiedersehen.«
Er wandte sich nach links und war fast schon in einem dunkelnden Einschnitt zwischen den Tannenwänden verschwunden, als Hanna, die stehen geblieben war, ihm nachrief: »Schreib mir auch, Stefan, wenn es irgendetwas Neues gibt über Botho, – schreib mir, ob man Verdacht auf irgendwen hat.«
