Xaver Stielers Tod – Kapitel 4
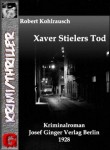 Robert Kohlrausch
Robert Kohlrausch
Xaver Stielers Tod
Kriminalroman
Erschienen 1928 im Josef Ginger Verlag Berlin
Viertes Kapitel
Der nächste Morgen war hell und herbstlich schön wie der vergangene Tag und brachte sogar in den kühlen Amtsraum des Untersuchungsrichters Germelmann etwas von seiner gütigen Freundlichkeit. Auch auf dem runden Gesicht Germelmanns lag ein Glanz von jovialer Helle. Seinen vollen Körper bequem in den tiefen Sessel vor dem Schreibtisch zurücklehnend, sprach er in gemütlichem Ton zu dem Polizeikommissar Bauer, der sich auf seinen Wink einen Stuhl genommen und ihm gegenüber hinter den frei mitten im Zimmer stehenden Schreibtisch gesetzt hatte.
»Na, da bin ich neugierig, was bei der Geschichte herauskommt. Ich neige mich vorläufig zu der Diagnose von Doktor Glaritz, der auf Herzinfarkt schließt. Solch ein Giftmord auf offener Bühne. Die Geschichte sieht mir doch etwas allzu theatralisch aus. Wir wollen jedenfalls nichts versäumen. Schießen Sie los und berichten Sie mir, was Ihre Recherchen ergeben haben.
Los, wer nicht anfängt, wird auch nicht fertig.«
Er lachte behaglich und setzte sich noch bequemer im Sessel zurecht, während Bauer seinen Oberkörper militärisch gerade richtete.
»Herr Amtsgerichtsrat müssen verzeihen, wenn ich in Bezug auf das Vorliegen von einem Herzinfarkt oder Schlaganfall in aller Bescheidenheit widerspreche. Der Herr Sanitätsrat hat mir verschiedene Symptome von solch einer indischen Vergiftung so deutlich nachgewiesen, dass ich doch ein wenig misstrauisch geworden bin. Dabei soll ein ganz langsames, aber intermittierendes Erlöschen der Lebenskraft eintreten, sodass der Vergiftete zwischendurch wieder vollkommen frisch erscheint, ganz genau, wie das gestern auch bei dem Herrn Stieler der Fall war. Dann aber entwickelt sich eine immer tödlichere Müdigkeit, bis der Betreffende schließlich ruhig und sanft, scheinbar mit ausgesprochenem Lustgefühl einschläft. Darum nennt man dies indische Gift auch – ich habe das indische Wort vergessen, – auf Deutsch heißt es: ›Der glückliche Tod‹.«
»Gar kein übles Tränkchen, dieses Gift«, sagte Germelmann. »Über gewisse Situationen des menschlichen Lebens und Sterbens könnte man sich damit ganz angenehm weghelfen.«
»Der Herr Sanitätsrat sagt auch, dass man damit gewissermaßen von Weitem vergiften kann, insofern die Wirkung nämlich nur ganz langsam und allmählich im Verlauf von ein paar Stunden erst eintritt. Scheinbar gesund und munter, kann der Mensch, den man vergiftet hat, von dem Ort fortgehen, wo das geschehen ist, und erst weit weg fängt er an, die Wirkung zu spüren. Das ist nun allerdings auch, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, ein Grund, weshalb der nächstliegende Verdacht sich vielleicht nicht wird aufrecht erhalten lassen.«
»Vielleicht wird sich gar keiner aufrecht erhalten lassen. Ist mir immer noch zu romantisch, die Geschichte. Welchen Verdacht meinen Sie denn?«
»Ich habe vorhin wohl allzu kurz und nicht mit aller gebotenen Deutlichkeit berichtet. Aber ich erlaubte mir bereits mitzuteilen, dass Herr Stieler schon, als er seine Garderobe verließ und hinter die Kulissen kam, ein leichtes Unwohlsein, oder besser gesagt, eine gewisse Müdigkeit und Abspannung verspürte. Darum bat er, obwohl er sonst nur sehr wenig trank, den indischen Zauberkünstler Amaru, der im ersten Teil des Programms mitgewirkt hatte, bereits wieder umgekleidet war, ihm eine halbe Flasche Champagner zu besorgen. Er wollte nur ein Glas davon trinken, um sich anzuregen. Das tat er auch, hinterher hat er in seiner liebenswürdigen Manier – das ganze Personal schwärmte ja für ihn – die angebrochene Flasche dem Feuerwehrmann Huberbeck, der auf Posten in der ersten Kulisse stand, geschenkt. Na, mein Huberbeck war nicht böse darüber und hat nach und nach den Wein, gleich aus der Flasche heraus, ganz gemächlich ausgepichelt. Hinterher hat er sodann die Flasche wieder auf den kleinen Tisch ganz nahe bei seinem Posten hingestellt, wo Stieler ein paar Minuten gesessen hatte, um das eine Glas zu trinken. Glas und Flasche standen beide noch an ihrem Platz. Ich habe sie selbstverständlich sofort beschlagnahmt. Augenblicklich ist ein sachverständiger Chemiker mit ihrer Untersuchung beschäftigt.
»Und Ihr braver Herr Huberbeck lebt noch?«
»Jawohl, er sitzt frisch und gesund auf dem Korridor draußen.«
Germelmann lachte. »Dann hat er eine sehr gute Gesundheit oder die Geschichte von dem vergifteten Wein ist eine Fabel.« Er schwieg einen Augenblick, ein wenig ernster geworden, und sagte dann: »Der Zufall ist allerdings verflucht sonderbar, dass dieser möglicherweise nach indischem Rezept vergiftete Wein dem armen Stieler gerade von einem Inder vorgesetzt worden ist. Haben Sie sich diesen Kunden einmal angesehen?«
»Selbstverständlich. Er ist ebenfalls auf dem Korridor draußen zur Vernehmung anwesend, ebenso Graf Stefan Hersberg, der Direktor Steinberg und Fräulein Josefine Fengefisch, genannt d’Otranto, bei der Afra Baratta – man bricht sich die Zunge fast ab bei diesen Theaternamen – hier wohnt.«
»Gut. Ich glaube, dann lassen wir zunächst einmal diesen indischen Zaubermann antreten. Den will ich mir doch ein bisschen genauer anschauen. Wer weiß, wann die Nachricht über die Sektion der Leiche aus der Anatomie kommt. Bitte, rufen Sie mir also den Herrn Amaru – so heißt er ja wohl – herein.«
Bauer ging zunächst zur Tür zum seitwärts gelegenen Zimmer, um den Protokollführer hereinzubitten. Das war ein junger, kleiner und hagerer Herr, ein Referendar Kleinhans mit ganz kurzgeschnittenem rotem Haar und Monokel von bemerkenswerter Größe. Sobald er am Protokollantentisch an seinem Platz war, öffnete Bauer auch die Korridortür und rief als ersten Zeugen den indischen Zauberkünstler herein.
Es war derselbe schlanke Mensch mit brauner Haut und noch viel dunkleren braunen Augen, in denen das Weiße merkwürdig leuchtete, der am Abend vorher, an eine der Kulissen gelehnt, so gespannt und andauernd auf den Toten geschaut hatte. Seine Züge waren schlaff, als wenn er wenig oder gar nicht geschlafen hätte, sein Atem ging schnell. Er sprach ein gebrochenes, doch verständliches Deutsch.
Nachdem festgestellt worden war, dass er kein künstlich zurechtgemachter Theaterinder, sondern wirklich ein Sohn des fernen Sonnenlandes war, – er betonte seine Namensverwandtschaft mit einem berühmten indischen Dichter nicht ohne Stolz – begann Germelmann mit der Vernehmung.
»So, nun berichten Sie mir zunächst einmal, ob Sie mit Herrn Xaver Stieler näher bekannt waren.«
»Nicht näher, nein. Waren wir aber zweimal engagiert nebeneinander, hier und in Leipzig.«
»Haben Sie mit ihm auch außerhalb des Theaters verkehrt?«
»Nicht, nein. Gar nicht.«
»Sie sagen das in einem Ton, als wenn Sie keine Neigung dazu gehabt haben würden. Wie man mir erzählt hat, soll er doch sonst beim ganzen Personal außerordentlich beliebt gewesen sein.«
»Das war, – bei mir ist es gewesen zweierlei.«
»Zweierlei, – wieso?«
»Haben ich gehasst Herrn Stieler als Künstler, haben ich geliebt ihn als Mensch.«
»Und weshalb haben Sie den Künstler gehasst?«
»Weil er ist gewesen größer als ich in mein Fach. Wenn ich sonst bin aufgetreten in eine Stadt, alles hat gerufen: ›Oh, oh, oh, müsst ihr sehen den Amaru‹. Wenn Stieler ist aufgetreten am selben Theater, alles hat gerufen: ›Oh, oh, oh, müsst ihr sehen den Xaver Stieler‹.«
»Es ist ja verständlich, dass Ihnen als Künstler das nicht angenehm war. Trotzdem haben Sie Herrn Stieler als Menschen geliebt, wie Sie sagen?«
»Ich hätte für ihn gehen können durchs Feuer. Er hat mich nur anzusehen brauchen mit sein ganz besonderes Lächeln, – oh, so hat lächeln können kein Mensch auf das ganze Welt.«
Germelmann sah den Inder, in dessen Augen ein schwärmerisches Feuer aufgeflammt war, mit einem sorgfältig prüfenden, gütigen Blick ein paar Sekunden lang schweigend an. Bevor er selbst wieder zu sprechen anfing, begann der andere von neuem.
»Und er ist gewesen immer gütig zu mir. Gar nicht so wie ein großer Herr, was er doch gewesen ist in seine Kunst. Er hat mir zugesprochen gut, wenn ich war traurig, weil niemand mehr hat wollen so recht applaudieren bei mir. Oh, man bekommt ein Ohr für das Beifall, ob es ist von Herzen oder nicht. Und er hat mich besucht vor vierzehn Tagen, wann ich bin gewesen krank, und hat mir gebracht angenehme Dinge zum Essen. Er ist gewesen gut, sehr gut.«
»Wenn Sie so freundschaftlich für den guten Menschen fühlten, der Ihnen als Künstler ja nun auch keine Konkurrenz mehr machen kann, werden Sie gewiss gern alles dazu beitragen, um das Dunkel aufzuhellen, das über seinem Tod liegt.«
»Aber gewiss, – ganz, ganz gewiss.«
»Ein Arzt hat, wie Sie wohl gehört haben, den Verdacht ausgesprochen, dass Herr Stieler nicht an einem Schlaganfall, sondern an einem besonderen indischen, langsam wirkenden Gift gestorben sei. Kennen Sie solch ein Gift?«
»Oh ja, das ich kennen sehr gut. Und gestern, wie der Herr Doktor hat gesprochen davon, ist es mir gewesen, als wenn er haben könnte recht.«
»Haben Sie denn selbst schon in Ihrem Vaterland einen Fall von solcher Vergiftung erlebt, gesehen?«
»Oh ja, ganz aus die Nähe sogar.«
»Wen betraf er denn?«
»Meinen Vater, meinen eigenen.«
»Das ist ja merkwürdig. Ist er vergiftet worden?«
»Oh nein, er hat nie gehabt eine Feind. Eine von Körper und Blut. Aber die große Feind ist gekommen, vor die kein Mensch ist sicher. Ist er geworden krank, so krank, so dass kein Arzt hat nehmen können von ihm die Schmerzen, und hat er selbst genommen das Gift, was heißt auf Deutsch: ›Der glückliche Tod‹. Und hat er gelächelt im Tod, wie gestern hat gelächelt unser guter Herr Stieler.«
»Haben Sie selbst jemals ein solches Gift gesehen?«
»Oh ja. Nicht nur gesehen. Ich selbst haben solches Gift.«
»Hier, – jetzt? In unserer Stadt?«
»Oh ja. In unsere Stadt, in meine Wohnung.«
Germelmann warf in hellem Erstaunen seinen Kopf zurück und sah den Polizeikommissar mit einem ungeheuer ausdrucksvollen Blick an. Darin war deutlich zu lesen: »Der Kerl ist entweder phänomenal naiv, oder phänomenal raffiniert.«
Bevor er noch vor Erstaunen zu Worte kommen konnte, sprach der Inder weiter. »Ich mir habe vorgenommen zu tun, wie mein Vater hat getan. Sie wohl werden wissen, wir in mein Land nicht fürchten den Tod. Und wenn ich einmal werde so krank, dass ich nicht wieder kann werden gesund, ich auch will essen von das Gift. Ich oft haben daran gedacht neulich in meine Krankheit. Aber nun bin ich doch wieder geworden gesund.«
»Hat Herr Stieler davon Kenntnis gehabt, – ich meine, dass ein solches Gift sich in Ihrem Besitz befand?«
»Oh nein. Wir nicht oft haben gesprochen miteinander. Weil ich doch immer schon aufgetreten bin in das erste Teil von Programm, und er hat ausgefüllt ganz allein das zweite. Da hat er nicht gehabt eine Sekunde Zeit, um zu sprechen hinter die Kulissen.«
»Aber während Ihrer Krankheit, als er bei Ihnen war …«
»Oh nein. Ich auch da nicht habe gesprochen davon.«
»Und nun sagen Sie mir: wie war es gestern Abend? Hat er da nicht mit Ihnen geredet?«
»Oh ja, oh doch. Er ist gekommen aus die Garderobe, schon ganz fertig angekleidet, und hat gesagt: ›Wollen Sie mir tun einen Gefallen? Ich mich fühlen ein wenig matt. Ich möchte trinken ein Glas Sekt. Wollen Sie sein so gut‹ – und er hat mich angelächelt mit sein schönes Lächeln – ›mir zu holen eine halbe Flasche Champagner aus das Restaurant?‹ Da bin ich gewesen froh, dass ich ihm habe tun können ein Gefallen, und bin gelaufen und bin ganz rasch wieder dagewesen mit ein Glas und eine Flasche. Was ich dann habe gestellt auf ein kleines Tisch, das hat gestanden hinter die Kulissen.«
»Hat man im Restaurant schon die Flasche geöffnet, oder …«
»Oh nein. Er selbst hat gehabt ein, – wie sagt man doch gleich?«
»Einen Korkzieher?«
»Jawohl. Das hat er gehabt an sein Messer und hat abgemacht von das Flaschenhals das Metall und hat herausgezogen das Kork. Und er hat schnell getrunken das ganze Glas. Dann er mich hat gefragt, ob ich nicht haben will das Rest. Aber ich haben gedankt, weil ich niemals trinke Wein. Dann hat er gerufen das Feuerwehrmann, das ist auf Posten gestanden ganz nahe dabei, und hat ihm gegeben das ganze Rest in die Flasche.«
»Demnach hätte Herr Stieler nur ein einziges Glas aus der Flasche getrunken?«
»Soviel ich habe gesehen, jawohl. Hinterher ich bin gegangen auf das andere Seite von die Bühne, weil ich von da habe besser zusehen können bei sein Spiel. Ich das oft haben getan, weil man immer hat lernen können von ihm.«
Germelmann sah nachdenklich vor sich nieder und rieb ein paarmal mit auf- und nieder bewegtem Kopf am empor gehobenen Zeigefinger seine Nase. Dann fragte er weiter.
»Sagen Sie mir noch eins. Wo haben Sie das Gift in Ihrer Wohnung verwahrt«
»Das Gift? Oh, das ist immer in eine kleine Schrank an die Wand.«
»Dieser Schrank aber, ist er offen oder verschlossen.«
»Ob er -?« Zum ersten male zauderte der Inder mit seiner Antwort, und Germelmanns auf ihn gerichtete Blicke verschärften sich. Gleich aber sprach der Gefragte wieder fließend weiter. »Mitunter ist offen die Schrank, mitunter ist sie verschlossen. Aber ich immer lasse stecken den Schlüssel, weil ja doch kann passieren kein Unglück. Denn auf die Flasche, worin ich habe das Gift, ist ein Zettel, und auf ihm ist ein totes Kopf gemalt und ist aufgeschrieben darunter: ›Poison‹, was ja doch heißen Gift.«
Germelmann versank wieder für ein paar Augenblicke in tiefes Nachdenken, dann warf er noch einen scharf beobachtenden Blick auf den Inder, dessen braune Haut jetzt anscheinend von aufgeregtem Blut durchleuchtet war, und sagte: »Wir wollen Schluss machen für jetzt. Ich bitte Sie jedoch, sich noch draußen bereit zu halten, wenn wir Sie brauchen sollten.«
Als Amaru draußen war, sagte Germelmann: »Das ist ein schnurriger Kauz. Von einer geradezu verblüffenden Offenheit, wenn es nicht schlaue Berechnung ist. Festsetzen können wir ihn vorläufig wohl nicht, jedenfalls muss er polizeilich beobachtet werden, auch darauf hin, wer mit ihm verkehrt. Es ist ja doch wunderbar, dass wirklich solch ein Gift existiert und in seinem Besitz ist. Nun, ich denke, wir hören zunächst noch den Direktor.«
Steinberg, der nun hereingerufen wurde, trat schwankend ein in der Haltung eines gebrochenen Mannes, war noch gelber im Gesicht als gewöhnlich und bat gleich um Erlaubnis, einen Stuhl nehmen zu dürfen, weil er die Kraft nicht habe zum Stehen.
»Der Schlag war zu furchtbar für mich. Zwei vollständig ausverkaufte Häuser, und heute wird mir die Kasse gestürmt von den Leuten, die das Geld für ihre Billetts wieder zurückhaben wollen. In die Tausende geht es, Herr Amtsgerichtsrat, in die Tausende. Wenn es mir nicht gelingt, mit einer stilvollen Totenfeier für den Gestorbenen – vielleicht mit einem großen akrobatischen Potpourri – wieder etwas hereinzubringen, bin ich wirklich ein geschlagener Mann.«
Der Untersuchungsrichter blieb sehr kühl bei den Klagen des Jammernden. Er vernahm ihn über die Vorgänge des vergangenen Abends, musste jedoch bald erfahren, dass der Direktor erst nach Stielers Auftreten in seine Loge gekommen und vorher gar nicht auf der Bühne gewesen war. So beschränkte sich Germelmann darauf, ihn über etwaige Beziehungen zwischen dem Inder und Stieler zu befragen, erfuhr jedoch nur, dass Amaru häufig darüber geklagt hatte, durch Stieler so ganz in den Schatten gestellt zu werden. Einmal hatte Steinberg ihn aus diesem Grunde weinend hinter den Kulissen angetroffen. Er hielt ihn übrigens nach seinem Zeugnis für einen gutherzigen, etwas melancholischen Menschen. Des Direktors neugieriges Fragen, weshalb er gerade über Amaru vernommen würde, schnitt Germelmann kurz ab und machte der Vernehmung ein Ende.
Nach Steinberg wurde Huberbeck, der Feuerwehrmann hereingerufen und bekräftigte Wort für Wort Amarus Auskunft über Wein und Glas. Er hatte genau gesehen, wie Stieler eigenhändig den Flaschenverschluss entfernt hatte. Sein volles, rotes, rundes Gesicht bestätigte, dass ihm der Weinrest vortrefflich bekommen war.
Kaum war er wieder draußen, als ein Telefonklingelzeichen durch den Raum zitterte.
»Wollen Sie so freundlich sein?« sagte der Untersuchungsrichter zum Kommissar, und voll Eifer eilte Bauer zum Apparat.
Ein wenig langsam kam er zurück und sagte, halb vor sich hin: »Wundern tut mich’s eigentlich nicht, aber …«
»Was denn? War es Nachricht von der Anatomie?«
»Nein, das noch nicht. Aber vom chemischen Sachverständigen, der Glas und Flasche von gestern Abend untersucht hat.«
»Nun, – und?«
Er hat keine Spur von irgendeinem Gift darin gefunden.«
Germelmann lachte kurz auf. »Na, da hätten wir uns anscheinend ja vergeblich bemüht. Wenn wir uns nur in dieser ganzen indischen Giftmordaffäre nicht unsterblich blamieren!«
»Ich möchte mir darauf hinzuweisen erlauben, dass die Wirkung dieses besonderen Giftes allzu rasch eingetreten wäre, sofern Herr Stieler es erst im Theater bekommen hätte. Man müsste demnach wohl, wenn Herr Amtsgerichtsrat gestatten …«
»Jawohl, ich gestatte. Weiß auch, worauf Sie hinauswollen. Man müsste vor allen Dingen feststellen, wo sich der Tote vor dem Theater aufgehalten und ob er dort irgend etwas getrunken hat, nicht wahr?«
»Ganz recht, Herr Amtsgerichtsrat. Und ich habe durch meine Recherchen auch bereits feststellen können, dass Herr Stieler gestern ein paar Stunden vor seinem Auftreten in der Wohnung seiner Frau, der Kinoschauspielerin Afra Baratta, gewesen ist. Sie selber ist – was vielleicht von Bedeutung sein könnte – gestern Abend von hier abgereist, hat auch bisher auf ein ihr nachgesandtes Telegramm nichts von sich hören lassen.«
»Aber Sie sagten vorhin doch etwas von einer gewissen Fengefisch, bei der …«
»Jawohl, bei der hat Afra Baratta gewohnt. Ich habe sie deshalb auch gleich her zitiert. Wenn ich sie hereinrufen soll …«
»Ja, bitte.«
»Nur muss ich den Herrn Amtsgerichtsrat aufmerksam machen, dass die pp. Fengefisch über einen recht erheblichen Sprechanismus verfügt.«
»Wie Gott will. Wenn wir uns nur nicht unsterblich blamieren in der Sache!«
Vom Kommissar gerufen, erschien jetzt Josefine Fengefisch, alias Rosa d’Otranto, vor dem Untersuchungsrichter. Sie hatte sich schön und stilvoll, dem Trauerfall entsprechend gekleidet; ein Kleid aus schwarzem Samt mit einer Theaterschleppe wurde durch einen großen schwarzen Samthut ergänzt, über dem sich eine schwarze Straußenfeder in schönem Bogen wölbte. In der düsteren Umrahmung von all diesen Trauerzeichen erschien ihr kleines, rundes Apfelgesicht noch viel verschrumpelter als gewöhnlich. Auch ihr Augenzwinkern war infolge der Aufregung erheblich beschleunigt.
Sie hatte sich, wenn gleich mühsam, den schlanken, – raschen Bühnenschritt noch bewahrt, womit sie den Hervorrufen in vergangenen Tagen Folge zu leisten pflegte.
So, voll künstlicher Eleganz und Frische, kam sie herein gerauscht und verbeugte sich mit einer Halbkreisbewegung wodurch auch das übrige Publikum in ihren Gruß mit einbezogen wurde, vor dem Untersuchungsrichter.
»Herr Amtsgerichtsrat, ich habe die Ehre.«
Die Präliminarien erforderten ein wenig mehr Zeit als gewöhnlich, weil einige kleine Differenzen über Geburtsjahr, Namen und ehelichen oder nichtehelichen Stand von Fräulein Fengefisch – ihrer Papageientochter Dasein verursachte hier einige Trübung des Tatbestandes – erst beseitigt werden mussten. Dann aber ging der Untersuchungsrichter gleich medias in res.
»Ich höre, dass die Kinoschauspielerin Afra Baratta hier bei Ihnen gewohnt hat.«
»Noch wohnt, mit Ihrer gütigen Erlaubnis. Man kann ja freilich niemals wissen, was passiert, – mein Gott, ja, wenn man mir das gestern gesagt hätte, dass unser guter Herr Stieler …«
»Von dem will ich eben sprechen. Sie wissen wohl ebenso gut wie wir, dass Herr Stieler der Mann von dieser Afra Baratta war. Nun handelt sich’s um Folgendes: Ist Ihnen bekannt, ob er gestern im Laufe des Nachmittags noch in der Wohnung bei seiner Frau gewesen ist?«
»Ihr Mann, gewiss, ach du lieber Gott ja! Wie tief ergreifend ist es, einen Mann so zu verlieren, den man mit allen Fasern seines Herzens, wie man zu sagen pflegt, geliebt hat. Auf offener Bühne, vor allem Publikum, – als ich noch beim Theater war, – man erlebt ja schließlich auch sein Teil, und als einmal der Trapezkünstler Kugelmann mir von oben aus der Lust herunter gerade vor die Füße fiel …«
»Bitte, lassen Sie diesen Fußfall und sagen Sie mir, ob und wann Herr Stieler gestern bei seiner Frau gewesen ist.«
»Aber gewiss.« Jedes mal, wenn Germelmann so Josefinens Redefluss grausam unterbrach, wurde das Augengezwinker bei ihr noch schneller und erzeugte ganze Strahlenkränze von kleinen Falten. »Ich habe ja doch selber aufgemacht, als er läutete, deshalb muss ich es doch wissen. Und es muss, – lassen Sie mich einmal rechnen.
Die Probe zur ›Salome‹ hat um fünf Uhr zu Ende sein sollen, – freilich ziehen sich solche Proben ja manchmal noch länger hin, – das ist eben lästig beim Theater, – man kann unter sechs Malen fünfmal nicht genau sagen, wann man wieder nach Hause kommt, – und so passiert es häufig, dass man das Mittagessen kalt oder angebrannt bekommt, …«
»Also, bitte: kam Afra Baratta direkt von der Probe nach Haus?«
»Aber natürlich, – ganz rasch, – im Auto natürlich. Wohin hätte sie denn auch gehen sollen in dem Kostüm. Da hätte die Polizei schöne Wirtschaft gemacht, wenn sie so noch anderswohin hätte gehen wollen.«
»War es fünf Uhr, oder etwas nach fünf Uhr, als Afra Baratta nach Hause kam?«
»Ja, wahrhaftig, jetzt fällt es mir ein. Ich habe ja doch auf die Kuckucksuhr in der Küche gesehen, gerade wie sie herein kam. Ja, ja, gerade zwanzig Minuten über fünf ist es gewesen. Und ich habe gleich gesehen, dass mein Barattchen – ich nenne sie nämlich immer mein Barattchen – wieder einmal furchtbar schlechter Laune war. Und wie der Herr Stieler dann gekommen ist …«
»Wann war das?«
»Lassen Sie mich einmal sehen. Fünf Minuten ungefähr haben wir miteinander gesprochen, mein Barattchen und ich, und ich habe dann meinen Kaffee getrunken, und gerade, nachdem ich den letzten Schluck davon herunter hatte, da hat es geläutet. Halb sechs muss es also gewesen sein, – ich hatte schon früh Licht angezündet, – ach, unsereins ist so gewöhnt an die künstliche Beleuchtung, man hat geradezu Heimweh danach, – also, das Licht auf dem Korridor hat schon gebrannt, und unser armer Herr Stieler hat so wunderschön ausgesehen, als er hereinkam. …«
»Hat er mit Ihnen gesprochen?«
»Ein paar Worte nur, Herr Gerichtsrat, – ich bitte sehr um Verzeihung, wenn der Titel nicht richtig sein sollte. Herr Stieler hatte es scheinbar eilig, und ich habe nur eben sagen können, dass unser Barattchen wieder einmal so furchtbar schlechter Laune wäre, – da war er auch schon an mir vorüber und hinein in ihr Zimmer, und ich, …«
»Wussten Sie den Grund für die schlechte Laune der Dame?«
»Den Grund? Ach, Herr Obergerichtsrat, es war bei meinem Barattchen immer der gleiche, – so was von Eifersucht ist mir noch niemals vorgekommen, – ja, mein Gott, wenn man einen Mann ganz für sich allein haben will, muss man doch keinen Künstler heiraten, der jeden Abend in Trikot auf der Bühne steht, nicht wahr? Aber ich habe sagen können, was ich wollte, nichts hat geholfen. Und er war nicht einmal einer von den Schlimmen, ganz im Gegenteil. Nur dass ihr Gefühl mit ihr durchging, anders kann ich es nicht nennen. Und wenn das wieder einmal durchgegangen war, dann hat sie dein armen Stieler Szenen gemacht, Szenen, – ach, du lieber Gott! Er hat mir oft von Herzen leid getan, wenn ich auch nichts gegen mein Barattchen sagen will. Und gestern, – ja, gestern muss es ganz bös hergegangen sein, ich habe das Reden und Schelten bis in mein Zimmer hinein gehört. Nicht etwa, dass ich gehorcht hätte, – nein, Sie wissen ja: ›Der Horcher an der Wand‹ – und ich könnte darum auch nichts Genaues angeben, was die beiden gesprochen haben, aber …«
»Ein Streit also war zwischen den beiden.«
»Du lieber Gott, ja, – natürlich in aller Freundschaft, wie das unter Eheleuten so vorkommt. Aber geschrien haben sie, dass ich es haben hören müssen, ob ich wollte oder nicht.«
»Ist Ihnen bekannt, ob Herr Stieler bei seiner Frau dort etwas an Speisen oder Getränken zu sich genommen hat?«
»Wenn man sich so streitet, – ach nein, da hat man doch meistens keinen Appetit. Und sie hätte mich dann doch auch rufen müssen, dass ich, – nein, das einzige, was ich sagen könnte, das war ein gebrauchtes Glas, das ich hinterher mit hinaus genommen habe.«
»Was haben Sie damit gemacht?«
»Mein Gott, was man mit gebrauchten Tellern und Gläsern macht, wenn man sein Haus rein und ordentlich hält. Und bei mir muss es immer aussehen wie in einem Schmuckkästchen. Ja, das Glas hab’ ich natürlich abgespült und ausgewischt …«
»War etwas darin? Irgend ein Bodensatz oder dergleichen?«
»Ein Rest von einem weißen Pulver, jawohl. Das war aber gar nichts besonderes, weil mein Barattchen immer solche Pulver im Hause gehabt hat für ihre Nerven. Sie hat eine ganze Menge davon genommen, und ich habe manchmal gedacht, es wäre vielleicht besser …«
»Würden Sie das Glas noch genau bezeichnen und herausfinden können, von dem Sie sprechen?«
»Ach nein, Herr Oberlandesgerichtsrat. Ich habe gerade gestern Abend meinen Küchenschrank aufgeräumt, und ich habe von dieser Sorte Gläser beinahe noch ein Dutzend, – meine Tochter hat sie mir einmal geschenkt, – es war damals, nachdem sie …«
»Haben Sie Herrn Stieler gesehen, als er fortging.«
»Nein, ich müsste lügen, wenn ich das behaupten wollte. Vielleicht haben die Gläser gerade geklappert beim Fortstellen, jedenfalls ist er fortgegangen, ohne dass ich irgend etwas, davon gemerkt hätte. Mein Barattchen muss auch sehr leise hinausgegangen sein, ich habe nicht einmal die Korridortür zuschnappen hören.«
»Ist sie mit Herrn Stieler zusammen fortgegangen?«
»Das kann ich durchaus nicht sagen, Euer Hochwohlgeboren. Er war fort und sie war fort, und ich bin allein zurückgeblieben wie auf einer einsamen Insel. Und hinterher, wie sie wiederkam, – du lieber Gott, ich habe sie gar nicht mehr fragen können ,- sie war ja so furchtbar aufgeregt und eilig, weil sie sich verspätet hatte, – sie musste ja doch zur Bahn, um nach Petersburg zu fahren zum Gastspiel, und als ich noch beim Theater war …«
Sie fuhr zusammen; die Telefonglocke war ihr aufdringlich ins Wort gefallen. Germelmann sah den Kommissar an, dessen Blick dem seinen ausdrucksvoll begegnete, und sagte dann: »Die Hauptsache hätten wir wohl gehört. Warten Sie, bitte, noch ein wenig draußen, ob wir Sie vielleicht weiter zu befragen haben.«
»Gewiss, Herr Untersuchungsrichter, es wird mir eine Ehre und ein Vergnügen sein«, sagte Rosa d’Otranto mit einem neuen Strahlenfeuerwerk um die Augen, und machte wieder ihre Bühnenhervorrufsverbeugung, wobei sich durch eine leise, zuckende Bewegung in den Händen die frühere Gewohnheit, Kusshände zu werfen, andeutungsweise verriet. Aber sie blieb gemessen und feierlich, wie der Ort es verlangte.
Während des Abschieds ging der Kommissar eilig zum Telefon und kam von dort jetzt, nachdem sich die Tür hinter ihr geschlossen hatte, mit rotem Kopfe hastig zurück.
»Herr Amtsgerichtsrat, wir haben doch nicht vergeblich gearbeitet. Eben kommt von der Anatomie die Mitteilung, dass in der Leiche von Xaver Stieler als Ursache seines Todes ein starkes Pflanzengift unzweifelhaft festgestellt worden ist.«
»Alle Wetter!« Germelmann schlug mit seiner flachen Hand auf den Schreibtisch »Also doch, – das hätt’ ich nicht geglaubt.«

