Fritz Wildaus Abenteuer zu Wasser und zu Lande 1
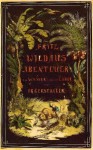 Friedrich Gerstäcker
Friedrich Gerstäcker
Fritz Wildaus Abenteuer zu Wasser und zu Lande
Kapitel 1
Worin ich den Leser mit dem Helden unserer Geschichte bekannt mache
Gar nicht so sehr weit von dem kleinen Städtchen Hudson, am Hudson River in den Vereinigten Staaten, hatte sich, es sind nun wohl einige Jahre her, eine ganze Kolonie von Deutschen angesiedelt, Farmen dort angelegt, Häuser gebaut und so vorteilhaft mit den Produkten des Bodens und ihren sonstigen Erzeugnissen zu spekulieren gewusst, dass sich fast alle, mit nur sehr wenigen Ausnahmen, eines gewissen Wohlstandes erfreuten, bei den Amerikanern der Nachbarschaft auch in gutem Ansehen standen und mit ihnen in Frieden und Freundschaft lebten.
Unter Amerikanern verstehe ich aber hier die weiße Bevölkerung des Landes, die von Europäern – meist Eingewanderte -, geborene und auferzogene Generation, welche die roten Ureinwohner und früheren Besitzer und Eigentümer des Bodens schon lange in das wilde Land des fernen Westens zurückgetrieben hatte. Diese nennen sich auch nun vorzugsweise und allerdings ein wenig anmaßend, kurzweg Amerikaner, als ob Amerika nicht ein so gewaltig großes Land wäre und außer diesem Teil des Ganzen, außer den Vereinigten Staaten der Republik Nordamerikas, nicht auch noch Kanada und Mexiko, die ganze Westküste und Mittel- und Südamerika mit dem ganzen Brasilien, Chile, Peru, den La Plata-Staaten und vielen anderen kleineren Reichen enthielte.
Ich habe vorher gesagt, dass sich in der kleinen Kolonie fast alle, mit nur sehr wenigen Ausnahmen, eines gewissen Wohlstandes erfreuten und einer dieser Letzteren ist es gerade, den ich dem Leser hier vor allen anderen vorstellen muss.
Es war dies ein ganz alter Mann, der erste Ansiedler mit in dieser Gegend, welcher, wenn man den Nachbarn hätte glauben wollen, eigentlich steinreich sein musste, da er fast sein ganzes Grundstück in kleinen, zu einer Stadt ausgelegten Parzellen (kleinen Teilen) und zwar zu enormen Preisen verkauft hatte. Er behauptete aber, sein ganzes Vermögen bei einer unglücklichen Spekulation zur See verloren zu haben und lebte daraufhin in einem kleinen unscheinbaren Häuschen so ärmlich und zurückgezogen, dass die Nachbarn zuletzt selber, so sehr sie auch im Anfang darüber die Köpfe schüttelten, denken mussten, der Mann sei wirklich so arm, wie er sage. Kaspar Rothhayn – so war sein Name -, sparte sich im wahrsten Sinne des Wortes das Brot vom Munde ab. Wenn seine Nachbarn, wie das in Amerika Sitte ist, zum Frühstück morgens, mittags und abends Fleisch und sonstige nahrhafte Speisen hatten, kaute er trockenes Brot oder traktierte sich höchstens mit einer Wassersuppe, sodass die Ansiedler wirklich mehr als einmal zusammentraten und ihn unterstützen wollten – denn es sah fast aus, als ob er im Begriff sei zu verhungern. In einem solchen Fall kamen aber immer wieder wunderlicherweise Beweise vom Gegenteil auf. Es gab Menschen in der Ansiedlung, die sogar behaupteten, der alte Rothhayn sei reicher als sie alle zusammen, habe aber sein Gold in eisernen Töpfen verscharrt und vergraben, anstatt es zum Segen der Menschen im freien Sonnenlicht arbeiten zu lassen und wäre mit einem Worte, der größte reiche Geizhals, den die Welt trage.
Das wäre übrigens noch alles angegangen, wenn er eben nur allein gedarbt und gehungert hätte. Die Nachbarn würden sich dann vielleicht nicht einmal viel um ihn bekümmert haben, denn er war unfreundlich und barsch mit jedem. Manchmal kam es den Leuten ordentlich vor, als ob er ihnen selbst das Sonnenlicht missgönnte, das er mit ihnen teilen musste. Aber er hatte auch noch einen Knaben bei sich, dessen Eltern in Amerika vor Jahren gestorben waren, der nun ganz allein in der Welt stand und bei dem alten Geizhals nicht etwa das Gnadenbrot verzehrte, sondern arbeiten musste von früh bis in die Nacht, die wenigen Brotsamen auch noch schwer und sauer genug zu verdienen, die ihm der alte Mann des Tags nur zu oft vorrechnete und auch vorwarf.
Morgens mit Tagesanbruch musste er auf, ihr dürftiges Mahl bereiten und dann hinaus ins Feld, den ganzen Tag den kleinen Acker zu bestellen und die wenigen Früchte anzubauen, die sie beide zu ihrem ärmlichen Lebensunterhalt brauchten. Dann war der Alte noch immer barsch und unfreundlich mit ihm und wollte ihm keine Freiheit lassen und keine Freude fast gönnen auf der weiten Welt.
Die Nachbarn hätten den fleißigen Knaben nun allerdings gerne zu sich genommen und ihm auch einen recht guten Lohn gezahlt für das, was er tat. Wenn der Alte aber so etwas merkte, wurde er auf einmal viel freundlicher mit ihm, sagte ihm auch wohl, dass er ihn nicht verlassen dürfe, da er ja die einzige Stütze seines Alters wäre, und versprach ihm, dass er, wenn er, der Greis, einmal sterbe, auch alles haben solle, was er hinterließe – die kleine Hütte und das Stückchen Feld.
Fritz – so hieß der Knabe – war viel zu gutmütig, dem alten grämlichen Mann irgendetwas nachzutragen und ein herzliches Wort vertrieb gewöhnlich all die bösen und hässlichen Erinnerungen aus seiner Seele, die früheren Szenen mit dem Pflegevater darin zurückgelassen.
Ein Paar Hundert Schritte von dem Haus des alten Rothhayn entfernt und nur durch ein kleines, ziemlich dicht mit Unterholz durchwachsenes Wäldchen davon getrennt, lag eine andere kleine Farm, die ebenfalls einem Deutschen, namens Wolfram, gehörte.
Der alte Wolfram bildete gewissermaßen ein Gegenstück zu seinem Nachbar Rothhayn, wenn er auch keineswegs so geizig – und hatten die Nachbarn recht – so reich war wie dieser, aber er war mürrisch und abgeschlossen, verkehrte fast mit niemandem, obgleich das doch sonst in der Ansiedlung eine recht freundliche und eingeführte Sitte war, dass sich die Nachbarn manchmal einander besuchten, über ihre Ernten und Bebauungsart sprachen und manche nützliche Kenntnisse, die sie aus dem großen und tüchtigen Buch der Erfahrung gelernt hatten, untereinander tauschten. Und den alten Rothhayn hasste er besonders.
Wolfram hatte Familie, Frau, Kind und eine alte Großmutter bei sich. Das Kind war ein kleines Mädchen, ein so liebes herziges Ding, wie nur je eins blauen Himmel über und blumige Erde unter sich gehabt hatte. Die Mutter liebte das kleine Wesen auch mehr als sich selber und hegte und pflegte es wie ihren Augapfel. Aber der Vater machte sich nicht viel aus ihr, war oft rau und unfreundlich ihr gegenüber und meinte nicht selten, so ein Mädchen sei zu gar nichts zu gebrauchen, weder in Wald noch Feld, weder mit der Axt noch mit dem Pflug. Darin hatte er aber großes Unrecht, denn Helenchen, obgleich erst neun Jahre alt, half schon recht fleißig mit im Haus, wo sie nur konnte und wo ihre schwachen Kräfte ausreichten, sie kartete Baumwolle, spann und freute sich nie so sehr, als wenn sie ihren Eltern in irgendetwas zur Hand gehen konnte.
Fritz zählte fünfzehn, Helenchen etwa neun Jahre und die beiden Kinder waren nicht allein seit ihrer frühesten Jugend Spielkameraden gewesen, sondern Wolframs Frau hatte auch den Knaben seines stillen, ordentlichen Wesens wegen fast so lieb gewonnen, als ob es ihr eigenes Kind wäre. Nichts kränkte sie dabei mehr, als dass sie mit ansehen musste, wie schlecht es der Knabe im Haus des alten Mannes, seines Pflegevaters, hatte, ohne dass sie eben imstande gewesen wäre, etwas für ihn zu tun, um seine Lage zu verbessern. Der alte Wolfram dagegen mochte den Knaben nicht leiden, wenn ihm dieser auch nie Grund dazu gegeben hatte. Dieser Widerwillen wuchs mehr und mehr, als er sah, dass seine Frau ihn lieb gewann und er verbot ihm zuletzt sogar das Haus, das dem armen Fritz in der letzten Zeit weit mehr als die eigene Heimat geworden war. Zu seiner guten Mutter, wie er die Frau Wolfram nannte, konnte der arme Knabe nun gar nicht mehr und mit Helenchen durfte er nur dann und wann einmal ein Viertelstündchen plaudern, wenn er sie, wie das wohl manchmal geschah, zufällig auf dem Weg traf. Wenn der Vater das nach dem Verbot noch gemerkt hätte, wäre er zuversichtlich entsetzlich böse darüber geworden.
So kam der Monat Mai heran und mit ihm die Zeit, in der ich nun meine Geschichte beginnen will, als Fritz einmal seiner kleinen Freundin morgens begegnete, aber er konnte nicht mit ihr sprechen, denn ihr Vater kam dicht hinter ihr drein durchs Holz. Helene flüsterte ihm nur zu, er solle heute Nachmittag einmal an den Zaun ihres Gartens kommen, denn sie habe ihm etwas Trauriges zu sagen und sie solle fortziehen in eine große Stadt.
Fritz stand ganz starr vor Schreck und erst des alten Wolframs barsche Anrede, der wirklich gleich darauf um die nächsten Büsche bog und ihn hier allein und traurig am Wege stehen sah, brachte ihn wieder zu sich selber. Er schlich sich ganz bestürzt nach Hause und hörte selbst nicht, wie ihn der alte Rothhayn auszankte, dass er so lang geblieben und sich, dem lieben Gott die Tage abstehlend, in der Welt herumtreibe. Er dachte nur an den Nachmittag, wo er sein kleines liebes Helenchen zum letzten Mal sehen sollte und war froh, als ihm der alte Mann eine Botschaft nach dem Städtchen Hudson auftrug, wo er etwas besorgen sollte, was ihn jedenfalls bis nach Feierabend entschuldigen musste. Beeilte er sich, so konnte er gut zur rechten Zeit wieder zurück sein. Er lief wirklich, als ob er irgendetwas Böses verbrochen hätte und nun seinem eigenen bösen Gewissen damit entlaufen wollte, was aber doch nicht geht und wenn man auch imstande wäre, durch die Luft zu fliegen.
Viel früher, als es sein Pflegevater wohl vermutet haben mochte, war er denn auch zurück. Als er den schmalen Pfad durchs Holz einschlug, der zu Meister Wolframs Haus führte und endlich am Garten Helenchen traf, die ihm traurig die kleine Hand entgegenstreckte und »Behüt’ dich Gott, Fritz!« sagte, da wurde es ihm so weich und weh ums Herz, dass ihm die Tränen in die Augen traten und er frischweg hätte weinen mögen – hätte er sich nicht vor Helenchen geschämt, sie so etwas an sich sehen zu lassen.
»Ich muss fort von hier, Fritz!«, sagte das kleine Mädchen, »ich komme zu einer Verwandten nach Rochester, wo ich in die Schule gehen soll. Wenn ich groß bin, komme ich wieder – behüt’ dich Gott, Fritz, so lange.«
»Behüt’ dich Gott, Helenchen!«, sagte auch Fritz – »aber es tut mir entsetzlich weh, dass du fort von hier gehst und ich möchte meinem Vater auch davonlaufen.«
»Sei brav, Fritz«, sagte aber das kleine Mädchen und es stand ihr gar so lieb, wie sie den doch weit größeren Knaben ermahnte, gut zu sein. »Du wirst den alten Mann gewiss nicht allein lassen wollen. Mein Vater schimpft auch oft mit mir, wenn ich es vielleicht auch nicht immer verdient habe. Aber er hat mich doch so lieb und ich glaube, ich sterbe, wenn ihm einmal ein Leid geschähe. Das kann recht gut bei deinem geschehen, wenn du fortgehst. Ich ginge auch nicht fort, wenn mich nicht die Eltern schickten«, setzte sie leiser hinzu.
»Ach du bist viel besser als ich, Helenchen«, sagte Fritz, »aber ich will dir auch folgen. Wenn du wieder kommst, sollst du hören, wie gut ich gewesen bin.«
»Wenn ich wiederkomme, bringe ich dir auch etwas mit«, sagte Helenchen.
Fritz lächelte durch seine Tränen durch, denn es kam ihm doch komisch vor, dass das kleine Mädchen ihm, dem großen Jungen, etwas aus der Stadt mitbringen wollte. Er drückte ihr die Hand, und als sie ihm diese nun entzog und ihm noch einmal Lebewohl sagte und ihm versprach, dass sie recht oft an ihn denken wollte, da drehte er sich von ihr ab und schritt langsam in den Wald hinein, denn er weinte bitterlich und er hätte die Tränen nicht zurückhalten können, wenn ihn Helenchen auch wirklich darum ausgelacht hätte. Aber sie lachte nicht und ging langsam nach Hause und war recht, recht betrübt. Sie wusste selber eigentlich nicht so recht, warum, denn sie kam, ja wieder zurück, wenn sie groß war.

